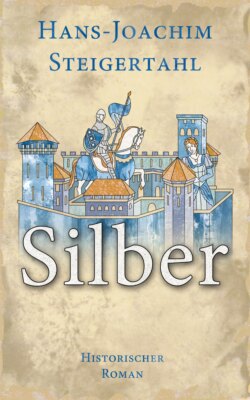Читать книгу Silber - Hans.Joachim Steigertahl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lemesós (Limassol), Zypern, September 1248
ОглавлениеGenuesische Galeere um genuesische Galeere lief in den Hafen von Lemesós ein, entlud ihre Ladung aus Rittern, Knappen, Knechten, Pferden, Rüstungen, Waffen, Mätressen, Nahrungsmittel, Weinkaraffen….. Was immer das riesige Kreuzfahrerheer brauchte, musste herbeigeschafft werden, und die Republik Genua konnte ihre Schiffe nicht besser einsetzen als zum Transport all dieses – auch wenn jedes hundertste Schiff als Spende umsonst fuhr!
Für die meisten Kreuzfahrer, gleich welchen Standes, war die Überfahrt unangenehm gewesen – das Schwanken des Schiffs auch bei ruhigem Wind, die Enge, der Gestank, das ständige Getrampel der Tiere, das meist brakige Wasser, das eintönige, nur aus Getreidebrei bestehende Essen morgens, mittags und abends. Für einige hundert Ritter und ihr Gefolge war die Überfahrt allerdings bereits das Ende des Kreuzzuges geworden.
Ein Verband von 10 Galeeren, wie immer begleitet von zwei wendigen, schwer bewaffneten Zweimastern der genuesischen Marine, war östlich von Syrakus in einen schweren Sturm geraten. Die Wellen waren so gewaltig, dass die Ruder wie Zweiglein brachen. Der eine Zweimaster verlor beide Masten und trieb nach wenigen Minuten kieloben über einen Wellenkamm, der andere ritt, nur mit der Fock segelnd, den Sturm unter dem Schutz der Küste Siziliens aus und brachte später die Nachricht nach Lemesós, dass alle zehn Galeeren gesunken seien – und mit ihnen ein fast unersetzlicher Truppenteil.
Jean de Beaumont fluchte gotteslästerlich, als er im Zelt König Ludwigs die Neuigkeit vernahm. Der Kreuzzug, zu dem er mit solcher Freude aufgebrochen war, hatte in den wenigen Wochen seit dem Kreuzeid seine Stimmung schwer getrübt. Als Kämmerer des Königs sah er die Ströme an Gold und Silber durch seine Hände fließen, die nötig waren, um nur die Kosten des Hofes und den Transport zu bezahlen – die Ritter mussten für sich und ihr Gefolge selbst aufkommen. Und die Beschaffung der Münzen aus Franzreich war jedes Mal ein gewagtes Spiel, denn längst hatte sich unter den Piraten herumgesprochen, dass die Schätze Franzreichs in Säcken in ihrer Nähe herumsegelten. Wenn dann auch noch viele Kämpfer gar nicht am Etappenziel ankamen, schwächte das die Kampfeskraft und den Kampfeswillen. Schlimmer aber war, dass der König den Genuesern zusagen musste, dass er für mögliche Verluste aufkommen würde. 10 Galeeren und eine Brigantine würden ihn mehr kosten als die Verpflegung des ganzen Heeres für einen Monat – und es war schon Herbst!
Heinrich von Meißen sah seinen Freund an und wusste, dass er jetzt die Seite des Freundespaares sein musste, diefür die schöneren Seiten des Lebens zuständig war. „Lass das Geschimpfe, Jean. Wir sind um unseres ewigen Lebens willen hier, und das Geld, das verloren ist, war doch sowieso nicht Deines! Lass uns dieses Zeltlager wenigstens heute Abend einmal verlassen und uns im Städtchen vergnügen!“ „Du hast Recht! Genug des Ärgers für heute. Komm, wir kleiden uns wie einfache Soldaten und nehmen nur ein Beutelchen mit meinem Geld mit.“ Gesagt, getan. Der treue Gernot blieb zurück mit dem Auftrag, beide Rüstungen zu reinigen und für Nachschub an Wein und Käse zu sorgen.
Als sie das Lager verlassen hatten, sagte Jean: „Eine gute Idee von Dir, Henri. Wir haben bisher noch nicht ein einziges Mal über die Stränge geschlagen – und das, wo uns unsere zukünftigen Sünden doch bereits vergeben sind! Pierre La Motte hat neulich im Zelt des Königs Ludwig von einer Kneipe gesprochen, die noch so unter byzantinischem Einfluss steht, dass sie sauber ist, aber Zicklein vom Feinsten und vorzüglichen Wein serviert. Und was Pierre sonst noch so erzählte - lassen wir uns überraschen.“
Wie von selbst führte sie der Weg vom Lager gleich hinter dem Hafen den Hügel hinauf in die Richtung der Hochburg. Das geschäftige Treiben und die Verschiedenheit der Menschen beeindruckten Heinrich immer wieder. Ein bärtiger, dunkelhaariger Fischverkäufer mit blauen Augen hatte seinen Stand neben einem Obsthändler, der ganz offensichtlich afrikanischen Ursprungs war und für den Thüringer unbekannte Früchte lauthals anpries. Auf zweirädrigen Karren wurden Waren von Männern transportiert, die so mancher Erzählung in den trauten Winternächten entsprungen zu sein schienen: hochgewachsener Berber mit ihren blauen Turbanen überholten sehnige, aber viel kleinere Araber in ihren wehenden Gewändern, beide machten einem offenbar wohlhabenden Juden Platz, der durch seine Kopfbedeckung, die Kippa, und seine Schläfenlocken ganz eindeutig als orthodoxer Jude gekennzeichnet war, selbst wenn das wegen seines Gesichtsschnittes nicht nötig gewesen wäre. Sein Knecht, der den Karren schob, war unzweideutig ein Sklave aus Nordeuropa. Osmanen, Griechen, Italiker, Berber, Nubier, Ägypter – Lemesós war wahrhaftig ein Schmelztiegel der Völker. Und wie überall in von Christen beherrschten Gegenden des Orients mischten sich verschleierte wie unverschleierte Frauen und Mädchen in das Gewühl, während die Kinder zwischen den Erwachsenen herumwuselten. Die Mischung aus orientalischem Handel, dem Durcheinander von Religionen und Kulturen und der dominanten Anwesenheit von vor allem französischen Knechten und Knappen machten aus der verschlafenen Hafenstadt, die erst durch Richard Löwenherz, der hier während des dritten Kreuzzugs geheiratet hatte, bekannt geworden war, einen brodelnden Kessel aller menschlichen Eigenschaften. Raub, Erpressung, Todschlag, Mord, Vergewaltigung waren hier genauso an der Tagesordnung wie Hilfsbereitschaft, Almosen, Dankbarkeit und Hingabe.
Als die beiden fast auf dem Hügel angekommen waren, zeigte Jean auf eine kleine Gasse, die halblinks wieder den Hügel hinabzuführen schien. „Dort hinein!“ Wenige Schritte später standen sie vor einem zweistöckigen Haus, von dem nur das Eingangstor mit den schweren Türflügeln und der Inschrift „Λεμεσός“ (Lemesós) darüber zeigte, dass es sich hier um mehr als eine Mauer handelte. Auf Jeans Pochen hin wurde der eine Torflügel einen Spalt weit geöffnet und ein finsterer, riesiger Bursch mit Vollbart und dem Krummschwert an der Seite musterte sie. „Kein Eintritt für Knechte und anderes minderwertiges Volk“ fasste seinen Eindruck von den beiden, die eintreten wollten, zusammen und er versuchte, den Torflügel wieder zu zudrücken. Jean stellte seinen stiefelbewehrten Fuß in den Türspalt fingerte nach seinem Beutel und drückte dem Riesen eine Münze in die Hand. Der schaute das Geldstück nicht einmal an, sondern ließ seinen Daumen über die Oberfläche gleiten, öffnete mit einem schiefen, aber wohlwollenden Lächeln die Tür und sagte: „Oh, die Herren sind verkleidete Ritter – eine gute Vorsicht! Herzlich willkommen im Lemesós.“
Sie traten durch das Tor und kamen in einen kaum beleuchteten Gang; in den Nischen der dicken Festungsmauer standen Statuen fremder Götter und vor allem Göttinnen, die vom Aussehen her wenig mit Küchenfeen zu tun hatten. Am hinteren Ende des Ganges tat sich eine Türwölbung auf, durch die helles Licht fiel. Jean und Henri traten durch diese Wölbung und standen in einem Innenhof: an allen Seiten gab es Säulengänge, in der Mitte plätscherte ein Springbrunnen und Heinrich stellte mit einem Blick an den Himmel erstaunt fest, dass der ganze Hof mit einem festen Dach überdeckt war. Das Licht, das sie bemerkt hatten, kam von Fackeln, offenen Feuerschalen und Kerzen, die in den beiden Etagen der Säulengänge geschickt verteilt waren, dass das ganze Atrium erleuchtet, aber nicht allzu hell war. Rund um den Springbrunnen waren Tische so platziert, dass zwischen ihnen und dem Brunnen ein gewisser Abstand eingehalten war. Überall standen große Tontöpfe mit blühenden Pflanzen, die Tische waren mit weißen Leinendecken gedeckt, die Stühle und Bänke mit Kissen gepolstert, über allem schwebte der Duftreifer Feigen, wie er so typisch für Zypern war. Sowie die beiden Ritter den Torbogen durchschritten hatten, näherte sich ihnen ein barfüßiger Junge in roten, knielangen Pluderhosen und einem weißen Überwurf und bat sie wortlos mit deutlichen Gesten darum, ihnen einen Platz anbieten zu dürfen, von dem aus sie die Darbietung auch gut verfolgen könnten. Erst da wurde ihnen bewusst, dass das regelmäßige Viereck des Hofes von einer etwas erhöhten breiten Stufe unterbrochen wurde, die ganz offensichtlich als Bühne gedacht war. Jean und Heinrich wählten einen Tisch, der etwas abseits stand, so dass sie sehen konnten, ohne allzu genau gesehen zu werden. Kaum hatten sie sich gesetzt, brachte der Junge weißes Brot und ein Tablett mit vielen kleinen Tellern, auf denen viele kleine Happen von Fleisch und Fischgerichten dekoriert waren. Diese Meze, eine typische Landesspeise, gab einen Querschnitt über die kulinarischen Spezialitäten: frisches, knuspriges Brot, eingelegtes Gemüse, Jogurt mit Minze, Sesampaste, Fischpastete, Hackfleischbällchen, Oliven, Schafskäse, gebratenen Fisch und vieles mehr; dazu ein Krug mit kühlem, gewürztem Weißwein und edle Pokale.
Sie schauten sich um und stellten fest, dass etwa die Hälfte der Tische bereits besetzt war, obwohl es noch früh am Abend war. Die Gäste waren – Lemesós entsprechend – höchst unterschiedlich: An einem Tisch tafelten bereits Kreuzritter, die ihrem Dialekt und ihrem Gelärm entsprechend aus der Provence zu kommen und sich mit diesem Kreuzzug dem Kampf um ihre Heimat gegen England zu entziehen schienen; an einem weiteren Tisch saßen zwei in edle Stoffe gehüllte Araber, die tafelten, und vier Frauen, die völlig in glänzende, dunkelblaue Schleier gehüllt waren und deswegen auch weder essen noch trinken konnten; ein dritter Tisch war Tafel für eine Runde fröhlicher, zechender Ritter, die von Sprache, Kleidung und Verhalten wohl als Überreste derjenigen Kreuzritter einzuordnen waren, die im letzten Jahr von den Muslimen aus Palästina vertrieben worden waren und nun Zuflucht auf Zypern gefunden hatten; vor den beiden Freunden saß eine Runde von Kaufleuten aus vieler Herren Länder, die – nach ihren eigenen, lauten Bemerkungen - vor allem einen guten Blick auf die Bühne und viel zu Trinken haben wollten. Ganz am Rande drängten sich genuesische Seeleute an einem Tisch, genau beobachtet von der Besatzung einer venezianischen Brigantine.
Der Junge kam, schaute auf die Teller und machte deutlich, dass er gern mehr bringen würde. Jean winkte ab und bestellte gegrilltes Zicklein. Der Junge verneigte sich und verschwand. Die beiden nutzten die Pause zu einem kurzen Austausch im lothringischen Dialekt, von dem sie sicher waren, dass keiner der Anwesenden ihn verstehen würde: „Was hat Pierre La Motte gemeint, dass es hier mehr gibt als gutes Essen?“ „Ich weiß es nicht, gerade als er es erklären wollte, kam der König dazu, aber die Meze sind auf jeden Fall schon mal das Beste, was ich in den letzten vier Wochen zu essen bekommen habe.“ „Schau mal zu dem Tisch mit den Arabern – kommt es Dir nicht seltsam vor, dass die Männer Frauen mit in ein öffentliches Gasthaus bringen – und dann auch gleich vier?“ „Du hast Recht, aber verstehe einer die Muselmänner!“
Bevor Heinrich antworten konnte, erklangen Lauten und von beiden Ecken der Längsseite traten als Araber gekleidete Musikanten auf die erhöhte Stufe und begannen eine Melodie zu spielen, die den beiden Freunden völlig unbekannt war, sie aber an ein süßes Sehnen erinnerte. Der Lärm im Hof klang ab, alle schienen die gleiche Wirkung zu spüren und begannen, auch in sich hinein zu hören. Als die Lautenspieler endeten, gab es keinen Applaus, die entstandene Stille dauerte ein wenig an und wurde erst unterbrochen, als die Kaufleute nach mehr Wein riefen. Jean und Heinrich hatten ihre Meze vertilgt und baten ebenfalls um einen weiteren Krug Wein, als der Junge die Zicklein brachte. Sie waren mit Rosmarin gewürzt, hatten eine köstliche knusprige Kruste und einen so intensiven Geschmack, dass den Beiden das Gespräch nicht weiter wichtig war.
Auf dem Podium erschien ein Gaukler, wie man sie in allen Städten zu sehen bekam: behängt mit Musikinstrumenten, Fratzen ziehend und mit Bällen jonglierend. Er schien mit sich selbst zufrieden und spielte so vor sich hin, bis alle Gäste das Hauptgericht verzehrt hatten. Dann aber stand er auf, legte sich, auf einen Ellbogen und ein Bein gestützt auf die Bühne und begann – Feuer zu spucken! Die Seeleute beider Städte schrien auf, die Kaufleute erstarrten, nur die Ritter behielten ihre Haltung. Ohne Worte gelang es dem Gaukler, den Kampf zwischen einem edlen Sohn Zyperns und dem Drachen darzustellen, indem er immer wieder blitzschnell die Position änderte und durch kleine Veränderungen seiner Kleidung die Rollen deutlich machte. Als der Drachen dann zum letzten Mal Feuer spuckte und der siegreiche Zypriot sich über ihm erhob gab es Beifall von allen Tischen.
Der Junge räumte die Teller mit den abgenagten Knochen ab, brachte Trinkschalen und Krüge mit anderem Wein und servierte nacheinander wieder allen Gästen ein Tablett, das reich gefüllt war mit süßen Teigtaschen und eingebackenen Mandeln; beides triefte von Honig und duftete nach vielen Gewürzen; der Wein dazu war rot, schwer und süß.
Die Akkorde eines dreiseitigen Saiteninstruments klangen auf, der Musiker setzte sich auf die rechte Seite der Bühne und lockte durch einen besonderen Akkord einen Flötenspieler dazu, der mit seinen Tönen der Melodie des ersten zu folgen suchte; als beide ihren Rhythmus und Klang gefunden hatten, kam ein Männchen und setzte sich in der Mitte der erhobenen Plattform an den Rand; sein Instrument schien eine umgekehrte Amphore zu sein, aber die eigentlich offene Seite war mit einer Tierhaut bespannt und durch unterschiedliches Antippen des Trommelfells erreichte der Alte die Klangfülle vieler Instrumente. Als er sich in den Rhythmus eingespielt hatte, sprangen Männer über die Plattform in den Kreis rund um den Springbrunnen; sie hatten nackte Oberkörper, trugen weite Röcke bis zum Boden und auf den Köpfen balancierten sie Tabletts mit Kerzen. Als die Musik schneller wurde, fingen sie an, sich um die eigene Achse zu drehen und dabei doch den Raum um den Springbrunnen durch weiter kreiselnde Bewegungen zu füllen. Immer schneller wurde der Rhythmus der Musik, immer schneller drehten sich die Tänzer und schienen durch ihre Geschwindigkeit das Licht zum Erlöschen zu bringen.
Heinrich erschrak fast, als er spürte, wie in diesem Wirbeln von Noten und Körpern jemand seine rechte Hand zart anfasste; neben seinem Ohr sagte eine vibrierende Stimme auf Französisch: „ Kommen, Sie mein Herr. Ich möchte Ihnen das Besondere des Λεμεσός zeigen.“ „Aber ich weiß nicht – was ist das? Kann ich das? Die Kosten…“ Nun hörte er ein leises Lachen und eine aufflackernde Feuerschale erlaubte ihm einen Blick auf seine Gesprächspartnerin zu werfen: Es war eine der blauverschleierten Frauen, die mit den arabischen Vornehmen zu Tisch gesessen hatten. „Nur keine Bange! Meine Freundin kümmert sich um deinen Freund und unser Diener“ sie deutete mit einer Kopfbewegung auf den Jungen mit den Pluderhosen, „ hat den Inhalt des Beutelchens begutachtet – es reicht für euch beide!“ Damit zog sie ihn von der Bank hoch und führte ihn im Schatten der Tanzenden zu einer Tür, die hinter den linken Torbögen versteckt war.
Als die Tür sich hinter ihnen schloss, brauchten Heinrichs Augen Zeit im Halbdunkel zu erkennen, was ihn umgab: Sie waren in einem mit Teppichen ausgekleideten Raum, geschmackvoll eingerichtet mit kleinen Tischchen mit Kirschholzintarsien, darauf Schalen mit Duftölen, andere mit Nüssen und Gebäck, wieder andere mit Pokalen und Krügen; ein großes Polster mit vielen Kissen darauf lud zum Niederlegen; und über allem schwebte der berauschende Geruch von Weihrauch.. Ein Fenster und eine Tür ließen eine Dachterrasse vermuten, wie sie in vielen zyprischen Häusern zu finden war, eine weitere, offene Tür zeigte marmorgetäfelte Wände und Böden. In großen Vasen und am Fenster standen Blumen, an der Tür konnte man einen Oleanderbusch sehen, der draußen stand.
Seine Begleiterin löste den Schleier, warf ihn auf einen Hocker und drehte das Licht einer auf dem Tisch stehenden Öllampe höher. „Ich heiße Leila und wohne und arbeite jetzt in diesem Haus. Vorher war ich, wie meine Freundinnen, in der Haremsschule des Scheichs as-Salih Ayyub in Kairo, wo wir lernen sollten, wie man Männer wie den Sultan zufrieden stellt. Als der aber den Krieg gegen seinen Vetter an-Nasir Yusuf verlor und Yusuf der Harem zufiel, wurden wir Novizinnen wie unser Lehrer, der Eunuch al-Abd Ser, alle verjagt, weil er uns nicht traute. Deshalb sind wir in unsere Heimat Lemesós zurückgekehrt, wo wir früher an den Sultan verkauft worden waren.“ Während sie sprach, betrachtete Heinrich sie gebannt: ein klar geschnittenes schmales Gesicht mit deutlichen Backenknochen, einem vollen roten Mund und schwarzen Augen, deren Größe durch dunkle Kajal-Striche noch betont wurde, war umrahmt von einer Fülle schwarzen, lockigen Haares, das ihr über die Schulter bis auf die Brust fiel; die dünne Tunika, wieder in dem glänzenden Dunkelblau, enthüllte mehr als dass sie den Körper darunter verhüllte. Heinrich fühlte sich wieder an die Empfindung erinnert, die ihn übermannt hatte, als die Lautenspieler den Abend einleiteten, und wehrte sich nicht im Geringsten, als sie anfing, seine Kleider zu lösen und dabei sagte: „Ihr Franzen riecht doch immer sehr nach Krieg und Ungutem – lass dich auskleiden und komm dann mit mir ins Bad nebenan!“ Nackt folgte er ihr in den Nachbarraum, wo einige Stufen in ein Wasserbecken führten. Sie nahm eine Klingel von einem Hocker, läutete und ließ sofort durch eine nicht sichtbare Tür eine Dienerin ein, die zwei Zuber mit dampfend heißem Wasser ins Becken schüttete. Als diese wieder verschwunden war, schob Leila ihn die Stufen hinunter ins Wasser, das ihn angenehm umspielte. Sie nahm einen runden Gegenstand wie eine kleine Wolke auf, tauchte ihn in eine Schale mit einer hellen, wohlriechenden Flüssigkeit und reichte ihm das Ganze. Er starrte sie an ohne zu wissen, was er tun sollte, wenn auch wohl wissend, was er tun wollte. Sie lachte wieder leise, löste die Knoten an der Schulter ihrer Tunika, trat ebenfalls nackt aus dem auf den Boden sinkenden Kreis aus Stoff heraus, stieg die Stufen hinab und sagte: „Ich sehe schon, dass du zum ersten Mal so etwas erlebst! Leg dich ins Wasser und dann zeige ich dir, was zu tun ist!“ Er starrte sie weiter an, aber nun, als sich durch die Nähe ihr Körper mehr als deutlich machte, war es nicht das Starren des Unwissens, sondern des Genießens. „Dies hier ist ein Schwamm – die wachsen hier im Meer und man benutzt sie, um den Körper zu reinigen; ich habe ihn in Seife getaucht, und wenn du jetzt wieder aufstehst, kann ich dich einseifen und reinigen!“ Er gehorchte wortlos und genoss die zärtliche Berührung des Schwamms und des Schaumes am ganzen Körper, schwer mit sich ringend, ob er dieses Gefühl weiter ertragen konnte, ohne Leila weniger Zärtliches anzutun. Ab und zu schloss er die Augen, um nicht überwältigt zu werden, aber immer wieder betrachtete er ihren Körper: schlank, mit schmalen Hüften, die vollen Brüsten fast von den Haaren bedeckt, ein Hinterteil, das in seiner Festigkeit und Rundung zum Anfassen lud und die schlanken, wohlgeformten Beine mit den kleinen, ganz offensichtlich gepflegten Füßen. Als der Schwamm um seine hoch aufgerichtete Männlichkeit kreiste, wäre es fast um ihn geschehen gewesen, aber Leila verstand ihr Tun und drückte ihn wieder in das nun schon etwas kühlere Wasser. Sie selbst fuhr sich mit dem Schwamm über Lende und Po und nahm dann vom Rand des Beckens ein weiches Tuch, trocknete sich ab und zog Heinrich aus dem Becken um ihn ebenfalls zu trocknen, bevor sie ihn mit Duftöl einsalbte. Sie ging vor ihm her zu dem einladenden Polster, und als er versuchte, sie darauf zu legen, schüttelte sie den Kopf und bat stattdessen ihn, sich auf den Rücken zu legen. Dann kniete sie sich über ihn, legte seine Hände an ihre Brüste und senkte sich langsam über seinen Schaft. Obwohl sie sich nur wenig bewegte, war er so erregt – und hatte schon so lange bei keiner Frau mehr gelegen – dass er bald unter lautem Aufstöhnen in ihr explodierte. Sie lachte wieder ihr leises Lachen, das weiche Tuch kam noch einmal zum Einsatz und dann schmiegte sie sich an seine rechte Seite. „Erzähl‘ mir von dir,“ bat sie. Und während er anfing, sein Herz auszuschütten über seine unsichere Stellung als Landesherr, den ungewollten Kreuzzugseid, die Sinnlosigkeit des Herumsitzens in Lemesòs, fuhr ihre Linke zärtlich über seinen Körper und gerade als er sagte: „Obwohl ich Dir sonst nie begegnet wäre“, war seine Männlichkeit wieder erwacht. Nun legte sie sich auf den Rücken und bot sich ihm dar und nach wenigen Minuten war Heinrich mehr als befriedigt eingeschlafen
Als er erwachte, war Leila verschwunden. Das Tageslicht schien durch Tür und Fenster. Auf dem Tisch stand eine seltsame Kanne mit Stiel über einem kupfernen Gestell, in dem eine Kerze brannte. In der Kanne war ein schwarzes, wohlriechendes Gebräu, daneben ein kleine Trinkschale und ein Teller mit Gebäck.. Auf dem Hocker lag seine Kleidung, ordentlich zusammengefaltet, obenauf das Kurzschwert, dass er unter dem Soldatenkittel verborgen hatte. Er kleidete sich an, trank kleine Schlucke von dem heißen, schwarzen, süßen Getränk, aß ein paar Kekse und ging dann in den jetzt menschenleeren Hof hinaus. Nach einigem Suchen fand er den Gang zum Tor, bei dem – noch oder wieder – der Riese vom Vorabend wachte. Der grinste ihn an, öffnete den Torflügel, ließ Heinrich hinaus und verschloss die Tür dann hinter ihm hörbar.
Heinrich ging den kurzen Weg zurück zum Lager, und als er in Beaumonts Zelt trat, erhob sich dieser nahm ihn mit beiden Händen an den Schultern und bevor einer von beiden irgendetwas sagen konnte, fingen sie an zu lachen, denn beide bemerkten beim Anderen den Duft von Reinlichkeit und guter Seife. „Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich …“ Er konnte nicht weitersprechen, denn Gernot stürzte ins Zelt und stammelte außer Atem: „Verzeiht, edle Herren, aber eben ist drüben im Hafen ein Schnellsegler aus Venedig angekommen und mit ihm ein Bote, der eine sehr wichtige Nachricht für den Landgrafen bringt!“ „Lass ihn hereinkommen!“ Gernot stürzte wieder davon und erschien wenige Minuten später mit einem jungen Ritter, den Heinrich aus der gemeinsamen Zeit als Knappen am Hof in Erfurt kannte und begrüßte ihn freundlich. Der Bote, Eginhard, übergab ein versiegeltes Schreiben, das Heinrich erbrach. Er fing an zu lesen und wurde immer blasser: „Graf Hohnstein, mein Statthalter, schreibt, dass die aufsässigen Grafen Thüringens sich wieder zusammenrotten und beschlossen haben, ein Heer aufzustellen, um mir die Herrschaft wieder zu nehmen; die Anführer sind natürlich wieder die Grafen von Schwarzenberg, unterstützt werden sie dabei von Ottokar dem Zweiten, aus dem Haus der Přemysliden, der sich wohl schon als Herzog von Österreich sieht und mit Thüringen der mächtigste Fürst des Reiches wäre. Hohnstein sagt, dass ich sofort in die Heimat zurückkommen müsse, da ihm im erneuten Kriegsfall die Autorität fehle.“ Heinrich wandte sich an Jean de Beaumont; „Ich muss zurück. Du weißt wie opferreich und teuer meine Herrschaft erobert wurde.“ „Aber du hast einen Eid geschworen!“ „Ich kann weder Hohnstein noch die Landgrafschaft aufs Spiel stellen – und Du weißt, dass ich nicht wirklich aus Überzeugung hier bin!“ „Unsinn, Du hast wie jeder andere, der auf den Kreuzzug mitkommen wollte, hörst du: wollte, den Eid geschworen und dafür Vergebung der Sünden erhalten. Wenn du jetzt flüchtest, aus welchen Gründen auch immer, dann verlierst du dein Seelenheil, und ob du deine Landgrafschaft behältst, ist ja wohl seht fragwürdig!“ „Jean, nimm doch Vernunft an! Ich muss das Haus Wettin absichern und Hohnstein helfen – ich kann doch nicht wieder tatenlos zusehen wie zu Beginn des letzten Jahres, als treue Gefolgsleute hingemeuchelt und ihre Familien vernichtet wurden!“ „Tu, was du willst, aber meine Unterstützung bekommst Du nicht mehr.“ Damit wandte sich Jean de Beaumont ab und stampfte aus dem Zelt. Heinrich sank auf einem Hocker nieder und versuchte, klar zu denken. „Eginhard, wie bist du hier her gekommen? Wie lange hat das gedauert?“ „Ich bin direkt von Erfurt nach Venedig geritten, das hat schon zwei Wochen gedauert, und dann musste ich warten, bis ein Schiff nach Lemesós segelte, also etwa sechs Wochen bin ich schon unterwegs!“ „Sechs Wochen? Unterdessen kann sich das ganze Reich aufgelöst haben! Wo ist dein Schiff?“ „Es liegt drüben im Hafen und wartet auf eine Ladung, die im Gespräch der Seeleute auf der Herfahrt als sehr wertvoll eingeschätzt wurde, so dass sie sich einen gewissen Anteil versprechen!“ „Wann könnte der Venezianer zurückfahren?“ „Ich denke, wenn die Ladung da ist, schon morgen.“ „Schau, dass du für uns einen Platz an Bord bekommst – ich muss zurück!“
Nachdem Eginhard gegangen war, wandte sich Heinrich an Gernot: „Pack alles zusammen, was mir gehört – wenn Du nicht ganz sicher bist, lass es hier; pack auch Deine Sachen und tue alles Geld, das wir noch haben, in meinen Beutel. Rüstung und Waffen müssen blinken, mein Wappenmantel muss sauber sein - morgen geht es zurück!“
Heinrich trat aus dem Zelt, richtete seine Schritte hinunter zum Hafen und betrat das Kloster, das direkt an der Hafenmauer lag. Ein Soldat mit Harnisch und Pike vertrat ihm den Weg. „Meldet mich beim Prälaten Odo von Châteuroux, ich bin Heinrich, Landgraf von Thüringen und muss ihn dringend sprechen.“ Der Soldat zog sich zurück und erschien wenige Minuten später mit einer Geste des Zulassens. Heinrich trat in den Klosterhof und wurde von einem weiteren Soldaten in das ehemalige Refektorium geleitet, das Odo von Châteuroux als Empfangsraum diente. Odo saß auf einem erhobenen Stuhl, vor sich ein Tisch mit Pergamenten, Wachstafeln, Tellern, Pokalen, Obstresten, Büchern… Es schien ein Chaos, das ihm aber offensichtlich wenig ausmachte. Heinrich verbeugte sich und trug dann sein Anliegen vor: „Ich bin Heinrich, Landgraf von Thüringen aus dem Hause Wettin. Ich habe den Kreuzeid geschworen und bin bis hierher mitgekommen. Nun hat mich die Nachricht ereilt, dass meine Stammlande in Aufruhr stehen und ich ihrer verlustig gehen werde, wenn ich nicht zurückkehre und selbst die Rebellion beende. Ich habe aber den Kreuzeid geschworen. Wie kann ich ohne Verlust der ewigen Seligkeit diesem Konflikt entkommen?“ „ Das ist einfacher gesagt als getan, mein Sohn! Du solltest sofort zurückkehren, um dein Erbe zu sichern, und da du den Eid geschworen hast, kehrst Du anschließend zurück, machst der Kirche eine Schenkung und unterstützt den Heiligen Vater bei der Eroberung des Heiligen Landes!“ „So einfach?“ „Ja, so einfach! Ich werde dir eine Urkunde ausstellen lassen, die dir die Heimreise ermöglicht – der Zeitpunkt deiner Rückkehr in den Kampf und damit ins Paradies steht dir dann frei!“ „Ich danke Euch – das macht mir eine Entscheidung möglich, die mir das Ewige Leben und den Erhalt der Landgrafschaft Thüringen möglich machen könnte.“ Odo winkte einem der Mönche, die im Refektorium arbeiteten „Setz‘ eine Eidbefreiung auf den Namen Heinrich von Thüringen auf, heutiges Datum, wenn sie fertig ist, leg‘ sie mir zum Siegeln vor!“ Der Mönch verbeugte sich und ging an seinen Platz zurück. Als Heinrich sich ebenfalls verbeugte und nochmals danken wollte, sagte Odo: „Lasst sie heute Abend abholen und sagt Jean de Beaumont nicht, wie einfach es das Kirchenrecht macht, einen solchen Eid kurzfristig zu unterbrechen! Wenn er davon erführe und den König allein auf dem Kreuzzug ließe, wären wir in drei Wochen Pleite!“ Heinrich musste lächeln und versprach, Jean nichts zu sagen, auch wenn das sein Verhältnis zu seinem Vetter auf Dauer trüben sollte.
Als er ins Lager zurückkehrte, war von Beaumont nichts zu sehen, aber Gernot hatte die meisten Güter des Landgrafen bereits auf einem Haufen gesammelt, das Kettenhemd blinkte, die Farben des Umhangs mit dem thüringischen Wappen strahlten und als er seinen Herren kommen sah, lief er ihm entgegen und bestätigte, dass für ihn und Gernot Platz an Bord der Sambuke unter venezianischem Kommando sei, die am Abend auslaufen würde. Das Pferd allerdings könnten sie nicht mitnehmen, dafür sei das Schiff zu klein und zu voll. Heinrich überlegte kurz und rief dann einen der Knappen Jean de Beaumonts: „Dein Herr weiß, dass ich Zypern vorläufig verlassen muss. Nimm mein Schlachtross, präge auf dem Sattel die Initialen des Herzogs von Lothringen ein und lass‘ es ihn bei nächster Gelegenheit reiten – es gefiel ihm schon immer und soll mein Abschiedsgeschenk an ihn sein; sag ihm, dass ich zurückkommen und wieder am Kreuzzug teilnehmen werde, solange das Pferd lebt!“
Gernot kümmerte sich um seine Besitztümer; Jean war ärgerlich, aber durch sein Präsent könnte er ihn vielleicht wieder freundlich stimmen, sie waren schließlich Gefährten seit ihrer Kindheit; sein Seelenheil war nicht in Gefahr – eines drängte sich ihm aber noch auf, was er noch tun musste.
Wieder schritt er wie gestern Abend den Hügel hinauf, bog halblinks in die kleine Gasse ein und klopfte an das Tor mit den schweren Türflügeln und der Inschrift „Λεμεσός“ darüber. Als der Riese die Tür einen Spalt breit öffnete, sah er vor sich einen Ritter mit Kettenhemd und wappengeschmücktem Umhang und direkt vor seinen Augen auf der Hand des Ritters eine Silbermünze. „Leila“, sagte der Ritter nur, und an der Stimme erkannte der Wächter den Besucher von gestern. Er ließ ihn eintreten, aber nicht weitergehen, sondern pfiff laut durch die Finger, was einen Diener herbeirief, und sprach in einer für Heinrich völlig unverständlichen Sprache zu ihm. Der Diener verschwand wortlos und kehrte wenige Minuten später zurück, verbeugte sich und machte Heinrich ein Zeichen, ihm zu folgen und führte ihn in das Zimmer, in dem er gestern Abend schon gewesen war. Das Zimmer war aufgeräumt, aber Leila war nicht da. Das helle Sonnenlicht, das durch Tür und Fenster strahlte und den Luxus des Zimmers noch verdeutlichte, verdunkelte sich kurz. Leila kam von der Dachterrasse herein, in einem leichten, seidenen, weißen Kleid, ungeschminkt und noch schöner als in seiner Erinnerung.
„Herr Landgraf,“ war ihre leicht ironische Begrüßung, „ ich hätte trotz allem nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen!“ Heinrich stutzte kurz, bis er die Ironie bemerkte und antwortete ernsthaft: „Ich hätte es selbst nicht geglaubt, aber ich musste kommen. Darf ich etwas bleiben?“ Wortlos wies sie auf die gepolsterten Stühle am Tisch. „ Ich muss zurück nach Deutschland. Ich habe Dir doch gestern erzählt, wie unsicher die Lage in meiner Herrschaft Thüringen noch ist – heute Morgen kam Nachricht, dass es schlimm steht. Deswegen muss ich zurück. Aber ich konnte nicht, ohne Dich noch einmal zu sehen!“ „Nur sehen?“ „Nein, nicht nur sehen, aber auch sehen!“ Sie stand auf, stellte sich hinter ihn, legte beide Hände auf seine Schultern und sagte: „Aber mit dieser Rüstung bist du nicht der, der gestern hier war, sondern mir fremd.“ Sie half ihm, das leichte Kettenhemd abzulegen und musste dann wieder leise lachen, denn er roch schon wieder wie ein Franze, nach Krieg und Ungutem. „In Wirklichkeit willst Du doch nur baden, oder?“ Sie lief ihm voraus ins Bad, klingelte mehrmals, weil natürlich keine Magd darauf vorbereitet war, jetzt ein heißes Bad zu richten, und als es endlich soweit war, kleidete sie ihn wieder aus und warf ihm den Schwamm zu. Sie selbst schlüpfte aus dem Kleid und kam dann zu ihm ins Wasser.
Im hellen Sonnenlicht war der unwirkliche Zauber der letzten Nacht verschwunden. Statt dessen sah Heinrich eine Frau vor sich, wie er sie sich in seinen Träumen nicht hätte vorstellen können und die jetzt doch neben ihm im warmen Wasser lag. Da sie, den Gebräuchen der Harems entsprechend, am ganzen Körper unbehaart war, wirkte sie im Licht noch nackter und verletzlicher als im Dämmerlicht des Abends – und noch anziehender. Sie seiften sich gegenseitig ein, und als der Schwamm sich dieses Mal um seinen Schaft wickelte, blieb er stehen und schaute Leila fasziniert zu, wie sie ihn befriedigte. Das Abtrocknen geschah langsam und mit Hingabe, galt es doch, jedes Fleckchen des anderen Körpers zu berühren. Getrocknet liefen sie zum Polsterbett. Als Leila sich wieder seiner Männlichkeit widmen wollte, schob er jedoch ihre Hände beiseite und begann, sie mit seinen Lippen zu liebkosen: er begann an ihrer Wange, glitt über die Halsbeuge, die Brüste, den ganzen Körper immer weiter hinab bis zu ihren Füßen, und als er den Weg zurück machte, hörte er voller Freude, wie sie leicht stöhnte und küsste sie mit ganzer Inbrunst, die sie sogleich erwiderte. Sie liebten sich fast ekstatisch und lagen dann unter einer leichten Decke aneinander gedrängt auf dem Polster und schauten in das helle Licht hinaus. „Leila, ich weiß, es klingt verrückt, aber glaube mir, ich komme wieder, und wenn ich dich dann noch hier finde, werde ich dich fragen, ob du vielleicht nur noch für mich da sein könntest – ist das sehr verrückt?“ „Nein, Henri,“ denn so hatte sie ihn gestern schon genannt, „wenn Du wiederkommst weiß ich, ob ich deine Frage bejahen kann. Jetzt halt mich noch einmal ganz fest, küss mich und geh – das Schiff wartet nicht auf dich!“