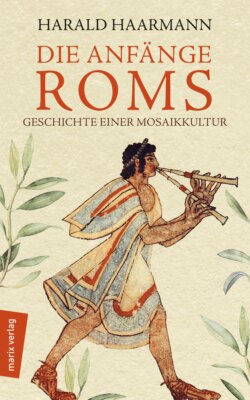Читать книгу Die Anfänge Roms - Harald Haarmann - Страница 11
Tyrsenoi/Tyrrhenoi – Rasenna – Tusci
ОглавлениеDie Etrusker nannten sich selbst Rasenna (bzw. in spätetrusk. Form Rasna). Nach Herodot (I.94) war Rasenna der legendäre Führer, der die Vorfahren der Etrusker aus Kleinasien nach Italien führte. Bei den Griechen hieß dieses Volk Tyrsenoi (bzw. Tyrrhenoi), und in ägyptischen Texten aus der Zeit des Pharao Ramses III. (20. Dynastie, 12. Jahrhundert v. Chr.) werden die Etrusker (Teresh genannt) unter den »Seevölkern« aufgeführt (Cultraro 2012).
Der Name, den die Römer ihren Nachbarn gaben (Tusci), lebt bis heute im Namen der Toscana weiter. Die griechische Namenform dagegen setzt sich fort in der Benennung für den Teil des Mittelmeeres im Nordwesten Italiens, das Tyrrhenische Meer. Mit Etrurien (lat. Etruria) wird das Kernland etruskischer Siedlung bezeichnet.
Tyrsenoi/Rasenna
Für die griechische Namenform sind die verschiedensten Deutungen vorgeschlagen worden (Briquel 2004, de Simone 2013). Die wahrscheinlichste dieser Deutungen ist wohl die, wonach sich die griechische Form Tyrsenoi aus zwei Grundkomponenten zusammensetzt. Die eine ist Tur-, das sich wohl von etrusk. tur, ›Gefolgsleute, Angehörige‹, herleitet. Die andere Komponente, -senoi, ist eine Verkürzung des Namens Rasenna (mit der griech. Pluralendung -oi).
Nach mythologischer Überlieferung waren die Tyrsener Verbündete Trojas im Krieg gegen die Mykener und gehörten damit zu den Verlierern des wohl berühmtesten Krieges der griechischen Antike. Vielleicht gab der verlorene Trojanische Krieg den Ausschlag, dass ein großer Teil der proto-etruskischen Elite – womöglich die gesamte Aristokratie – auswanderte. Der Seeweg nach Italien war seit Langem bekannt, denn die Mykener unterhielten in Süditalien zahlreiche Handelsniederlassungen. Obwohl die Mykener den Krieg gegen ihre Rivalen, die Trojaner, gewannen, konnten sie sich ihres Sieges nicht lange erfreuen. Denn schon im 12. Jahrhundert v. Chr. zerfiel ihre eigene Macht. Damit waren die Handelsrouten auch für die einstigen Feinde der Mykener, die Proto-Etrusker frei. Deren Landung in Mittelitalien vollzog sich ohne Behinderungen, denn es gab damals kein italisches Volk, das es mit einer politisch so gut organisierten Elite, wie es die Proto-Etrusker waren, hätte aufnehmen können.
Historiker und Archäologen tun sich bis heute schwer mit der Vorstellung von den Etruskern als Einwanderern (s. Shipley 2017: 28 ff. zu den Argumentationen für Bodenständigkeit einerseits und für Einwanderung andererseits). Es wird immer wieder dasselbe Argument angeführt, wenn es um die Ablehnung der Einwanderungsthese geht: Die Etrusker können nicht eingewandert sein, weil sich das typische Gepräge ihrer Kultur erst in Italien ausgebildet hat. Dies klingt logisch, und von der Einwanderung eines voll entwickelten Volkes der Etrusker kann deshalb auch keine Rede sein. Tatsächlich sind auch nicht die Etrusker eingewandert, wie wir sie aus Italien kennen, sondern deren Vorfahren, die Proto-Etrusker, in deren Kultur wahrscheinlich noch viel mehr ägäisches Erbgut lebendig war, als es sich im Profil der etruskischen Kultur der vorrömischen Ära identifizieren lässt. Die Frage nach der Einwanderung der Etrusker als des historischen Volkes, das uns in Italien entgegentritt, ist also abwegig, eben weil sie falsch gestellt ist. Damit erübrigt sich aber nicht die »richtige« Frage nach der Herkunft des unübersehbaren ägäischen Kulturerbes. Woher kamen die Vorfahren der Etrusker, die Proto-Etrusker? In dieser Form gestellt, wird die Frage wiederum den Realitäten ethnischer Transformationsprozesse gerecht, mit denen wir es hier zu tun haben.
Bei den Einwanderern, die im Verlauf des 11. und 10. Jahrhunderts v. Chr. nach Italien gelangen, handelte es sich um »eine zahlenmäßig wahrscheinlich gar nicht starke Gruppe von ›Tyrrhenern‹, die aus dem kleinasiatisch-ägäischen Bereich kommen« (Pfiffig 1989: 8). In den vergangenen Jahren hat die archäologische und sprachhistorische Forschung Erkenntnisse geliefert, die für die Migrationsthese sprechen, und die Annahmen von der Urheimat der Proto-Etrusker im ägäischen Raum stützen.
In einer Gesamtschau von Charakteristika der etruskischen Zivilisation wird eine Reihe von Parallelen mit altägäischen Kulturen hervorgehoben (Haarmann 1995: 154 ff.):
–Die prominente Rolle der Frau in der etruskischen Öffentlichkeit;
–Die Vorliebe für bestimmte Hutformen (konisch, mit Dekor geschmückt, mit Spitze) in der weiblichen Mode;
–Verbreitung der Doppelflöte als Musikinstrument (bekannt von kykladischen Statuetten, minoischen Fresken und etruskischen Wandmalereien);
–Die Rituale in Verbindung mit der Ahnenverehrung;
–Der Typ der sogenannten »Hüttenurne«, der in den Kulturen der ägäischen Bronzezeit und in Etrurien verbreitet war;
–Geflügelte Greifen in der figuralen Kunst;
–Der spezielle Typ der Grabstele für Krieger (Lemnos und Etrurien);
–Die Rolle religiöser Prozessionen;
–Die Rolle von Masken und ihre Verwendung in Ritualen;
–Die Sitte, Votivgaben in Heiligtümern zu deponieren, die Körperteile wiedergeben;
–Die Sitte, Skulpturen von Kindern als Votivgaben zu deponieren;
–Die religiöse Bedeutung von Tieren (Stier, Schlange);
–Die graphischen Parallelen ägäischer und etruskischer Zahlensysteme;
–Die Sitte, anthropomorphe und zoomorphe Votivgaben zu beschriften;
–Die Sitte, Spiraltexte zu verfassen.
Lemnische Kultur und Sprache, und frühe Schriftzeugnisse
Seit Ende des 19. Jahrhunderts v. Chr. sind in der Forschung die Beziehungen zwischen der etruskischen Kultur Italiens mit der der vorgriechischen Bevölkerung auf der Insel Lemnos in der nördlichen Ägäis bekannt. Früher wurde angenommen, dass vielleicht etruskische Piraten auf der Insel Station gemacht hätten. Heutzutage sieht man die Dinge jedoch anders. Aufgrund neuerer Erkenntnisse wird die materielle Hinterlassenschaft (z. B. Keramik) auf Lemnos mit einer proto-etruskischen Kulturstufe assoziiert (Cultraro 2012: 106 f.).
Auch die Sprache, das Lemnische, ist durch eine Grabstele bekannt, die im Jahre 1885 auf der Insel in der nördlichen Ägäis gefunden wurde. Diese Stele, auf der ein Krieger abgebildet ist, und die eine längere Inschrift mit insgesamt 33 Wörtern trägt, stammt aus dem späten 7. oder frühen 6. Jahrhundert v. Chr. (Abb. 3).
Die Schrift, in der die Grabinschrift wie auch Beschriftungen auf der Wandung lemnischer Keramikgefäße abgefasst wurden, zeigt deutliche Ähnlichkeit mit der ältesten Version des etruskischen Alphabets in Italien. Inzwischen ist auch nachgewiesen, dass das auf der Insel verwendete etruskische Alphabet altertümliche ägäische Eigenheiten aufweist (Agostiniani 2012). Es kann sich also bei dem Kriegergrab nicht um eine späte Bestattung eines etruskischen Seeräubers handeln, der aus Italien bis nach Lemnos gesegelt wäre.
Abb. 3: Grabstele von Lemnos (Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr.; Facchetti 2000a: 27)
Die Sprache der Etrusker ist nicht-indoeuropäisch (Facchetti 2000a, 2008) und sie gehört zum Kreis der altmediterranen Sprachen (Kausen 2013: 196 ff.). Lemnos mit seinem ägäisch-anatolischen Kulturgepräge liegt nicht weit von der Westküste der heutigen Türkei, und es bleibt die Frage, ob die Insel die einzige Region war, wo Proto-Etrusker lebten, oder ob sich deren Verbreitungsgebiet in der Bronzezeit auch auf den Nordwesten Anatoliens ausdehnte. Das Gebiet südlich des Marmarameeres – den antiken Regionen Hellespont und Bithynien entsprechend, die an Lydien angrenzen – ist von Robert Beekes (2003: 6) als proto-etruskische Urheimat identifiziert worden.
Eine weitere Stütze für die Anatolien-These findet man in Erkenntnissen der Humangenetik. Moderne Untersuchungen zur mitochondrialen DNA der Bevölkerung in der Toskana (wo sich das Genom der etruskischen Bevölkerung nachweisen lässt) haben ergeben, dass deren Merkmale auf Anatolien als Ausgangsgebiet weisen (Achilli et al. 2007, Brisighelli et al. 2009). Die geographische Nähe der Urheimat zu Troja stützt die Annahme, dass die Proto-Etrusker in spätmykenischer Zeit Verbündete dieses Stadtstaates waren.
Sprachlich lässt sich das Lemnische zweifelsfrei mit dem Etruskischen assoziieren. In der lemnischen Grabstele findet sich die Formel avis sialchvis, ›(im Alter) von 40 Jahren‹, die sprachlich der etruskischen Formel avils machs sealchls, ›(im Alter) von 45 Jahren‹, entspricht. In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. wurde Lemnos von den Athenern erobert, und die lemnische Bevölkerung assimilierte sich allmählich ans Griechische.
Kultur- und Sprachkontakte im ägäischen Raum: Pelasgisch-griechisch-etruskische Beziehungen
Das Etruskische hat dem Lateinischen zahlreiche Ausdrücke vermittelt, die in die Fachterminologie des Schiffsbaus und der Schifffahrt integriert sind. Dazu gehören auch einige Wörter, die das Etruskische selbst als Entlehnungen aus dem Griechischen aufgenommen hat (z. B. lat. anchora, ›Anker‹; aplustra, ›Schiffsknauf‹; guberno, ›steuern‹ ← etrusk. ← griech.). Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Etrusker im Kontakt mit den Griechen der Magna Graecia diese Ausdrücke von griechischen Seefahrern übernommen hätten. Das kann aber nicht sein, u. zw. aus chronologischen Gründen.
Als die Etrusker anfingen, mit den Griechen Süditaliens Handel zu treiben, waren sie selbst bereits erfahrene Seefahrer: »Neuere Erkenntnisse zur Seefahrt der Etrusker zeigen technisch hochqualifizierte und weitgereiste Leute, die die Gewässer jenseits von Italien bereits vor dem 8. Jahrhundert v. Chr. befahren haben« (Turfa 2007: 165). Die etruskischen Seefahrer beherrschten also bereits das Know-how des Schiffsbaus, bevor die ersten griechischen Kolonisten nach Süditalien gelangten. Insofern war es gar nicht erforderlich, technische Ausdrücke für den Schiffsbau von den Griechen zu übernehmen.
Wie aber kann der Transfer technischer Terminologie aus dem Griechischen ins Etruskische erklärt werden? Dieser Transfer fand sicherlich viel früher statt, zu einer Zeit, als die Vorfahren der Etrusker Italiens, die Proto-Etrusker, in der ägäischen Region als Nachbarn der mykenischen Griechen lebten. Im Kontakt mit diesen lernten die Etrusker, wie man Schiffe baut, und damals machten die Etrusker ihre ersten Erfahrungen mit der Seefahrt im Ägäischen Meer. Ihre Lehrmeister, die Mykener, hatten selbst das Einmaleins der Seefahrt von ihren Vorgängern gelernt.
Als die Vorfahren der Griechen im 3. Jahrtausend v. Chr. vom Nordwesten des Schwarzen Meeres nach Süden migrierten, wussten sie noch nichts von der Seefahrt. Das lernten sie erst vor Ort in ihrer neuen Heimat, Hellas, u. zw. von den Nachkommen der seeerfahrenen Alteuropäer, den Pelasgern. Im kulturellen Gedächtnis der Pelasger war das Know-how des Schiffsbaus tradiert worden, und dieses Know-how gaben die pelasgischen Schiffsbauer an die Griechen weiter. Zusammen mit den technischen Fertigkeiten wurden auch spezielle Ausdrücke der Fachterminologie in den altgriechischen Wortschatz integriert.
Der Transfer dieser griechisch anmutenden, aber ihrer Herkunft nach pelasgischen Ausdrücke in das etruskische Vokabular findet im Kontext der Kontakte zwischen Griechen und Etruskern im Norden der Ägäis eine schlüssige Erklärung. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass die Etrusker die betreffende Terminologie direkt von den Pelasgern adaptiert haben, d. h. ohne Vermittlung durch das Griechische. Es kommt auch noch die Verbindung zu den Minoern Altkretas in Betracht, die ebenfalls erfahrene Seeleute waren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Etruskische und das Minoische verwandte Sprachen waren (s. dazu Facchetti 2002a: 111 ff.). In jedem Fall bot das multikulturelle Milieu in der Inselwelt der Ägäis und in der balkanisch-anatolischen Kontaktregion ausreichend Gelegenheit für die Verbreitung von Kenntnissen im Bereich Schiffsbau und maritimen Handelskontakten bei den verschiedenen ethnischen Gruppen.
Von den drei im Kontakt stehenden Populationen, den Etruskern, Griechen und Pelasgern sind die letzteren immer noch weitgehend mit dem Schleier des Mysteriösen verdeckt. Das hängt wohl in erster Linie damit zusammen, dass erst in den letzten Jahren in der Forschung Klarheit über die ethnische Zuordnung der Pelasger und über die genealogische Affiliation ihrer Sprache erreicht worden ist, denn bis dahin war man als moderner Beobachter von den Beschreibungen der Pelasger bei antiken Autoren abhängig. Um sich die Rolle der Pelasger für die Vermittlung vorgriechischen Kulturguts an die Griechen zu vergegenwärtigen, ist ein kurzer Exkurs sinnvoll.
Die Regionalkultur der Pelasger in Südosteuropa
Die bronzezeitliche Kultur der Pelasger muss als zentrale Vermittlerinstanz für alteuropäisches Sprach- und Kulturgut an die Griechen verstanden werden. In Hellas vollzog sich ein Prozess, wie er sich in ähnlicher Form in späteren Perioden wiederholt hat: die Kultur derjenigen, die beherrscht wurden, beeinflusste die Kultur der Herrschenden nachhaltig. In der Balkanregion waren es später die Römer, die politisch den Ton angaben, während sich andererseits ihre Kultur und Sprache vollsogen mit adaptierten griechischen Elementen.
Die Periode zwischen dem 3. Jahrtausend und dem 1. Jahrtausend v. Chr. ist von der bronzezeitlichen Kultur der Pelasger geprägt. Eine Kontinuität pelasgischer Siedlungen im südlichen Griechenland ist bis in die archaische Ära (8.–6. Jahrhundert v. Chr.) dokumentiert. In der älteren Forschung ging man davon aus, dass die Pelasger ein altes indoeuropäisches Volk auf dem Balkan gewesen wären. Allerdings sind alle Ansätze zu einer Rekonstruktion des Pelasgischen als indoeuropäisch fruchtlos geblieben. Basierend auf den Forschungen von Furnée (1972), Beekes (2004, 2010) und Haarmann (2014) ist inzwischen geklärt, dass das Pelasgische eine nicht-indoeuropäische (bzw. vor-indoeuropäische) Sprache war.
Die Griechen der archaischen Zeit waren sich sehr wohl bewusst – selbst wenn sie nicht über ein Wissen gestützt auf Daten archäologischer Forschung verfügten –, dass vor ihnen ein anderes Volk (die Pelasger) in Griechenland gelebt hatte, und dass sie mit der älteren Bevölkerung in langzeitigem Kontakt gestanden hatten. Herodot berichtet darüber, dass die Pelasger sich später assimiliert hätten. In seinem Werk Historien thematisiert Herodot den Sprachwechsel der Pelasger in folgender Weise: »Wenn also alle Pelasger in dieser Weise sprachen [d. h. ihre eigene Sprache sprachen], dann muss das Volk von Attika [Attikon ethnos], da sie Pelasger waren, ebenfalls ihre Sprache gewechselt haben zu einer Zeit, als sie Teil der Hellenen wurden« (Historien 1.57.3).
Die Griechen wie auch die Etrusker profitierten vom Know-how der Pelasger, und die Einflussschneisen zeichnen sich im Wortschatz ab. Als die Vorfahren der Etrusker aus der Ägäis nach Westen fuhren, stand ihr seemännisches Können auf dem gleichen Niveau wie das der Griechen. Und im Wortschatz beider Sprachen haben sich Spuren aus der Sprache der pelasgischen Lehrmeister erhalten. Die Etrusker haben ihre pelasgisch geprägte Terminologie mit nach Italien gebracht, wo sie ihrerseits die Römer beeindruckten und ihre Sprache beeinflussten. Die Pelasger haben auch das Know-how der Goldschmiedekunst an die Griechen und Etrusker weitergegeben, was sich ebenfalls in der Fachterminologie niedergeschlagen hat (z. B. obrussa, ›Feuerprobe des Goldes; Prüfstein‹).
Etruskische Lehnwörter des Lateinischen, mit Parallelen im Griechischen und Pelasgischen:
anc(h)ora, ›Anker‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. ankyra (B 174)
aplustra, ›Schiffsknauf‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. aphlaston (B 175)
curritae, ›Seherinnen der Göttin‹; vielleicht über etrusk. Vermittlung in Beziehung zu griech. Korybantes, ›Priesterinnen der Kybele auf Samothrace‹ (B 107)
guberno, ›führe das Steuerruder, steuere‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. kybernao (B 209)
marmor, ›Marmor‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. marmaros (B 215)
obrussa, ›Feuerprobe des Goldes; Prüfstein‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. obryzon (B 219)
paelex, ›Konkubine‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. pallake (B 220)
Der Begriff der Konkubine war in der griechischen Gesellschaft der Antike nicht stigmatisiert. Jeder freie griechische Mann hatte das Recht, außer einer Ehefrau (Hauptfrau) eine Nebenfrau zu haben. Die Kinder eines freien Mannes mit seiner Konkubine wurden ebenso behandelt wie die Kinder mit der Ehefrau. In beiden Fällen hatten die Nachkommen das Anrecht auf das athenische Bürgerrecht und waren somit vor dem Gesetz gleich.
Das soziale Normbewusstsein in der griechischen Gesellschaft ist aus der Rede eines Athener Orators (Demosthenes 59.122) aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. bekannt, deren Text überliefert ist. Daraus geht folgendes hervor: »Athener Männer können drei Frauen haben: eine Ehefrau (damar) ›zur Zeugung legitimer Kinder‹; eine Konkubine (pallake) ›zur Pflege des Körpers‹, was bedeutet, mit ihr regelmäßige sexuelle Beziehungen zu haben, und eine ›Gespielin‹ (hetaira) ›für die Unterhaltung‹« (Cantarella 2005: 250).
Das Griechische hat noch einen anderen Ausdruck für soziale Beziehungen als Entlehnung übernommen. Dies ist opuio, ›heiraten, zur Frau nehmen‹, und als dessen Quelle wird von vielen Sprachwissenschaftlern das Etruskische (puia, ›Ehefrau‹) identifiziert, erstmals geäußert von Hammarström (1920). Neuerlich wird auch das Pelasgische als mögliche Quelle von opuio in Betracht gezogen (Beekes 2010: 1094). Auch diese Entlehnung – ob vom Etruskischen ins Griechische oder vom Pelasgischen ins Griechische – gehört zum Kreis der altmediterranen Elemente.
spelunca, ›Höhle, Grotte‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. spelynx (B 225)
sporta, ›geflochtener Korb‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. spyris (B 159)
tapete, ›Teppich, Decke‹; über etrusk. Vermittlung aus griech. tapes (B 230)
Und in einem weiteren Bereich spiegeln sich die Kontakte der Proto-Etrusker mit den Kulturen im ägäischen Raum. Dies ist die Tradition der etruskischen Zahlenschreibung. Die Vorfahren der Griechen, die aus dem Gebiet im Nordwesten des Schwarzen Meeres in den Süden wanderten, kamen in ihrer neuen Heimat Hellas in Kontakt mit der Schriftlichkeit der Minoer Altkretas, deren kultureller Einfluss auf das Festland ausstrahlte. Die mykenischen Griechen adaptierten das minoische Schriftsystem Linear A zur Schreibung ihrer eigenen Sprache (Linear B). Was sie ebenfalls von den Minoern übernahmen, war die Zahlenschreibung. Die Zeichen, mit denen Zahlenwerte bei den Mykenern bezeichnet wurden, zeigen deutliche Parallelen zur alteuropäischen Zahlennotation, und Ähnlichkeiten sind ebenfalls im System der etruskischen Zahlzeichen zu erkennen (Abb. 4).
Die Entstehung der etruskischen Zahlennotation findet ihre Motivation im Milieu der ägäischen Sprachkontakte. Das damals entstandene System wurde von den etruskischen Migranten nach Italien transferiert, und dort wurde es in einer neuen kulturellen Umgebung kontextualisiert (Haarmann 2008: 104 f.; s. Kap. 12).
Tusci
Im Etruskischen gab es zwei Formen für die Selbstbenennung der Etrusker, die sich durch ihren Anlaut voneinander unterschieden. Die eine Form war Kursike, die andere Tursike. Die letztere Form zeigt deutlich die Anlehnung an die griechische Namenform für die Etrusker: Tyrrhenos, aber mit der Angleichung der Anfangssilbe an etrusk. tur (›Sippe, Gefolgschaft‹). Kursike ist eine Nebenform von Tursike. Aus dieser Form entwickelte sich tursko und vereinfacht tusco, und dies ist die Basis für den Namen der Etrusker bei den Römern: Tuscus (sing.) – Tusci (pl.); (de Simone 2015b: 230 ff.). Auch zur Form Tusci gab es eine Variante: Etruscus/Etuscus. Davon leitet sich der Name für das Kernland der etruskischen Siedlung ab: Etruria.
Abb. 4: Etruskische Zahlzeichen (dokumentiert auf der Basis von Inschriften; Ifrah 1987: 168, 182)
Der Transformationsprozess vom Stadium der Villanova-Kultur zur etruskischen Kultur
Die proto-etruskischen Einwanderer waren nicht zahlreich, wohl aber gut organisiert, sodass es ihnen gelang, die kulturelle und politische Entwicklung in ihrer neuen Heimat – inmitten der italischen Völkerschaften – zu bestimmen. Die Integration der proto-etruskischen Eliten zeitigte unterschiedliche Ergebnisse im regionalen interethnischen Kontakt (Malnati/Manfredi 1991):
a)In Lukanien ist eine vollständige Assimilation der Proto-Etrusker an die lokalen italischen Kulturtraditionen zu beobachten;
b)In Etrurien kommt es zu einer gleichgewichtigen Fusion, als deren Endergebnis ein echtes kulturelles Amalgam mit sowohl italischen als auch proto-etruskischen Elementen entsteht;
c)In den von Villanova-Leuten dominierten Siedlungen des Nordens (Tal des Po, Adriaküste) bewahrt die Regionalkultur proto-etruskische Eigenheiten bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. (Abb. 5).
In Italien entwickelt die Kultur der Proto-Etrusker das Profil, das wir aus den Quellen und Monumenten der vorrömischen Zeit kennen. In der archäologischen Hinterlassenschaft Etruriens sind im ausgehenden 9. und beginnenden 8. Jahrhundert v. Chr. revolutionäre Veränderungen festzustellen. Ältere Dorfgemeinschaften werden zusammengeschlossen, und aus ihnen entwickeln sich die ersten städtischen Zentren der Villanova-Kultur. In der Forschung sind die Ansichten über den Charakter der Villanova-Kultur geteilt. Die einen halten sie für einen Import von Außen, die anderen sehen darin eine Mischung aus einheimisch-italischen und importierten Elementen. Diese Kultur zeigt bereits die typischen Amalgamierungsprozesse, nämlich die symbiotische Verflechtung einheimischer Eigenheiten mit Elementen, die die Einwanderer mitgebracht hatten. Denn von Anbeginn treten externe Zusatzkomponenten, u. zw. ägäische sowie auch nahöstliche Merkmale in der Villanova-Kultur in Erscheinung.
Abb. 5: Die Einflusssphäre der Etrusker in Norditalien (Macellari 2014: 17)
Es besteht Einigkeit in der Hinsicht, dass die Villanova-Kultur sich ohne auswärtige Impulse nicht mit der Rasanz entfaltet hätte, die die archäologische Hinterlassenschaft ausweist. Die Träger der Villanova-Kultur waren noch nicht die Etrusker der klassischen Zeit. Da das etruskische Kulturerbe aber auf dem Fundament der Villanova-Kultur aufbaut, ist es berechtigt, die Leute von Villanova als Proto-Etrusker zu identifizieren.
Die Etrusker als das historische Volk sind aus einem ethnischkulturellen Transformationsprozess entstanden, an dessen Anfang die proto-etruskische bzw. Villanova-Kultur stand, und aus deren kontinuierlicher Weiterentwicklung die etruskische Zivilisation aufblühte. Der Wandel vom Volkstum der Proto-Etrusker zu dem der Etrusker ähnelt in mancher Hinsicht der ethnisch-kulturellen Transformation, die Jahrtausende früher in Mesopotamien stattfand, als sich die Identität der Sumerer aus der Ethnizität der Ubaid-Leute entwickelte (Maisels 1999: 147 ff.).
Das kulturelle Erbe von Villanova wandelt sich im Horizont der Zeit zum Eigenprofil der etruskischen Zivilisation, und in deren Eigenarten fallen von Anbeginn die Beziehungen zum östlichen Mittelmeerraum, zur Ägäis und zum Nahen Osten, auf. In diesem Komplex von kulturellen Parallelen ist deutlich zwischen zwei Traditionen zu unterscheiden: (i) das altägäische Kulturerbe, das die etruskische Zivilisation über ihre proto-etruskischen Frühstadien mit den vorgriechischen Zivilisationen des ägäischen Inselarchipels verbindet (Haarmann 1995: 150 ff.); (ii) ein nahöstlicher Modetrend, der im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. die Vorlieben der etruskischen Aristokratie bestimmte. Dieser zeitlich begrenzte Trend wird die »orientalisierende Periode« (ital. orientalizzante) genannt (Cristofani 1985: 199 ff.).
Die älteren ägäischen Eigenheiten gehen seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. eine enge Verbindung mit den orientalisierenden Elementen ein, sodass sie in ihrer Verwobenheit dem Betrachter wie ein symbiotisches Beziehungsnetz anmuten. Lediglich in der wissenschaftlichen Analyse können die ägäischen von den orientalisierenden Eigenheiten unterschieden werden.