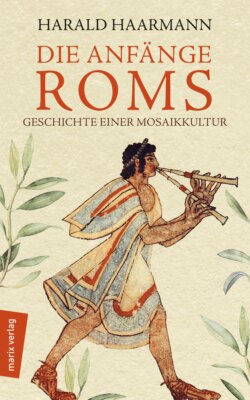Читать книгу Die Anfänge Roms - Harald Haarmann - Страница 12
Die griechischen Siedlungen der Magna Graecia
ОглавлениеIm Verlauf des 16. Jahrhunderts v. Chr. erkundeten mykenische Griechen die Seerouten in Richtung Westen, und seit dem 15. Jahrhundert v. Chr. gab es ständige Kontakte mit Süditalien. Die Mykener richteten zahlreiche Handelsstützpunkte ein. Die meisten lagen an den Küsten des Ionischen Meers und der Adria. Auf Sizilien waren die Stützpunkte im Südosten der Insel konzentriert (Abb. 6).
Die Handelsplätze von damals sind von Archäologen anhand einer Leitform identifiziert worden: mykenische Keramik. Solche Gefäße sind bis in die Region von Neapel gefunden worden. Die wirtschaftlichen Interessen der Mykener an Süditalien waren in der Hauptsache motiviert durch den Handel mit Metall, mit Kupfer und Eisen. Die Lipari-Inseln (nördlich von Sizilien) waren wegen der dortigen Kupfervorkommen von Interesse. Eisen kam aus dem Norden, von den Inseln Elba und Korsika. In mykenischer Zeit gab es dort keinen festen Stützpunkt und eine griechische Kolonie wurde auf Korsika erst im 6. Jahrhundert v. Chr. von den Phokäern eingerichtet (Alasia). Der Handelsstützpunkt bei Castiglione auf der Insel Ischia in der Bucht von Neapel diente als Umschlagplatz für Metalllieferungen aus dem Norden.
Mit dem Niedergang der mykenischen Macht im östlichen Mittelmeer erlahmte auch der Fernhandel mit dem Westen. Die Seeroute geriet aber nicht in Vergessenheit, denn auf dem früher von mykenischen Handelsschiffen frequentierten Seeweg gelangten die Proto-Etrusker (Tyrsener bzw. Tyrrhener) aus dem Norden der Ägäis an die Küste des Tyrrhenischen Meers.
1, Middle Helladic – Late Helladic II; 2, Late Helladic IIIA1 – IIIB1–2; 3, Late Helladic IIIC1–2; see Table 1.
Apulia. 1: Manaccora (3). 2: Molinella (1). 3: Coppa Nevigata (3). 4: Trani (2, 3). 5: Bari (3). 6: Giovinazzoo (1). 7: Torre S. Sabina (2). 8: Punta Le Terrare (1, 2). 9: Otranto (2, 3). 10: Leuca (2, 3). 11: Porto Cesareo (2, 3). 12: Avetrana (3). 13: S. Cosimo d’Oria (2). 14: Torre Castelluccia (2, 3). 15: Porto Perone (1, 2, 3). 16: Satyrion (2, 3). 17: Scoglio del Tonno, Taranto (2, 3).
Basilicata 18: San Vito di Pisticci (3). 19: Termitito (2, 3). 40: Toppo Daguzzo (3).
Calabria. 20: Broglio di Trebisacce (2, 3). 21: Torre del Mordillo (3). 36: Praia a Mare (2).
Sicily. 22: Molinello (2). 23: Thapsos (2). 24: Matrensa (2). 25: Cozzo del Pantano (2). 26: Serra Orlando (2, 3). 27: Pantalica (3). 28: Floridia (2). 29: Buscemi (2). 30: Milena (2, 3). 31: Agrigento (2).
Aeolian Islands. 32: Lipari (1, 2, 3). 33: Panarea (2). 34: Salina (1, 2). 35: Filicudi (1, 2).
Campania. (36: see Calabria). 37: Polla (3). 38: Paestum (3). 39: Eboli (3). (40: see Basilicata). 41: Vivara (1, 2). 42: Castiglione d’Ischia (2).
Abb. 6: Orte mit Funden mykenischer Keramik in Süditalien (Ridgway 1992: 4)
Abb. 7: Die griechischen Siedlungen in Süditalien (Malkin 2011: 98)
Einige Jahrhunderte später wurden die Kontakte zwischen dem griechischen Festland und Süditalien wiederbelebt. Die Motivation für die Wiedereröffnung des Seewegs nach Westen war allerdings deutlich verschieden von der während der mykenischen Periode. Damals ging es darum, Waren auszutauschen und solche aus Italien nach Griechenland zu transportieren. Die Migration der Griechen nach Westen hingegen, die im 8. Jahrhundert v. Chr. einsetzte, war eine eigentliche Kolonisationsbewegung, eine Auswanderung im großen Stil. Griechen aus dem Kernland wanderten aus mit dem Ziel, entfernt von ihrer Heimat neue Siedlungen zu gründen und dort zu leben.
Die zwischen dem 8. und 5. Jahrhundert v. Chr. in Süditalien gegründeten Kolonien waren weniger zahlreich als die mykenischen Handelsstützpunkte, und sie waren auch in unterschiedlichen Regionen lokalisiert. Es gibt nur wenige Kolonien, die am Ort eines früheren mykenischen Handelsstützpunkts gegründet wurden. Dies gilt für Pithekoussai auf Ischia, für Taras (heute Tarento) in Apulien und für Akragas (heute Agrigento) in Westsizilien.
Im Unterschied zur mykenischen Ära, als es mehr als ein halbes Dutzend Stützpunkte an der Adriaküste gab, wurde dort keine einzige Kolonie angelegt, und auch die Liparischen Inseln blieben von der Kolonisierung ausgeschlossen. Auf Sizilien dehnten sich die Kolonien über die ganze Insel aus, wenn auch die größte Konzentration – wie zu mykenischer Zeit – im Südosten zu beobachten ist.
Koloniegründungen in der Magna Graecia (Osborne 1996: 121 ff., Malkin 2011: 97 ff., Mele 2014)
Im 8. Jahrhundert v. Chr. gegründete Kolonien:
Pithekoussai (Zeit der Gründung: früher als 750 v. Chr.; Mutterstadt: Eretria/Chalkis)
Naxos (750–725 v. Chr.; Chalkis)
Syrakus (750–725 v. Chr.; Korinth; vorgriech. Besiedlung)
Katana (750–700 v. Chr.; Chalkis)
Leontinoi (750–725 v. Chr.; Chalkis)
Kyme (Cumae) (725–700 v. Chr.; Chalkis)
Zankle (750–725 v. Chr.; Kyme/Chalkis)
Rhegion (ca. 720 v. Chr.; Chalkis/Zankle)
Megara Hyblaia (750–725 v. Chr.; Megara)
Sybaris (ca. 720 v. Chr.; Achaia)
Mylai (725–700 v. Chr.; Zankle)
Metapontion (725–700 v. Chr.; Achaia)
Kamarina (725–700 v. Chr.; Syrakus)
Im 7. Jahrhundert v. Chr. gegründete Kolonien:
Kroton (7. Jh. v. Chr.; Achaia)
Taras (ca. 700 v. Chr.; Sparta)
Heloros (ca. 700 v. Chr.; Syrakus)
Kaulonia (ca. 700 v. Chr.; Kroton)
Gela (ca. 700 v. Chr.; Kreta/Rhodos)
Siris (ca. 700 v. Chr.; Kolophon)
Metauros (700–650 v. Chr.; Zankle)
Lokroi Epizephyrioi (ca. 700 v. Chr.; Lokroi)
Akrai (675–650 v. Chr.; Syrakus)
Selinous (ca. 650 v. Chr.; Megara Hyblaia)
Himera (ca. 625 v. Chr.; Zankle/Mylai)
Kasmenai (ca. 600 v. Chr.; Syrakus)
Hipponion (ca. 620 v. Chr.; Lokroi Epizephyrioi)
Im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründete Kolonien:
Medma (ca. 600 v. Chr.; Lokroi)
Poseidonia (Paestum) (ca. 600 v. Chr.; Achaia)
Akragas (ca. 580 v. Chr.; Gela)
Herakleia Minoa (ca. 550 v. Chr.; Selinous)
Im 5. Jahrhundert v. Chr. gegründete Kolonien:
Neapolis (ca. 470 v. Chr.; Cumae)
Herakleia in der Nähe der Ruinenstätte von Siris (425–400 v. Chr.; Taras)
Im 4. Jahrhundert v. Chr. gegründete Kolonien:
Issa (ca. 390 v. Chr.; Syrakus)
Tauromenion (358 v. Chr.; Zankle)
Eryx und Segesta im Nordwesten Siziliens, Stadtgründungen der einheimischen Elymer, wurden seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. hellenisiert und standen zeitweilig unter karthagischer Kontrolle
Die Kolonisation Süditaliens war eine systematische und organisierte Bewegung, und sie ging von städtischen Zentren (poleis) in Griechenland, von Mutterstädten aus. Die Mutterstädte stellten Transportfahrzeuge, Ausrüstung und Proviant zur Verfügung, und die Kolonisten bauten in der Folge ein Netzwerk von Handelsbeziehungen mit den Mutterstädten aus Richtung der neuen Siedlungsgebiete auf. Eine neu gegründete Kolonie war in architektonischer wie administrativer Hinsicht zunächst ein Miniaturmodell der jeweiligen Mutterstadt, mit Häusern, Tempeln und Wirtschaftsgebäuden. Viele Kolonien wuchsen ständig an und übertrafen irgendwann nach ihrer Einwohnerzahl die Mutterstädte. Innerhalb weniger Jahrhunderte waren die Griechen in den Kolonien Süditaliens zahlreicher als im Kernland Hellas. Seit der klassischen Ära im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. wurde das Siedlungsgebiet der westlichen Griechen Megale Hellas (›Großgriechenland‹) genannt, bekannter unter dem Namen, den ihm die Römer gaben: Magna Graecia.
Die engen Beziehungen zwischen der Heimat und der Kolonie kommen sprachlich zum Ausdruck. Griech. oikos ist die Bezeichnung für die Heimstätte, und der Ausdruck für ›Kolonie‹, apoikia (apo-, ›von, weg‹ + oikos), ist mit dem Begriff der Heimstätte direkt assoziiert (Haarmann 2013: 49). In der Tat bedeutete die Gründung einer Kolonie keine absolute Trennung vom Kernland. Die Beziehungen zwischen Kolonie und Mutterstadt wurden alljährlich in einem besonderen Festakt ritualisiert. Einmal im Jahr unternahmen Honoratioren der Kolonie eine Fahrt mit dem Schiff zur Mutterstadt, um die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bindungen zu bekräftigen.
Die griechischen Kolonisten, die nach Süditalien einwanderten, trafen dort auf die Einheimischen, von denen die meisten Angehörige italischer Populationen waren und eine der italischen Sprachen sprachen. Einheimische wohnten auch an solchen Orten, wo Griechen für sich neue Heimstätten aufbauten. In Pithekoussai, Metapontion, Naxos, Syrakus, Katana, Leontinoi, Kyme, Taras, Gela und Akragas sind Reste vorgriechischer Siedlungen gefunden worden. Die Einheimischen wurden von den Neusiedlern nicht vertrieben. Die Alteingesessenen wurden in die griechischen Gemeinschaften integriert, in deren Milieu sie sich akkulturierten und sprachlich assimilierten. Die Hellenisierung der Einheimischen zog sich in Sizilien über mehrere Generationen hin. Am längsten konnten die Elymer im Nordwesten ihre kulturelle und sprachliche Eigenständigkeit bewahren.
Jede Kolonie stellte politisch eine unabhängige Einheit dar, und im Hinblick auf die Verwaltung und administrative Institutionen war die Kolonie ein Modellfall der jeweiligen Mutterstadt. Mittelpunkt einer jeden Stadtgemeinde war das Prytaneum, wo das ewige Feuer zu Ehren der Hestia, Göttin des heimischen Herdfeuers und Schutzpatronin der Heimstatt, brannte. Diejenigen, die ausfuhren, um eine Kolonie zu gründen, führten auf ihrem Schiff ein Kohlebecken mit sich, in dem Feuer vom Hestia-Tempel der Mutterstadt brannte. Das ewige Feuer wurde in das neu erbaute Prytaneum der Kolonie transferiert, wo es als Symbol pan-griechischer Identität bei den Einwohnern das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit mit der Mutterstadt wachhielt.