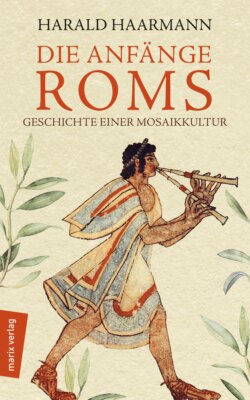Читать книгу Die Anfänge Roms - Harald Haarmann - Страница 9
Nicht-indoeuropäische Völker und Sprachen in den Randgebieten
ОглавлениеDie nicht-indoeuropäischen Regionalkulturen, deren Angehörige sich während der Antike an römische Lebensweise akkulturierten und sich sprachlich ans Lateinische assimilierten, waren sämtlich an den Peripherien Italiens verbreitet. Dies waren Restkulturen der einst weit verbreiteten altmediterranen Populationen, die von den bevölkerungsstarken italischen Gruppen marginalisiert worden waren.
Die Regionalkultur der Camuner
In den norditalienischen Alpen datieren die frühesten Spuren menschlicher Präsenz ins 7. Jahrtausend v. Chr. Dabei handelt es sich um Felsbilder aus der Tallandschaft von Valcamonica (Provinz Brescia). Eine kontinuierliche Besiedlung der Alpentäler reicht bis ins 6. Jahrtausend v. Chr. zurück. Die Bergbewohner, die ihre Felsbildkunst über Jahrtausende tradiert haben, wurden von den Römern Camunni genannt. Zwar gibt es keine Berichte über die Geschichte der Camuner bei antiken Autoren, die Entwicklung der Siedlungsgemeinschaften in den Alpentälern scheint aber in den Felsbildern auf, die seit den 1960er-Jahren erforscht worden sind. Dies sind in Felswände und auf die Oberfläche von Felsblöcken eingravierte Bilder, deren Motive sich in vielerlei Kompositionen formieren, mit narrativen Szenen aus dem Leben und der religiösen Vorstellungswelt der Alpenbewohner.
Die Darstellungen reichen von Jagdszenen über Ackerbau und Viehhaltung bis zur Organisation dörflicher Gemeinwesen. Der Motivschatz ist reichhaltig. Es herrschen figürliche Motive vor, zusätzlich aber treten auch verschiedene abstrakte Symbole auf.
Bis über die Antike hinaus entstanden hier Felsbilder, doch während des Mittelalters erlosch diese Tradition des Kulturschaffens bei den Alpenbewohnern, die damals bereits ihre eigene Sprache aufgegeben hatten und eine lokale Variante des Frühromanischen (italienischer Prägung) sprachen. Unter den Bildkompositionen gibt es auch einige Inschriften, die in einer Variante des etruskischen Alphabets geschrieben wurden (s. Kap. 3).
Die Camuner sind wohl Nachkommen der einheimischen alteuropäischen Bevölkerungen, die ähnlich wie die Räter (s. u.) nicht von den indoeuropäischen Migranten assimiliert worden waren. Einige Forscher vermuten, dass das Camunische und das Rätische verwandte Sprachen sind. Das Material der camunischen Inschriften ist allerdings so spärlich, dass eindeutige Aussagen über eine ethnische Verwandtschaft der beiden Populationen oder über eine engere Zugehörigkeit von deren Sprachen nicht möglich sind.
Die Regionalkultur der Räter
Die Räter (lat. Raeti) bewohnten eine Region auf beiden Seiten der Alpen, von Graubünden bis nach Südtirol und ins südliche Bayern. In antiken Quellen ist davon die Rede, die Räter hätten ursprünglich auch in der norditalienischen Tiefebene gesiedelt und wären von dort von den Galliern vertrieben worden. Für eine historische Präsenz der Räter in der Poebene gibt es jedoch keine archäologischen Hinweise. Im Kernland der Räter (in den italienischen Provinzen Trento und Bozen/Bolzano) hat sich die Erinnerung an die Räter im Namen der »Rätischen Alpen« erhalten.
Römische Autoren wie Livius (V, 33) und Plinius (NH III, 133) betrachteten die Räter als stammverwandt mit den Etruskern. Dafür hat die moderne Forschung allerdings ebenfalls keine eindeutigen Beweise ermitteln können. So wird zwar auf bestimmte lexikalische und morphologische Parallelen im Rätischen und Etruskischen hingewiesen (z. B. rät. tenace: etrusk. zinace, rät. sfuras: etrusk. spuras, rät. klan: etrusk. clan), dabei kann es sich auch ohne Weiteres um Einflüsse des Etruskischen auf das Rätische handeln, nicht aber um eine genealogische Verwandtschaft (Rix 1998). Das Etruskische hat dem Rätischen auch die Schriftlichkeit vermittelt (s. Kap. 3).
Anhand des inschriftlich überlieferten Sprachmaterials lässt sich das Rätische als eine nicht-indoeuropäische Sprache identifizieren. Die Räter sind wohl nicht eingewandert, sondern die Nachkommen der einheimischen alteuropäischen Bevölkerung. In der Abgeschiedenheit ihres Wohngebiets hat sich die rätische Regionalkultur in Nachbarschaft zu den Kulturen der eingewanderten Indoeuropäer (überwiegend Italiker) bis in römische Zeit erhalten. Die Räter haben sich in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung ans Lateinische assimiliert.
Die Regionalkultur der Ligurer
Die Ligurer (griech. Ligues bzw. Ligyres, lat. Ligures) im Nordwesten Italiens gehören zu den altmediterranen Populationen im Mittelmeerraum, und das Ligurische gehört zu den nicht-klassifizierten Sprachen, was bedeutet, dass es keiner der bekannten Sprachfamilien zugeordnet werden kann (Hammarström et al. 2017). Noch in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. erstreckte sich das Verbreitungsgebiet der Ligurer entlang der nördlichen Mittelmeerküste von den Pyrenäen bis in die Tiefebene Norditaliens. Die historische Präsenz der Ligurer spiegelt sich bis heute in der Namengebung für das ehemalige Kernland: Ligurien. Auch die Namen von Berglandschaften erinnern an deren historische ligurische Besiedlung: Ligurische Alpen, Ligurischer Apennin.
Die Ligurer waren nach Stämmen organisiert, deren Namen aus antiken Quellen bekannt sind: Dekiaten, Salasser, Salluvier, Statieller, Stoener, u. a. Im Zuge der Ausdehnung des etruskischen Einflussbereichs im 6. Jahrhundert v. Chr. wurden die Ligurer aus der norditalienischen Tiefebene verdrängt. Im Westen dagegen schrumpfte das ligurische Siedlungsgebiet als Folge der Expansion der Gallier im 4. Jahrhundert v. Chr., die die Ligurer nach Osten abdrängte. Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. waren die Ligurer in militärische Auseinandersetzungen mit den Römern verstrickt. Diese zogen sich lange hin, bis es den Römern schließlich gelang, die Ligurer im Jahre 175 v. Chr. endgültig zu unterwerfen.
Im 19. Jahrhundert gab es Vermutungen, das Ligurische wäre eine Sprache des keltischen Zweigs des Indoeuropäischen. Heute ist jedoch geklärt, dass die Basis vorindoeuropäisch ist, wiewohl ligurische Sprache und Kultur Einflüsse von den Kelten Galliens erfahren haben (Boano 2008: 147). In einigen Gebieten kam es zur ethnischen Fusion von Ligurern und Kelten, und es bildete sich eine kelto-ligurische Mischkultur aus.
Die Überlieferung des Ligurischen ist spärlich (verstreute Wörter in antiken Quellen, eine Inschrift, Personen- und Ortsnamen). In einigen Fluss- und Ortsnamen hat sich ein typisch ligurisches Suffix erhalten. Dies sind Namen, die auf -asco/-asca enden, wie Bogliasco, Bergamasco, Vinelasca, Veraglasca. Das Ligurische hat einige Spuren in Form von Lehnwörtern im Lateinischen hinterlassen. Verschiedene Ausdrücke für Flora und Fauna der alpinen Region stammen aus dem Ligurischen; z. B. camox, ›Steinbock, Gemse‹; larix, ›Lärche‹. Auch im regionalen Dialekt des Italienischen in Ligurien gibt es den Ausdruck barga (›Heustadel‹), der als ligurisches Substratwort erklärt wird.
Die Regionalkultur der Paläosarden
Sardinien, die größte der zu Italien gehörenden Inseln, ist seit ca. 12 000 Jahren bewohnt. Migranten kamen vom Festland in mehreren Schüben auf die Insel. Die materielle Hinterlassenschaft der neolithischen Kulturstufe auf Sardinien (5. und 4. Jahrtausend v. Chr.) zeigt Ähnlichkeiten mit dem Kulturerbe Alteuropas, der Donauzivilisation in Südosteuropa (Lilliu 1999: 18 ff.). Zu den Leitmotiven in der darstellenden Kunst gehören weibliche Idolfiguren, sogenannte »Venusstatuetten«, die nach den wichtigsten Fundorten benannt werden: Venus von Macomer, Göttin von Olbia, Göttin von Decimoputzu. Die kulturelle Zusammengehörigkeit Sardiniens mit der ägäischen Kunst späterer Zeit kommt in der Ähnlichkeit der Stilformen der weiblichen Plastik mit denen des minoischen Kreta und den altkykladischen »Violinidolen« zum Ausdruck.
Zu den ältesten von Menschen errichteten Konstruktionen gehören Grabkammern der Megalithkultur, deren Bauten auch von anderen Inseln bekannt sind (die Tempel Maltas und die Steinsetzungen von Menorca). Die Architektur der Steinsetzungen entwickelte auf Sardinien einen unverwechselbaren Baustil. Dies sind Rundbauten, Nuraghen genannt, die während der Bronzezeit auf der Insel errichtet wurden. Die ältesten Nuraghen stammen aus der Zeit um 1800 v. Chr, monumentale, einzeln stehende Rundtürme. Später entstanden auch Wohnkomplexe mit Rundbauten verschiedener Größe (Nuraghen-Dörfer). Die meisten dieser Nuraghensiedlungen findet man im mittleren und nördlichen Teil Sardiniens. Am bedeutendsten sind die Anlagen mit Nuraghen-Bauten in Abbasanta (Losa-Nuraghen), Torralba (Santu Antine) und in Barùmini (Su Nuraxi).
Das Zeitalter der Nuraghen-Bauten Sardiniens endet um 500 v. Chr. Allerdings setzen sich Traditionen der Nuraghen-Bauer an einigen Orten bis in die römische Zeit fort. Typische Leitformen der Nuraghen-Kultur sind Geräte und Kunstgegenstände aus Bronze. An den Orten mit Nuraghen-Bauten sind mehr als 1500 Bronzeskulpturen gefunden worden.
Die Paläosarden waren keine Seefahrer sondern Inlandbewohner. Daher waren diejenigen, die die Küstengewässer rings um die Insel erkundeten und Handelsstützpunkte an der Küste anlegten, auswärtige Händler. Seit dem 10. Jahrhundert v. Chr. legten Phönizier Stützpunkte in Nora, Sulcis, Tharros, Olbia und an anderen Orten an. Seit dem ausgehenden 6. Jahrhundert v. Chr. gehörte Sardinien zur politischen und wirtschaftlichen Interessensphäre der Karthager. In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. ging die militärische und politische Kontrolle der Insel an die Römer über. Dies betraf zunächst nur die Küstenregionen, denn es sollte noch Jahrhunderte dauern, bis sich römischer Einfluss auch im Inland bemerkbar machte.
Sardinien war ein Rückzugsgebiet, in dem sich paläosardische Kultur und Sprache noch lange erhalten haben. Die paläosardische Bevölkerung hat sich erst allmählich an das Lateinische assimiliert. Die Bewegung des sich seit dem 3. Jahrhundert infolge der Mission verbreitenden Christentums hat der Akkulturation Vorschub geleistet. Aus der Alltagssprache der Sarden, dem Sprechlateinischen mit Lokalkolorit, hat sich im Verlauf des frühen Mittelalters eine romanische Sprache, das Sardische, entwickelt. Im Wortschatz dieser Sprache sind zahlreiche Substratwörter aus dem vorrömischen Paläosardischen erhalten geblieben. Dabei handelt es sich um Ausdrücke, mit denen Dinge der natürlichen Umwelt der Inselbewohner bezeichnet werden; z. B. kallúttsu, ›Wolf‹; aláse, ›Klee‹; tsèppara, ›steinige Ebene‹ (Wagner 1960–64).
Das erhaltene Sprachmaterial des Paläosardischen ist allerdings begrenzt, und auf dieser Basis ist es nicht möglich, verwandtschaftliche Beziehungen dieser Sprache zu anderen altmediterranen Sprachen aufzuzeigen (Ligurisch, Iberisch, Sikanisch, Minoisch).
Die Regionalkultur der Sikaner
Im Nordwesten Siziliens siedelten in vorrömischer Zeit die Sikaner, die von den Griechen Sikanoi und von den Römern Sicani genannt wurden. Die Sikaner waren die Nachkommen der einheimischen alteuropäischen Bevölkerung und ihre Sprache gehört zum Kreis der altmediterranen Sprachen. Es wird vermutet, dass bestimmte Heilige Stätten auf Sizilien von Sikanern begründet worden sind, so das Heiligtum der Diana bei Cefalù. Dies erscheint durchaus schlüssig, denn die Tradition einer Göttin der Natur geht auch in anderen Kulturkreisen auf alteuropäische Ursprünge zurück. Dies trifft beispielsweise auf Artemis zu, deren Kult und Name vorgriechischer Herkunft sind.