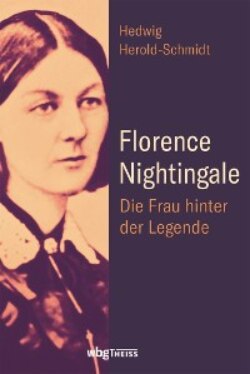Читать книгу Florence Nightingale - Hedwig Herold-Schmidt - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Auftrag, Gott zu dienen
ОглавлениеZwei Geschichten aus ihrer Kindheit, die ihre frühe Neigung zur Krankenpflege und ihre mitfühlende Natur untermauern sollten, wurden später Teil ihres Mythos. An Keuchhusten erkrankt soll sie allen ihren 13 Puppen den Hals verbunden und sie umsorgt haben. Der zweite Vorfall: Als Sechzehnjährige habe sie das gebrochene Bein eines Hundes behandelt und ihn gesund gepflegt. Versuche, die Spuren späterer „großer Leistungen“ schon in der Kindheit zu entdecken, sind nachvollziehbar, doch immer problematisch. Da sich die Mutter sehr um die Gesundheit der Familie sorgte, ist bei Florence Nightingales Wissensdurst ein Interesse für gesundheitliche Fragen nicht weiter verwunderlich. Man kann aber wohl so weit gehen zu sagen, dass sie eine frühe Faszination für Krankheiten, Medizin und Pflege entwickelte, die sich Jahr für Jahr verstärkte. Als sie etwa 9 Jahre alt war, begann sie, sich Notizen über das Befinden und die Behandlung von Familienmitgliedern zu machen, auch Gedanken über den Tod. Als ein Cousin 1829 im Alter von 10 Jahren starb, zeichnete sie dessen Krankengeschichte genau nach. Ab 1831 stand Cousin „Shore“ im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. 1836 pflegte sie ihre kranke Schwester mit solcher Hingabe, dass die Mutter schrieb, die Krankheit habe „all das latent Gute“ an die Oberfläche gebracht, „das normalerweise so tief verschüttet sei“ (Bostridge, 49). Als Heranwachsende engagierte sich Florence Nightingale in der Versorgung kranker Verwandter und entwickelte eine zunehmende Sensibilität für die Krankheiten der Pächter und Arbeiter rund um die Landgüter der Familie. Schon seit früher Kindheit hatte sie ihre Mutter bei den obligatorischen Armenbesuchen begleitet. In den folgenden Jahren sollte die Arbeit für die Armen und Kranken zu einer Art Rettungsleine für sie werden, als sie sich immer stärker als nutzlos und ihr Leben als sinnentleert empfand. Eine Gelegenheit, sich zu beweisen, gab es im Januar 1837, als eine Grippeepidemie in Embley fast alle Bewohner an das Bett fesselte. Einen Monat lang pflegte sie und organisierte den Haushalt, eine dringend notwendige Quelle der Bestätigung und des Stolzes. Nachdem sich die Situation entspannt hatte, erreichte sie am 7. Februar 1837 der Ruf Gottes, ihm zu dienen, ihr „call to service“, wie sie ihr Erweckungserlebnis nannte.
Es gibt keinen Beleg dafür, dass sie damals irgendwem davon erzählt hätte. Und sie hatte wohl auch noch keinen Kontakt mit christlicher Mystik, mit der sie sich später intensiv beschäftigen sollte. Die religiösen Richtungen, die sie am besten kannte – der aufgeklärte Unitarismus und der freidenkerische Anglikanismus –, waren beide nicht der Mystik zugeneigt.
Florence Nightingales Glaube und ihre religiösen Vorstellungen waren die motivierende Kraft, die hinter ihrem gesamten Leben und Werk stand. Es war ein sehr persönlicher Glaube aus verschiedenen Quellen, der sich langsam herausbildete. Ihr Biograf Mark Bostridge sieht zwei Stränge, die sich letztlich ergänzten. Einerseits einen rationalistischen Ansatz, der sie dazu brachte, nach Beweisen göttlicher Gesetze in der Welt zu suchen. Zum anderen nennt er ihr inneres Streben nach einer Vereinigung mit Gott. Ihre empirische Ader zeigte sich schon in früher Kindheit, als sie mit einem Experiment die Wirksamkeit von Gebeten testen wollte. Den „Versuchsaufbau“ beschrieb sie detailliert – und wurde enttäuscht. Darüber hinaus bemühte sie sich bereits in jungen Jahren, die Präsenz Gottes zu erspüren, etwa in der Schönheit der Natur. Wenn auch Florence Nightingale für bestimmte Anliegen betete, war sie doch davon überzeugt, die Menschheit sollte besser selber aktiv werden, anstatt auf Gottes Eingreifen zu warten. Ihr Leben lang glaubte sie unerschütterlich daran, dass die Menschen Gottes gute Gesetze erkennen und die Welt besser machen sollten.
Frances Nightingale war der entscheidende Part in der religiösen Erziehung der Töchter. Später wurde der Vater zum vertrauten Gesprächspartner. Die Mutter scheint die Frömmere und Kirchennähere gewesen zu sein. William Nightingale dagegen hielt Benthams Utilitarismus hinsichtlich moralischer Wahrheiten meist für aussagekräftiger als christliche Lehren. Über die religiösen Bindungen der Nightingales kursieren viele widersprüchliche Behauptungen. Oft wird unterstellt, Frances Nightingale habe mit dem Unitarismus zugunsten der Anglikanischen Kirche gebrochen, weil damit ein höheres Sozialprestige verbunden gewesen sei. In der Tat war jener trotz rechtlicher Gleichstellung immer noch vielen suspekt. Doch es war wohl komplizierter. Das Ehepaar hatte nach anglikanischem Ritus geheiratet, und Florence war ebenso getauft, aber auch in das Geburtsregister der Dissenters eingetragen worden. Miss Christie bekam die Anweisung, keine doktrinären Inhalte zu lehren, bis die Kinder ein Alter erreicht hatten, um selbst zu urteilen, eine Haltung, die für die Offenheit und Toleranz in der Tradition von Großvater William Smith charakteristisch war. Je nach Aufenthaltsort der Familie wurden der anglikanische Gottesdienst in der Nähe von Embley oder die Zusammenkünfte der Dissenters nahe Lea Hurst besucht. Als Grundbesitzer fungierte William Nightingale gleichzeitig als Kirchenpatron.
Und die Tochter? Florence Nightingale entwickelte im Laufe der Zeit ein zunehmend heterodoxes Glaubenssystem. Nominell blieb sie Mitglied der anglikanischen Kirche, aber ab ihrem 30. Lebensjahr besuchte sie keine Gottesdienste mehr. Einige der Doktrinen lehnte sie rundweg ab. Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überhandnehmenden Kämpfe und Spaltungen waren ihr ein Graus. Die religiöse Gemengelage war, vorsichtig formuliert, unübersichtlich. Die Anglikanische Kirche, die sich auch nach der Emanzipation der Katholiken und der Gleichstellung der Dissenters als Staatskirche Privilegien bewahrt hatte, geriet immer stärker in die Kritik. Zudem war sie intern in sich heftig befehdende Gruppierungen zerfallen. Während sich die High-Church-Bewegung dem Katholizismus annäherte, versuchte die Broad-Church-Bewegung eine Versöhnung von Glauben und Moderne, indem sie Neuerungen der Naturwissenschaften, insbesondere des Darwinismus und der historischen Bibelkritik, aufnahm. Großen, auch politischen Einfluss sollte die Low-Church-Bewegung bekommen, die sich im Wesentlichen mit der evangelikalen Erweckungsbewegung deckte. Für diese standen eine innerlich erfahrene Gottesnähe und das karitative Wirken in der Gesellschaft im Mittelpunkt ihres Glaubens. Sie sah es als ihre Aufgabe an, die durch die rasanten Veränderungen erschütterte Gesellschaft zu Gott, Moral und Stabilität zurückzuführen. Dazu gehörten dezidiert auch soziale Arbeit und Sozialreformen, die weitere Aufstände und Unruhen verhindern sollten. Während die Anziehungskraft des Katholizismus stieg und damit die weitgehend irrationale Angst vor einer Rücknahme der Reformation im protestantischen Britannien um sich griff, bekamen nonkonformistische Gruppen, wie etwa die Methodisten, mehr und mehr Zulauf. Nicht zuletzt erwuchs den christlichen Gruppen insgesamt durch die fortschreitende Säkularisierung immer größere Konkurrenz. Die Wissenschaften, vor allem die Theorien Darwins, leisteten dazu einen wichtigen Beitrag.
Nightingales religiös-spirituelle Suche schloss viele Quellen ein. Die Ritualität des Katholizismus sprach sie emotional an, wenngleich sie diese aus Vernunftgründen ablehnte. Wichtig wurde für sie von katholischer Seite vor allem die Mystik. Im Protestantismus hingegen waren es die historisch-kritische Schule, die die Bibel als Produkt einer bestimmten geschichtlichen Zeit las, und die Lehren des Methodisten John Wesley mit seinem Konzept der allgemeinen Gnade Gottes, dem sie viel mehr abgewinnen konnte als der calvinistischen Prädestinationslehre. Über Tante Mai bestand intensiver Kontakt zu unitarischem Gedankengut. Gemäß dem Wahlspruch der Unitarier, „deeds not creeds“, schätzte Nightingale deren allgemeines Ethos des Optimismus und ihren Glauben an sozialen Fortschritt, der mit einem hohen Stellenwert guter Werke und des Dienens für die Allgemeinheit verbunden war.
Wie es scheint, stand aber keine dieser Glaubensquellen unmittelbar mit ihrem Erweckungserlebnis vom 7. Februar 1837 im Zusammenhang. Entscheidend war vermutlich ein Buch Jacob Abbotts, eines amerikanischen kongregationalistischen Pastors, der für ein aktives christliches, der Caritas gewidmetes Leben warb. Sollte sie über ihren „call to service“ jemals Näheres niedergeschrieben haben, so ist dies nicht überliefert. Was genau darunter zu verstehen ist, darüber streiten sich die Gemüter. Religiöse Offenbarungen, Visionen, Erscheinungen kennt man besonders aus dem katholischen Umfeld, aber nicht nur. Geht ein Glaube davon aus, dass ein Eingreifen Gottes in die irdische Welt möglich ist, so kann er die Möglichkeit von Offenbarungen welcher Art auch immer nicht kategorisch ausschließen. Psychologie und Theologie haben vor allem für den Katholizismus, seine Mystik und im Hinblick auf Phänomene wie Visionen und Erscheinungen verschiedene Theorien diskutiert. Die Versuche, diese Phänomene zu erklären bzw. zu kategorisieren, bewegen sich in der katholischen Theologie der Gegenwart in einem breiten Spektrum, von einem Einwirken Gottes auf die Vorstellungen eines Menschen bis hin zum Glauben an die physische Realität etwa von Marienerscheinungen. Psychologie und andere Wissenschaften diskutieren über veränderte Bewusstseinszustände, Halluzinationen, Ekstasen und verschiedene psychiatrische Krankheitsbilder. Entsprechend vielfältig und widersprüchlich sind auch die Überlegungen zu Nightingales Berufungserlebnis. Unbestritten ist, dass sie aus ihrem weiteren Leben von mehreren solcher Erfahrungen berichtete, bei denen sie sich von Gott direkt angesprochen fühlte. Auffallend ist zudem, dass dies immer zu Zeiten besonderen psychischen Drucks geschah.
Ab ihrem 17. Lebensjahr war Nightingale lange Jahre zerrissen zwischen der Überzeugung, dass Gott sie persönlich auserwählt und zum Dienst berufen habe, und ihrer Unfähigkeit zu erkennen, worin ihre Aufgabe bestehen solle. Bedeutete dies, die traditionelle Rolle als Frau demütig anzunehmen und auf diese Weise zu dienen, oder sollte sie neue, andere Wege beschreiten? Das Erweckungserlebnis fiel in die Zeit, als die Familie intensiv mit den Vorbereitungen ihres Italienaufenthalts beschäftigt war. In den Monaten vor der Abreise verstärkte Florence Nightingale ihr Engagement für die Armen und Bedürftigen. Die Zeit auf dem Kontinent, so dachte sie, würde ihr hoffentlich Klarheit bringen, welchen Weg sie einschlagen sollte.