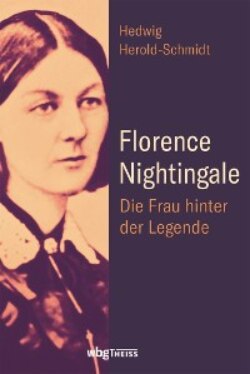Читать книгу Florence Nightingale - Hedwig Herold-Schmidt - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Auf welche Weise Gott dienen?
ОглавлениеIn den folgenden Monaten machten sich in Florence Nightingale immer stärker Unzufriedenheit, Unruhe und Zweifel breit. Bereits vor der Abreise aus Paris hatte sie notiert, dass sie sicherlich noch nicht würdig sei, Gott zu dienen. Denn nach fast drei Jahren war ihr die Form ihrer Berufung immer noch nicht klarer geworden. Zunächst müsse sie wohl die Versuchung, in „Gesellschaft zu glänzen“, überwinden. Zudem erbitterte sie das häusliche, untätige Leben nach den Erfahrungen der Reise mehr denn je. Dabei war der Tag straff durchgeplant und mit einer Vielzahl zeitraubender Aktivitäten gefüllt, die sie größtenteils als unsinnig empfand. Vor allem das Dinner galt als „die große heilige Zeremonie des Tages“ (CW 11, 555) und die Zeit bis zehn Uhr abends hatte man gemeinsam im Salon zu verbringen, mit Gesprächen, Handarbeiten, Vorlesen. All das hielt sie von Wichtigerem wie der Lektüre interessanter Bücher ab. Außerdem brauchte sie Ruhe zum Nachdenken. Doch weder dafür noch für ernsthafte Arbeit sei es Frauen gestattet, Zeit für sich zu reservieren, wie das für Männer selbstverständlich sei. Hingegen ginge jeder davon aus, dass Frauen rund um die Uhr für ihre Familien und die „weiblichen Aufgaben“ zur Verfügung stünden. So gelänge es diesen niemals, Großes zu leisten, da sie sich immer nur einige Minuten stehlen konnten. Sie schüttete ihr Herz Mary Clarke und ihrer Cousine Hilary aus, doch half ihr vor allem Tante Mai Smith mit Trost und Ermunterung.
Hilfreich war auch die Mathematik, für die sich Florence Nightingale immer mehr begeisterte. Schon nach kurzer Zeit hatte sie sich so fundierte Kenntnisse angeeignet, dass sie einem Cousin bei der Vorbereitung seiner Prüfungen für die Militärakademie Sandhurst helfen konnte. Allerdings wurde ihr strengstes Stillschweigen verordnet, denn von einer Frau angeleitet zu werden wäre dann doch zu demütigend für den jungen Mann gewesen. Bei ihrer Leidenschaft für die Mathematik dürfte sie das Beispiel Mary Somervilles, einer Freundin ihrer Tante Patty, ermuntert haben, die trotz heftigen Widerstands als autodidaktische Astronomin und Mathematikerin große Bekanntheit erlangt hatte. Somerville war es gelungen, herausragende intellektuelle Leistungen mit der konventionellen Frauenrolle als Ehegattin und Mutter zu vereinbaren. Ein Thema, das Nightingale in den folgenden Jahren intensiv beschäftigen sollte, denn in den 1840er-Jahren stellten sich mehrere Bewerber ein. Den ersten, kaum etwas Ernsthaftes, hatte sie in Nizza kennengelernt. Doch so sporadisch diese Episode auch gewesen war, so sehr befeuerte sie ihr Nachdenken über die Beschränkungen, der sich eine Frau als Gattin und Mutter ausgesetzt sah – und schürte damit die Angst vor ihrer eigenen Zukunft. Dabei scheint sich bei ihr immer mehr die Auffassung durchgesetzt zu haben, dass eine Frau, die sich ernsthaft Gottes Werk in der Welt widmen wollte, wohl allein bleiben müsse. Doch wie konnte ein solches Engagement aussehen? Welche Möglichkeiten hatte sie?
Die 1830er- und 1840er-Jahre waren eine Zeit großer wirtschaftlicher und sozialer Not, die zur Verelendung breiter Bevölkerungsschichten führte. Auch auf den Gütern der Nightingales, insbesondere aber in der Gegend um Lea Hurst, war dies nicht zu übersehen. Reformbewegungen wie die Chartisten forderten grundlegende Veränderungen, allen voran kürzere Arbeitszeiten, bessere Bedingungen in den Fabriken, die Zulassung von Gewerkschaften sowie das Ende der Getreidezölle, die schließlich Ende der 1840er-Jahre abgeschafft wurden.
Für die Nightingales hingegen waren dies Jahre des sozialen Aufstiegs und eines angenehmen privilegierten Lebens. Die gesellschaftlichen Kreise, in denen sie sich bewegten, wurden illustrer. Zu den neuen Bekanntschaften zählten einige, die für Florence Nightingales späteres Werk enorme Bedeutung erlangen sollten, insbesondere die Palmerstons. Lord Palmerston war Außenminister in den Jahren, in denen England zur Weltmacht aufstieg, ab 1855 lange Premierminister und der bekannteste Vertreter der liberalen Whigs. Sein Schwiegersohn, Lord Shaftesbury, einer der markantesten viktorianischen Reformer, trieb zahlreiche sozialpolitische Initiativen voran, wie etwa den Zehn-Stunden-Tag oder das Verbot besonders brutaler Formen von Kinderarbeit. In diesem Rahmen lernte Florence Nightingale die Reformvorhaben der Zeit aus nächster Nähe kennen, darüber hinaus auch das gesamte liberale Establishment, und knüpfte Kontakte, die ihr später von unschätzbarem Wert sein sollten. Vor allem für Lord Shaftesbury und seinen Kreis wurde sie mit der Zeit zur ersten Beraterin in allen Fragen des Krankenhauswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege. Hier konnte sie neue Formen politischen Handelns zur Bekämpfung gesellschaftlicher Missstände beobachten. Nicht nur individuelle Philanthropie war gefragt, sondern neue Gesetze und eine Zivilverwaltung, die diese systematisch umsetzen konnte. Es waren aber meist immer noch persönliche Beziehungen, die legislative Initiativen anstießen, Netzwerke, die nur aus Männern bestanden. Frauen, so engagiert sie auch sein mochten, blieb nur die indirekte Mitwirkung. Die meisten der zahlreichen philanthropisch tätigen Frauen schienen damit zufrieden zu sein, aber nicht so Florence Nightingale, die bereits um 1840 überlegte, ob nicht eine Frau von hoher gesellschaftlicher Stellung Freunde und Allianzen für größere soziale Projekte mobilisieren könnte.
Ihre Briefe aus dieser Zeit zeigen, wie intensiv sie das allgegenwärtige Elend und den Kontrast zu ihrem eigenen Leben wahrnahm. Aber dabei beließ sie es nicht, auch nicht bei der traditionellen Wohltätigkeit. Sie fing an, systematisch Informationen zusammenzutragen und zu analysieren. Die allgemeine Reformdiskussion konzentrierte sich mittlerweile immer stärker auf den sozialen Bereich. Denn in das Mitleid und die Sorge um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bevölkerung mischte sich immer öfter die Furcht vor Aufständen und Rebellionen. 1842 hatte Edwin Chadwicks Report on the Sanitary Condition of the Labouring Classes of Great Britain wie eine Bombe eingeschlagen. Er prangerte die gesundheitlichen Verhältnisse und Gefährdungen vor allem in den neuen Industriestädten und in den Slums der großen Metropolen in deutlichen Worten an und forderte Abhilfe. William Farr, Mitarbeiter der Behörde für Bevölkerungsstatistik (Registrar General), begann die beunruhigenden Sterblichkeitsziffern und Erkrankungshäufigkeiten mathematisch aufzubereiten. Thomas Southwood Smith unterstrich in seiner Aufklärungsarbeit die fatalen Folgen von schmutzigem Trinkwasser und nichtexistenten Kanalisationssystemen. Weiterhin gerieten die oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken immer stärker in den Blick. Hier formierte sich das, was wenig später unter dem Begriff Sanitary Movement bekannt werden sollte. Gesundheitsfürsorge für arme Kranke und Almosen für Arbeitsunfähige und Alte waren in Großbritannien traditionell Aufgabe der Kommunen und der privaten Wohltätigkeit. Diese sahen sich allerdings damit zunehmend überfordert. Auch die Verbesserung von Kanalisationssystemen, Abfallbeseitigung und Trinkwasserversorgung überstieg in der Regel die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden. Hier waren zentrale Koordination und finanzielle Hilfen vonnöten.
All das verfolgte Florence Nightingale genau. Aber was konnte sie tun? Ihre Möglichkeiten waren begrenzt. So ergriff sie jede Gelegenheit zu helfen mit Feuereifer. Das galt für Notlagen in Familie und Freundeskreis, besonders aber für die Pächter und Arbeiter rund um Lea Hurst und Embley. Sie kümmerte sich um Kranke und Invalide, unterrichtete in Armen- bzw. Gemeindeschulen, verteilte Lebensmittel. Doch auch das erzeugte Irritationen in der Familie. Die kränkelnde Parthenope kehrte ihre besitzergreifende Attitüde heraus und wollte längere Aufenthalte bei kranken Verwandten nicht dulden. Bei diesen gerne ergriffenen Gelegenheiten scheint sich Florence erstmals nützlich gefühlt zu haben: „Wie dankbar solltest Du sein, dass Deine Tochter zum ersten Mal in ihrem Leben ein wenig Gutes tun kann […] Missgönne es ihr nicht“ (CW 1, 115), schrieb sie um 1840 an die Mutter.
In den 1840er-Jahren plagten Florence Nightingale immer wieder gesundheitliche Probleme unterschiedlicher Art. Heute würde man vermutlich eine psychosomatische Ursache diskutieren. Zwischen 1842 und 1844 war sie öfter für längere Zeit ans Bett gefesselt. Dies hatte wohl auch damit zu tun, dass eine entscheidende Weichenstellung für ihr Leben bevorstand. Ihr Cousin Henry Nicholson hielt nach etlichen Jahren des Werbens, dem sie sich mehr schlecht als recht zu entziehen versucht hatte, schließlich um ihre Hand an.
Die Familien Nicholson und Nightingale hatten ein sehr enges Verhältnis zueinander. Der potenzielle Bräutigam war fleißig und würde später ein beträchtliches Vermögen erben. Es war die perfekte Partie. Den nahen Verwandtschaftsgrad schien niemand als ein ernstes Problem zu betrachten. Zehn Jahre später sollte sich Florence Nightingale dezidiert gegen Ehen zwischen Cousins und Cousinen wenden. Dies sei „ein direkter Verstoß gegen die Naturgesetze, die das Wohlergehen der Rasse gewährleisten“ (CW 11, 581), die Folge Schwachsinn und Kretinismus. Sie griff hier die zeitgenössischen Degenerationsdebatten auf, die Britanniens politische und ökonomische Vormachtstellung durch den schlechten Gesundheitszustand seiner Bevölkerung bedroht sahen.
Die Eltern hatten nicht allzu sehr auf eine schnelle Entscheidung gedrängt, jedoch hatte man Gelegenheiten arrangiert, sich näher kennenzulernen. Im Sommer 1839 hielt sich Henry Nicholson lange Wochen in Lea Hurst auf. Im Jahr darauf verreiste Florence Nightingale mit seiner Familie und besuchte diese auf ihrem Landsitz. Glücklich war sie dabei nicht, im Gegenteil. Als Weihnachten 1842 vor der Tür stand – die Feiertage verbrachten beide Familien traditionell zusammen –, war die Situation immer noch ungeklärt. Und wieder wurde Florence krank. Flüchtete sie sich nun ebenso in Krankheit, wie sie dies von ihrer Schwester seit etlichen Jahren kannte? Unzweifelhaft belastete sie der Konflikt zwischen Familienerwartungen und ihrer Ablehnung des Bewerbers schwer. Statt die Aufmerksamkeiten Henry Nicholsons zu beachten, führte sie tiefsinnige Gespräche über Religion mit seiner Tante Hannah. Dies war der Beginn einer fünfjährigen intensiven Korrespondenz, die tiefe Einblicke in das Leben, die Gedanken und Gefühle Nightingales in den 1840er-Jahren ermöglicht.
Wann Nicholson letztendlich vergeblich um ihre Hand anhielt (vermutlich um die Jahreswende 1843/44), ist nicht mehr genau zu ermitteln. Es war jedenfalls der Beginn langandauernder Spannungen zwischen beiden Familien und führte zur Zerrüttung der Freundschaft zwischen Florence und ihrer Cousine Marianne. Ihrer Freundin Hilary schrieb Nightingale von ihrer Verzweiflung und ihren Gefühlen für Marianne. Sie gab sich selbst die Schuld dafür, dass sie ihren Cousin unbeabsichtigt ermutigt und dadurch diese Katastrophe heraufbeschworen hatte. Das Ende dieser Freundschaft beklagte sie mit Worten, die einige Autoren des 20. Jahrhunderts zu der Auffassung verleiteten, es sei hier eine erotische Komponente am Werk gewesen bzw. es habe sich um eine lesbische Beziehung gehandelt. Die dafür angeführten Textstellen sind vage, ihre Interpretation höchst fraglich. Denn dabei wurde wohl in anachronistischer Weise der romantische Freundschaftskult der Zeit mit seinen für den heutigen Sprachgebrauch ungewohnt gefühligen Formulierungen falsch gedeutet. Leidenschaftliche Freundschaften waren im viktorianischen England keine Besonderheit. Zudem musste sich der weibliche Teil der Bevölkerung schon deshalb anderen Frauen für intellektuelle, emotionale und spirituelle Unterstützung zuwenden, weil Kontakte mit dem anderen Geschlecht, vor allem in den oberen Schichten, streng reguliert waren. Nightingales Beziehungen mit engen Freundinnen waren daher nichts Besonderes, so überschwänglich die Schilderungen heute auch anmuten mögen. Ob dabei sexuelle Komponenten mitspielten, lässt sich im Rückblick unmöglich entscheiden.
In dieser belastenden Situation stützte sie die Korrespondenz mit Hannah Nicholson, die großen Einfluss auf Nightingales religiöse Suchbewegungen in den 1840er-Jahren gewann. Der evangelikale Duktus ist dabei nicht zu übersehen: In den Briefen ging es um die Unzufriedenheit mit ihrem Leben, um die Selbstbezichtigung als Sünderin, die Geißelung des eigenen Stolzes und um ihre Zweifel an der Fähigkeit zur Gottesliebe. Während Hannah Nicholson die mystische Vereinigung mit Gott als Selbstzweck anstrebte, war diese für Florence ein Kraftquell, um ihre gottgewollte Aufgabe in der Welt erfüllen zu können. Die Ältere hoffte darauf, dass die Jüngere ihre gottgegebene gesellschaftliche Rolle akzeptierte. Sie predigte Florence eine Doktrin christlicher Unterwerfung und Askese, die sie mit den typisch viktorianischen Vorstellungen von weiblicher Passivität verband: Christliche Frauen müssten leiden, ihren Willen und ihren Intellekt aufgeben und die göttliche Vorsehung erwarten. Doch all dies brachte Florence Nightingale nur noch mehr Qualen und Frustration. Diese Botschaft der Selbstverleugnung trug aber vermutlich dazu bei, dass sie sich lange nicht gegen ihre Mutter und Schwester durchzusetzen versuchte.
Letztere forderte immer vehementer, dass Florence zu Hause bleiben und sich in das Familienleben einfügen solle. Half dies nicht, so blieb ihr als Druckmittel immer noch, krank zu werden – und dieses setzte sie ausgiebig ein. Für Florence wurden diese Realitäten des Alltags immer unerträglicher. Die Langeweile der Salons und der gesellschaftlichen Verpflichtungen schienen ihr gefräßige Feinde, die ihr die Zeit raubten, die sie so dringend für sinnvolle Dinge nutzen wollte. Oft blieben dafür nur die frühen Morgenstunden, in denen sie sich mit Mathematik, alten Sprachen oder philosophischen Texten befassen konnte. Sie fühlte sich zerrissen. Im Februar 1846 schrieb sie an Hannah Nicholson auf die Frage nach ihrem Befinden: Seit September vorigen Jahres sei die Familie in Embley nicht für 14 Tage allein gewesen. „Die Tage persönlicher Hoffnungen […] sind für mich vorbei“ und „manchmal denke ich, dass jedermann ärgerlich mit mir ist; dass man [aber] von keinem verlangen kann, von früh bis spät fröhlich zu schauen und etwas Munteres zu sagen, – dann wird mir bewusst, wie geduldig alle mit mir sind und ich schäme mich sehr.“ (CW 3, 343f.)
So sehr Florence Nightingale die Dinnerparties und Besuche als Zeitverschwendung begriff, so boten sie ihr doch die Gelegenheit, wichtige Kontakte zu knüpfen. Denn nicht alle waren langweilig und ermüdend. Bei den Nightingales traf man viele Politiker und Parlamentsabgeordnete, Wissenschaftler und Schriftsteller. Mary Clarke brachte etwa den Historiker Leopold von Ranke mit. Zu den Gästen zählten Charles Darwin, der Historiker und Politiker Thomas Macaulay, der Sibirienforscher Alexander von Middendorf, Lady Byron und ihre Tochter, die Mathematikerin Ada Lovelace. Und vor allem der preußische Gesandte Christian von Bunsen und seine englische Frau. Beide waren streng evangelikal, er bewunderte Florence, lieh ihr Bücher und diskutierte mit ihr über Philosophie, Archäologie und Theologie, über Schopenhauer, Schleiermacher und seine eigenen vergleichenden religionswissenschaftlichen Studien. Bunsen förderte ihre Aufgeschlossenheit für andere Glaubenssysteme und beeinflusste ihre Vorstellungen von Religion, Theologie und Spiritualität. Was Florence Nightingale weiterhin anzog, war das humanitäre Engagement der Bunsens. Der preußische Gesandte zählte zu den Mitbegründern des German Hospital in East London für arme deutsche Einwanderer (1845), das sie ein Jahr später besuchte. Es war das erste Krankenhaus, das sie betrat. Für die Pflege waren Diakonissen aus dem rheinischen Kaiserswerth verpflichtet worden. Dort hatte Pastor Theodor Fliedner 1836 unverheirateten protestantischen Frauen in der Diakonie eine respektable Arbeits- und Lebensform eröffnet.