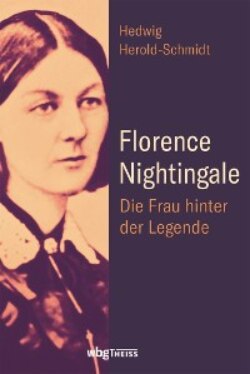Читать книгу Florence Nightingale - Hedwig Herold-Schmidt - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Krankenpflege und Krankenhäuser
ОглавлениеIn Laufe der 1840er-Jahre sah Florence Nightingale ihre Zukunft immer mehr in der Pflege, in Einrichtungen für arme Kranke. Zunächst behielt sie diesen Plan für sich, überlegte, sammelte Informationen, spielte mögliche Szenarien durch. Von außen betrachtet war ihr Alltag unverändert: Unterricht in der örtlichen Mädchenschule, karitative Krankenbesuche. Sie kümmerte sich um ihren Cousin „Shore“, versorgte ihre kranke Großmutter und begleitete ihre ehemalige Kinderfrau in deren letzten Wochen. Ihre Erfahrungen mit Krankenpflegerinnen hatten sie immer mehr davon überzeugt, dass gute Pflege einer Ausbildung bedarf, dass man diese durch praktische Unterweisung lernen müsse. Der Kontakt mit einem Arzt aus dem nahe Embley gelegenen Krankenhaus von Salisbury ließ eine Idee in ihr reifen. Drei Monate wollte sie dort arbeiten und so viel wie möglich an Wissen und Fertigkeiten mitnehmen. Auf längere Sicht war dann vielleicht eine Art protestantischer Schwesternschaft ohne Gelübde für gebildete Frauen denkbar, um arme Kranke zu versorgen. Als sie ihren Plan schließlich 1845 aussprach, versetzte er die Familie in hellen Aufruhr. Sie hatte alles bis in die Einzelheiten geplant, ein detailliertes Gedankengebäude gesponnen, das durch das kategorische Nein wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzte. Auf ihre Psyche hatte dies verheerende Auswirkungen. Weihnachten 1845 kam es zum Eklat mit Mutter und Schwester, der Vater floh entnervt in seinen Londoner Club.
Eine Tätigkeit in einem öffentlichen Krankenhaus war für eine „höhere“ Tochter schlicht und einfach nicht vorstellbar. Der Ruf der Wärterinnen war schlecht, der Kontakt mit ihnen und mehr noch mit männlichen Ärzten inakzeptabel und ein Hospital sowieso kein Ort, an dem sich eine Tochter aus gutem Hause aufhalten sollte. Und wenn all das noch nicht genügen sollte, so sprach auch Florence Nightingales angeschlagene Gesundheit dagegen. Ihr sorgsam geschmiedeter Plan war gescheitert. Private Notizen spiegeln ihre Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit. Sie flehte Gott an, sie sterben zu lassen. Denn im Leben könne sie seinem Ruf nicht folgen, sondern nur die Sorgen ihrer Familie vergrößern. In ihrem Tagebauch findet sich ein leicht abgewandeltes Grillparzer-Zitat – auf Deutsch: „Ach ich fühl es wohl, mein Scheiden [ist] kaum so schwer von wahren Freuden als von einem schönen Traum.“ (CW 2, 367)
Die nächsten Jahre sah ihr Leben – oberflächlich betrachtet – nach Privilegien, Luxus und Wohlergehen aus. Sie fügte sich so gut es ging dem Imperativ des Familienlebens und suchte kleine Freiräume für sich. Sie las, was sie bekommen konnte, besuchte mit ihrem Vater Treffen der British Association, die soziale Probleme der Gegenwart diskutierte, fuhr mit der Mutter ins Bad, reiste viel. War sie unterwegs, schrieb sie witzige, von Nähe geprägte Briefe nach Hause. Wieder zurück, flammten die Konflikte erneut auf.
Viel Zeit widmete sie den Pächtern der Familiengüter und den Armen der Umgebung. In einer Zeit, in der es noch kein landesweites Elementarschulsystem gab, hatte ihre Familie lokale Schulen gegründet. Dort unterrichtete sie Mädchen und junge Frauen. Besonders geeignet für das Lehren hielt sie sich zwar nicht, doch es war zumindest eine Möglichkeit, etwas Nützliches zu tun. Sie stellte ein Programm für Mädchenschulen zusammen, die ältere Mädchen nach der Arbeit besuchten. Ihr dort erworbenes Wissen – so die Idee – sollten sie dann an die jüngeren zu Hause weitergeben. Wenn Florence aber nach getanem Werk müde, unordentlich und oft zu spät zum Abendessen nach Hause kam, trafen sie bittere Vorwürfe, denn sie hatte die unsichtbare Grenze zwischen dem üblichen karitativen Teilzeitengagement höhergestellter Frauen und hauptberuflicher Sozialarbeit deutlich überschritten. In der knappen Zeit, die sie für sich hatte, las sie alles, was sie über Krankenhäuser, Pflege und Gesundheitspolitik sowie medizinische Statistik bekommen konnte. Bunsen schickte Material aus Berlin, Julius Mohl aus Paris. Lord Shaftesbury machte sie auf die Blue Books, offizielle Berichte zum Armen- und Krankenhauswesen sowie zur öffentlichen Gesundheit, aufmerksam. Sie arbeitete im Verborgenen, meist vor Tagesanbruch bei Kerzenlicht.
Trotz aller Frustration realisierte sie bald, dass sie in Salisbury nur wenig hätte lernen können, abgesehen von der harten Arbeit, die fast ausschließlich arme Frauen aus den Unterschichten verrichteten. Wo aber gab es einen solchen Ort? In den 1840er-Jahren zeichneten sich langsame Veränderungen im Krankenhauswesen ab. Zu Beginn des Jahrhunderts hatten Hospitäler noch keine große Rolle für die Gesundheitsfürsorge gespielt. Wer es sich leisten konnte, ließ sich zu Hause pflegen. Auch die Armen zogen eine Betreuung durch Familie oder Nachbarn vor, um die verrufenen Krankenabteilungen der Arbeitshäuser und Hospitäler zu vermeiden, die ihnen im Notfall offenstanden.
Völlig Mittellose landeten in den berüchtigten Arbeitshäusern (workhouses). Dahinter stand die Idee, dass sich Bedürftige die Unterstützung der Gesellschaft durch Arbeit verdienen sollten. Man ging in oft menschenverachtender Weise davon aus, dass Armut selbst verschuldet sei. In diesem Sinne sollte die militärische Disziplin der Arbeitshäuser vor allem abschrecken. Die „freiwilligen“ Krankenhäuser (voluntary hospitals) waren für die sog. ehrbaren Armen gedacht. Für diese Institutionen der privaten Wohltätigkeit, die sich aus Spenden und Subskriptionen finanzierten, brauchte man ein Empfehlungsschreiben eines Spenders. Fieberpatienten wurden nicht aufgenommen, auch keine Schwerkranken und Schwangeren. Für diese gab es erst ab dem letzten Drittel des Jahrhunderts spezielle Einrichtungen in größerem Maße. Die Hospitäler, und mehr noch die Krankenabteilungen der Arbeitshäuser, waren meist überfüllt, dreckig, finanziell schlecht ausgestattet und miserabel geführt, die ärztliche und pflegerische Versorgung minimal. Frauen aus den Mittelklassen hatten dort keinen Platz und wären wohl auch für die schwere Arbeit kaum geeignet gewesen.
Doch veränderte sich die Lage in der ersten Jahrhunderthälfte in mehrerlei Hinsicht. Zum einen verschärften Industrialisierung und Städtewachstum die gesundheitliche Lage breiter Bevölkerungskreise immer mehr, die immer häufiger weit weg von ihren Familien in krankmachenden Umgebungen arbeiteten und wohnten. Mehr Krankenhäuser wurden gebraucht, und es kam tatsächlich zu einem wahren Gründungsboom. Zum anderen hielten neue klinische Methoden Einzug. Dadurch veränderte sich die Patientenklientel und auch die Krankenpflege. So ermöglichte die Einführung von Chloroform-Narkosen kompliziertere Operationen. In der gleichen Zeit wandelten sich langsam die althergebrachten Krankheitskonzepte. Die in der Antike entwickelte Humoralpathologie war von einem Ungleichgewicht der Säfte (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) als Ursache von Krankheiten ausgegangen. Die Wiederherstellung der Balance erfolgte jahrhundertelang mit den Methoden der sog. heroischen Medizin, mit Abführmitteln und Einläufen, Brechmitteln und Aderlässen. Diese Auffassungen wirkten zwar noch längere Zeit weiter, verloren aber nach und nach an Bedeutung. Künftig sollte man die Krankheitsursachen bevorzugt in den Organen suchen. Auch die Behandlungsmethoden veränderten sich, sie setzten nicht mehr nur auf Diäten, Entleerungsprozeduren und Ruhe. Dafür brauchte man geschultes Personal.
Unter einer Oberin (matron oder superintendent) arbeiteten üblicherweise drei Gruppen von Frauen: die (Stations-)Schwestern (sisters oder head nurses), die Tagschwestern (day nurses) und die Nachtwachen – alle ohne einschlägige Ausbildung. Das Wenige, was sie über Pflege wussten, hatten sie sich durch learning by doing angeeignet. Der Oberin oblagen die Aufgaben einer Hauswirtschafterin, während die sisters/head nurses, oft Witwen aus dem Kleinbürgertum, näher an den Patienten waren. Tagschwestern, nicht selten frühere Dienstbotinnen, erledigten vor allem Reinigungsarbeiten. Ganz unten in der Rangfolge standen die Nachtschwestern, oft arme alte Putzfrauen, die nach getaner Arbeit die Nacht über ein Auge auf die Kranken hatten, oder auch nicht. Zur Illustration der damaligen Verhältnisse wird regelmäßig eine Romanfigur von Charles Dickens genannt: Sarah Gamp. Sie stand in der viktorianischen Zeit paradigmatisch dafür, wie man sich eine typische Krankenwärterin vorstellte. Eine Frau aus der Unterschicht, schmutzig, unmoralisch, ungebildet, die ihre Patienten bestahl und übermäßig dem Alkohol zusprach. Alkohol war prinzipiell ein Problem in den Unterschichten, und es hatte zugenommen, da Branntwein während der Industrialisierung immer billiger wurde und oft die knappen Lebensmittel ersetzen musste. Dies galt auch und besonders für die schlecht bezahlten Pflegekräfte in den Hospitälern. Betrunkene Wärterinnen waren überall zu finden, nicht selten kombiniert mit „unmoralischem Verhalten“, also Prostitution, eine weitere Möglichkeit, das tägliche Überleben zu sichern. Mit solcher Pflege waren auch die Wohlhabenden konfrontiert, denn für die Versorgung zu Hause standen ebenfalls keine geschulten Kräfte zur Verfügung. Üblich war es, dass die Pflegerin als eine Art Hausangestellte agierte. Von über 4600 im Zensus von 1841 Registrierten hatten nur etwa 600 eine Stelle in einem Krankenhaus, wo sie zumindest hoffen konnten, das eine oder andere zu lernen.
Die ersten Reforminitiativen, oft von Ärzten angestoßen, richteten sich aber zunächst nicht auf eine fachliche Unterweisung in der Pflege, sondern auf die Stärkung von Ordnung, Moral und Sauberkeit in den Hospitälern. Denn immer noch war man der Meinung, dass eigentlich jede Frau pflegen könne, wenn nur Anstand und Einstellung stimmten. In den Krankenhäusern hatten die Pflegerinnen zunächst einmal alle Reinigungsarbeiten und häuslichen Tätigkeiten zu erledigen. Dann nahmen die Anforderungen zu. So mussten Medikamente, Stärkungs-, Brech- und Abführmittel verabreicht, Klistiere appliziert, Blutegel angesetzt und Umschläge gemacht werden. Einläufe etwa hatten vor der Einführung der Infusionstherapie eine eminent wichtige Funktion für Ernährung und Flüssigkeitssubstitution, etwa Fleischbrühe mit Milch oder mit Brandy und Eigelb. Auch Arzneien wurden so verabreicht, z.B. Opium gegen Durchfall. All das war an sich schon zeitaufwendig. Als dann noch häufigere Nahrungs- und Flüssigkeitsgaben, die postoperative Überwachung, Verbände, Schmerzkontrolle, neue Hygienestandards sowie allgemein eine engmaschigere Krankenbeobachtung hinzukamen, stieg die Arbeitsbelastung beträchtlich und forderte immer spezifischere Fähigkeiten und auch immer mehr Disziplin.
Die Arbeitsethik und -kultur im Krankenhaus unterschied sich nicht von der vorindustriellen Praxis im Allgemeinen. Gehorsam, Disziplin, Selbstkontrolle und ein der kapitalistischen Produktion adäquates Zeitregiment mussten erst langsam durchgesetzt werden. Regelmäßig zu erscheinen und die Aufgaben dann auch sorgfältig zu erledigen war also keineswegs selbstverständlich. Daher betrachtete man das, was die Viktorianer moral reform oder „Hebung des Charakters“ nannten, als Grundvoraussetzung für Verbesserungen. Und gerade in der Pflege wurde diesen „moralischen Qualitäten“ lange Zeit ein viel höherer Stellenwert zugeschrieben als den Fähigkeiten des Intellekts. „Charakter“, vor allem Pünktlichkeit und Genauigkeit bei der Arbeit, war wichtiger als spezifische Kenntnisse. In diesem Sinne hat man die frühen Pflegereformen auch als Beitrag zur Kontrolle der undisziplinierten und potenziell gefährlichen Unterschichten gesehen. Ihr Ziel sei es vor allem gewesen, den Arbeiterklassen die Werte der Mittelschichten aufzuzwingen. Daneben ist allerdings unzweifelhaft, dass im frühen 19. Jahrhundert Krankenhausvorstände, Ärzte, Oberinnen und übrigens auch Patienten sich beklagten und eine bessere Pflege einforderten. Und als eine gute Pflegerin galt zunächst eine Person, die respektabel auftrat, aufmerksam gegenüber ihren Patienten war und fähig, ihren Krankensaal in guter Ordnung zu halten.
Das sog. Ward-System (ward = Krankensaal) war das erste Reformprojekt, das spezifischer auf die gestiegenen Anforderungen reagierte. Jeder Saal wurde einer Schwester unterstellt. Ihr gingen Hilfs- und Nachtschwestern zur Hand, mit entsprechender Aufgabenteilung, wobei die Hilfspflegerinnen weiterhin alle Reinigungsarbeiten zu erledigen hatten. Die zuständigen Ärzte wählten „ihre“ Schwestern aus und unterrichteten sie – nach ihrem jeweiligen Ermessen – in ihren Sälen. Die harschen Lebens- und Arbeitsbedingungen des Krankenhauspersonals änderten sich jedoch nur langsam. Mit verbesserter Unterbringung und der Einstellung zusätzlicher Reinigungskräfte hoffte man, „respektablere“ Frauen zu gewinnen, doch das Diktat der Finanzen setzte dem meist enge Grenzen. Zudem hatte das dezentrale Ward-System zahlreiche strukturelle Schwächen. Es hing in hohem Maße vom persönlichen Engagement und der Bereitschaft der Beteiligten ab. Wenn Wissen vermittelt wurde, erreichte dieses in der Regel nicht die Hilfsschwestern. Im Endeffekt gab dieses Modell den Ärzten die fast absolute Kontrolle über die Pflegerinnen in „ihren“ Sälen. Diese Position verteidigten die Mediziner vehement, als später neue zentrale Systeme bzw. Pflegeschulen eingeführt werden sollten.
Erste Ausbildungsanstrengungen konnte man in diesen Jahren ferner in katholischen Orden, anglikanischen Schwesternschaften und der protestantischen Diakonie beobachten. Überall im katholischen Europa war es nach der Französischen Revolution zu einem Aufblühen des Ordens- und Kongregationswesens gekommen, das für Frauen neue Optionen aktiver Tätigkeit im karitativen Bereich eröffnete. Die Katholikenemanzipation 1829 ermöglichte Ordensgründungen auch in England. Die erste erfolgte in London 1830, bis zur Jahrhundertmitte war ihre Zahl auf 51 und zehn Jahre später auf 118 angewachsen. Im Pflegewesen waren vor allem die irischen Sisters of Mercy aktiv. Diese Gemeinschaft ließ sich 1839 in den Londoner Slums von Bermondsey nieder und gründete dann weitere Niederlassungen. Prinzipiell eignete sich die zentralisierte Struktur der Orden gut für den Unterricht, trotzdem hatten die katholischen Schwestern nur wenig Einfluss auf die Entwicklung der Pflege in England. Zum einen arbeiteten sie meist für irische Migranten, zum anderen – und dies war wichtiger – bestanden weiterhin konfessionelle Restriktionen, die die Konvente etwa von den Londoner Lehrkrankenhäusern fernhielten. Für viele englische Protestanten war der Papst der Antichrist, und die Konvente galten als boshafte Werkzeuge Roms. Daher musste die Pflegereform in England unbedingt ein protestantisches Unterfangen sein.
Die Gründung anglikanischer Schwesternschaften schien einen Ausweg aus diesem Dilemma zu bieten. In den 1840er-Jahren entstanden in der Tat eine Reihe solcher Gemeinschaften. Verschiedene Gruppierungen sind zu unterscheiden, die wiederum die konfessionell-theologischen Spaltungen der Zeit abbildeten. Die Park Village Community in London und die Sisters of Mercy in Devonport standen der High-Church-Bewegung nahe und wurden deshalb von vielen mit Argwohn betrachtet: Man fürchtete die Rückkehr des Katholizismus durch die Hintertür der religiösen Frauengemeinschaften. Andere orientierten sich an der deutschen Diakonie. Die Quäkerin Elizabeth Fry hatte ein kurzer Besuch im Rheinland zur Gründung der Sisters of Charity inspiriert. Trotz des Namens handelte es sich dabei um keine religiöse Korporation. Als erste protestantische Organisation boten sie eine rudimentäre Pflegeausbildung.Fry wollte respektable Frauen, vorwiegend aus der Arbeiterschaft, anleiten. Es gibt keine Hinweise dafür, dass sich die früh verstorbene Fry und Nightingale jemals trafen oder korrespondierten. Die Quäkerin inspirierte aber ohne Zweifel Nightingales spätere Überlegungen.
Noch stärker galt dies für die 1848 gegründete Schwesternschaft von St. John’s House. Sie stand theologisch der Broad-Church-Bewegung nahe und hatte Ähnlichkeit mit dem Kaiserswerther Modell. Es war eine Gründung ohne Gelübde, offen für Verheiratete und Alleinstehende, die zu Hause wohnen und in Voll- oder Teilzeit arbeiten konnten. Ein weiteres Novum war ein zweijähriger Ausbildungsgang mit systematischem Unterricht, eine wichtige Zäsur auf dem Weg zu einer Professionalisierung der Pflege. Diese anglikanische Gemeinschaft erkannte als Erste, dass eine Strukturreform nottat. Nightingales späteres Pflegekonzept verdankt dem Experiment von St. John’s House und seiner Leiterin Mary Jones viel.
Die wichtigsten Anregungen kamen von der Diakonie in Kaiserswerth, die als protestantisches Modell in England eine große Anziehungskraft entfaltete. Dies galt besonders für Florence Nightingale. Im Herbst 1846 bekam sie einen von Fliedners Jahresberichten aus Kaiserswerth in die Hand, der sie in ihrem Entschluss, in die Pflege zu gehen, weiter bestärkte. Am 7. Oktober notierte sie: „Dort ist meine Heimat. Dort sind meine Brüder und Schwestern alle bei der Arbeit. Dort ist mein Herz und dort […] wird eines Tages mein Körper sein.“ (Woodham-Smith, 44) Sie würde recht behalten, aber das sollte noch dauern.