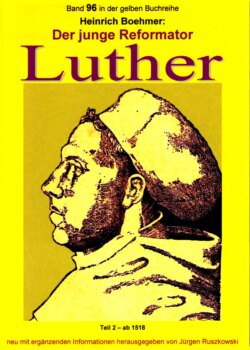Читать книгу Der junge Reformator Luther - Teil 2 – ab 1518 - Heinrich Boehmer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vor Cajetan in Augsburg
ОглавлениеJakob (Thomas) Vio aus Gaeta, genannt Cajetan (* 1469 – † 1534), gehörte zu den sehr wenigen Mitgliedern des Kardinalkollegs, die ihrer verantwortungsvollen Stellung sich ganz bewusst und daher bemüht waren, ihr Amt nach bestem Wissen und Gewissen zum Segen der Kirche zu verwalten. Als Mitglied des Dominikanerordens, dem er bereits in seinem 15. Lebensjahr sich angeschlossen hatte, war er schon in seiner Jugend mit dem System des Thomas von Aquino so vertraut geworden, dass er dasselbe bereits 1494 in einer Disputation mit dem berühmten Humanisten Pico della Mirandola nicht ohne Erfolg verteidigen konnte. Seitdem galt er als einer der Leuchten seines Ordens und stieg rasch zu dessen höchsten Würden empor. Schon mit 31 Jahren (1500) Ward er Generalprokurator und mit 32 General. Die Muße, die ihm sein Amt ließ, benutzte er dazu, seinen berühmten Kommentar zu der großen Summa des Thomas von Aquino auszuarbeiten. Erst das Konzil von Pisa (1511) veranlasste ihn, einmal für die bedrohte Autorität des Papsttums im Sinne und Geist des Thomas das Wort zu ergreifen. Er war es auch vornehmlich, der Papst Julius II. bewog, gegen jenes antipäpstliche Konzil das 5. Laterankonzil zu berufen, und er gab diesem Konzil dann auch durch die Unerschrockenheit, mit der er öffentlich für die damals sehr unpopuläre Lehre des Thomas von der Unfehlbarkeit des Papstes eintrat, die Signatur. Zum Lohn dafür ward er bei dem großen Pairsschub vom 1. Juli 1517, durch den Leo X. sich das aufsässige Kardinalskolleg unterwarf, zum Kardinal von San Sisto erhoben. Den Auftrag, als päpstlicher Legat in Deutschland für den beabsichtigten Kreuzzug gegen die Türken zu wirken, verdankte er nur dem Umstande, dass der Kardinal Farnese in letzter Stunde diese sehr wenig dankbare Mission abgelehnt hatte. Über die Angelegenheit Luthers enthielt seine Instruktion kein Wort. Sie erschien wohl, als er Anfang Juni 1518 Rom verließ, der Kurie noch nicht wichtig genug, um einen so berühmten Gelehrten und Kardinal mit ihrer Erledigung zu behelligen. Zufällig war er aber von allen Männern der Kurie der einzige, der Luther einigermaßen gewachsen war. Schon am 8. Dezember 1517 hatte er, noch ohne Kenntnis der 95 Thesen, eine Abhandlung über die Ablässe vollendet, in der er mehrfach zu ähnlichen Ergebnissen gelangt wie Luther. Er definiert wie dieser den Ablass als Erlass der von dem Beichtvater auferlegten Bußwerke und bekämpft gleich ihm die Meinung, dass man für die Verstorbenen Ablass lösen könne, ohne selbst ordnungsgemäß gebeichtet und die Absolution empfangen zu haben. Die Möglichkeit des Totenablasses bestreitet er aber ebenso wenig wie die Existenz des Schatzes der guten Werke und das Recht des Papstes, über diesen Schatz zu verfügen. Die Übereinstimmung mit Luther geht also nicht weit. Immerhin beweist die Abhandlung, dass Cajetan kein Theologe gewöhnlichen Schlages war wie Tetzel, Wimpina oder Prierias, sondern den Mut und Ehrgeiz besaß, sich über die Probleme, die ihn beschäftigten, eine eigene Meinung zu bilden. Als er dann den Auftrag erhalten hatte, Luther zu verhören, studierte er gewissenhaft sogleich die Schriften des sächsischen Mönches. Eine Frucht dieser Studien sind die vier kleinen Aufsätze, die er am 29. September, 2. und 7. Oktober in Augsburg verfasst hat. In dem ersten vom 29. September führt er gegen Luther, aber ohne ihn mit Namen zu nennen, aus, dass die Ablässe eben dadurch, dass sie die auferlegten Bußwerke erlassen, auch die diesen entsprechenden Fegfeuerstrafen tilgen. In dem zweiten Aufsatz vom 2. Oktober behauptet er gegen Luther: Es sei kein Zeichen von Unvollkommenheit, sich um Ablässe zu bemühen. Der Erlass der Strafe befähige vielmehr den Menschen, in größerem Maße als vorher heilige Werke zu tun. Ja es sei sogar verdienstlich, Ablass zu lösen, denn da der Ablass nur dem zugute komme, der im Stande der Gnade sich befinde, so sei diese Handlung ein Werk der eingegossenen Liebe und daher ein Verdienst. Wolle man sichergehen, dann tue man allerdings gut, die auferlegten Bußwerke trotz des gelösten Ablasses nicht zu unterlassen. Am 7. Oktober schrieb er dann gleich zwei Aufsätze über die von Luther angeregten Fragen. In dem ersten gibt er zu, dass es besser wäre, das Geld, was man für Ablässe ausgebe, den Armen zuzuwenden. Doch sei es keine Sünde, das Bessere wegen eines weniger guten Werkes zu unterlassen. Eine Todsünde würde die Verweigerung des Almosens an den Armen um des Ablasses willen nur dann sein, wenn der Arme sich in äußerster Not befände. In dem zweiten Aufsatze beschäftigt er sich mit der Lehre von dem Schatz der guten Werke. Er betrachtet diese Lehre nicht bloß als eine sogenannte fromme Meinung, sondern als ein vom Papst Clemens VI. in der Bulle Unigenitus vom 27. Januar 1343 in aller Form Rechtens definiertes Dogma und meint darum, sie müsse von jedermann unbedingt anerkannt werden. Es war ihm gewiss nicht verborgen, dass er mit dieser Ansicht unter den Theologen allein stand. Das hat ihn aber nicht gehindert, wenige Tage später auch an Luther mit diesem Ansinnen heranzutreten.
Er hatte sich somit in seiner Weise sehr gründlich auf das Duell mit dem „schäbigen Bettelmönch“ vorbereitet und durfte danach sich wohl mit der Hoffnung schmeicheln, die für ihn als alten Professor besonders reizvolle Aufgabe, die neue Leuchte von Wittenberg zuzudecken, zu Nutz und Frommen der Kirche wie auch seines in der Person Tetzels schwer gekränkten Ordens, glänzend zu lösen.
Luther hatte sich gleich nach Empfang des kurfürstlichen Schreibens, also wohl noch am 25. September, aufgemacht, um in Begleitung des Bruders Leonhard Beier als Socius itinerarius zunächst nach Weimar zu wandern, wo seiner genauere Weisungen warten sollten. Er fand dort den Kurfürsten, der am 22. September Augsburg verlassen hatte, schon vor, predigte am 29. September vor dem Hofe in der Schlosskapelle und erhielt dann von Spalatin einen Geleitbrief, einige Empfehlungsschreiben an Augsburger Honoratioren und ganze zwanzig Gulden Reisegeld. Am 30. September wanderte er dann weiter nach Nürnberg, wo er etwa am 4. Oktober in gänzlich abgerissenem Zustand anlagte und vergeblich nach Christof Scheurl sich umsah, der ihn auf Wunsch des Kurfürsten als Rechtsbeistand nach Augsburg weiterbegleiten sollte. Seine Stimmung war anfänglich sehr gedrückt. „Ständig“, erzählt er später, „hatte ich den Scheiterhaufen vor Augen. Nun musst du sterben, sagte ich mir.“ Aber mehr als das eigene Schicksal bewegte ihn der Gedanke: „Welch eine Schande werde ich meinen lieben Eltern sein.“ Die Brüder in den Klöstern, in denen er nach Mönchsbrauch übernachtete, trösteten ihn auch oft gar übel. In Weimar meinte der Provisor der Franziskaner, Johann Kästner: „Lieber Herr Doktor, die Welschen sind gelehrte Leute, ich fürchte, Ihr werdet Euch gegen sie nicht behaupten können und dann von ihnen verbrannt werden.“ In Nürnberg rieten ihm einige der Brüder in dem Schwarzen Kloster am Frauentor sogar, schleunigst wieder umzukehren. Solcher Kleinmut weckte in ihm jedoch stets alle guten Geister des Muts und Gottvertrauens. „Auch in Augsburg“, schreibt er aus Nürnberg nach Wittenberg, „auch mitten unter seinen Feinden herrscht Christus. Möge Christus leben und Martinus sterben... Entweder vor den Menschen oder vor Gott muss man verwerflich werden.“ Ganz leicht war es ihm aber doch nicht ums Herz, als er etwa am 5. Oktober, jetzt auch von Wenzel Link begleitet und mit Bruder Wenzels neuer Kutte köstlich angetan, seinen Stab weitersetzte. Am letzten Wandertage ward er noch von einem heftigen Magenleiden befallen, so dass er nicht mehr gehen, sondern für die letzten drei Meilen einen Wagen mieten musste. So langte er am 7. Oktober im Karmeliterhof St. Anna zu Augsburg, dessen Prior Johann Frosch ihm von Wittenberg her bekannt war, körperlich und seelisch völlig erschöpft an. Gleich nach seiner Ankunft ließ er sich durch Link im Fuggerhause bei dem Kardinal melden. Aber die sächsischen Räte Rühel und Philipp von Feilitzsch, die seinetwegen in Augsburg geblieben waren, verboten ihm, sich auf der Straße zu zeigen, ehe sie ihm von dem Kaiser und dem Rat der Stadt Geleitsbriefe verschafft hätten. Die kaiserlichen Räte ließen sich in der Tat hierzu bereitfinden, als Cajetan erklärte, sie sollten tun, was sie wollten. Inzwischen hatte das „schäbige Brüderlein“ über Mangel an Besuch nicht zu klagen. Alle Welt Wollte den neuen Herostrat sehen, der einen so großen Brand angezündet hatte. Der berühmteste Mann der Stadt, Konrad Peutinger, lud ihn sogar, um seine Neugierde zu stillen, einmal zum Essen ein. Cajetan hielt sich natürlich zurück. Aber einer der vornehmen Italiener seines Gefolges, Urban de Serralonga, ließ sich am 9. Oktober bei dem Ketzer im Karmeliterhof melden und versuchte, ihn in „echt italienischem Stile“ zu bearbeiten. Es werde ihm, meinte er, doch gewiss ein leichtes sein, die sechs Buchstaben auszusprechen: Revoco (ich Widerrufe)! Als Luther ihm entgegenhielt: „Ich muss doch unter allen Umständen meine Behauptungen rechtfertigen“, fuhr er fort: „Ei, ei, wollt Ihr ein Ringelrennen anstellen? Ihr habt die Ablassfrage viel zu ernst genommen. Warum soll man nicht Unwahres lehren, wenn die Unwahrheit nur tüchtig Geld einbringt? Über die Gewalt des Papstes darf man freilich nicht disputieren. Die ist so groß, dass der Papst heute geltende Glaubenslehren durch einen bloßen Wink außer Kraft setzen könnte. Was kümmert den Papst aber Deutschland?“ Zuletzt bemerkte er: „Meint Ihr, dass der Kurfürst Euretwegen zu den Waffen greifen würde?“ Luther: „Keineswegs.“ Urban: „Aber wo wollt Ihr dann bleiben?“ Luther: „Sub caelo“ (unter dem Himmel). Darauf hielt es Messer Urban doch für angezeigt, sich schleunigst zu entfernen.
„Die Albernheit dieses Mittelmannes hat mein Vertrauen nicht wenig gestärkt“, schreibt Luther am Tage danach an Spalatin. „Grüße die Wittenberger Freunde und sage ihnen, sie sollen, ob ich nun zurückkehre oder nicht, guten Mutes sein. Denn ich habe schon beschlossen, an ein künftiges allgemeines Konzil zu appellieren, wenn der Legat nicht mit Gründen, sondern mit Gewalt gegen mich vorgehen sollte.“ Am 11.0ktober richtete er dann eine Art Abschiedsbrief an den fast zärtlich von ihm geliebten jungen Philipp Melanchthon, der kurz zuvor in Wittenberg sein Amt angetreten hatte: „Sei ein Mann und lehre die Studenten den rechten Weg. Ich gehe jetzt, mich für Euch und sie, wenn Gott es so will, als Opfer schlachten zu lassen. Aber ich will lieber sterben und selbst, was mir am schwersten fällt, den beglückenden Verkehr mit Euch in alle Ewigkeit entbehren als widerrufen.“ Am selben Tage traf der kaiserliche Geleitbrief ein. So konnte er denn am Morgen des 12.Oktober endlich, von seinen Freunden Link und Frosch und drei anderen Mönchen begleitet, den schweren Weg nach dem Fuggerhause antreten.
* * *
Jakob Fugger der Reiche ließ von 1512 bis 1515 an der damals wichtigen Handelsstraße Via Claudia (der heutigen Maximilianstraße) neben dem damaligen Weinmarkt zwei nebeneinander liegende Häuser, eine Stadtresidenz und ein Lagerhaus, errichten. Er entwarf den Komplex selbst nach Plänen, die er auf seiner Italien-Reise notiert hatte. Der Profanbau ist das erste Bauwerk nördlich der Alpen, das im Stil der italienischen Renaissance errichtet wurde. Weitere angrenzende Häuser wurden ab 1517 hinzuerworben und in den Komplex dieses Stadtpalastes integriert.
Die äußere Fassade, eine der längsten in der Straße, zeugte vom Reichtum der Fugger, da damals die Gebäudesteuer nach der Länge der Frontfassade berechnet wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuggerh%C3%A4user
Fuggerhaus – Adlertor
Von Emkaer - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9829219
* * *
„Man hatte mir beigebracht“, erzählt er später, „wie ich mich gegen den Kardinal“, der von einem großen Schwarm neugieriger Italiener umgeben war, „benehmen sollte. Zuerst warf ich mich vor ihm aufs Angesicht nieder. Darauf, als er mich aufstehen hieß, richtete ich mich nur bis zu den Knien auf. Erst auf einen erneuten Wink stand ich ganz auf. Ich entschuldigte mich alsdann, dass ich erst den Geleitsbrief abgewartet hatte, und versicherte, dass ich von ihm nur die Wahrheit hören wolle.“ Cajetan erwiderte darauf einige freundliche und verbindliche Worte, wie sie dem gut erzogenen Italiener jederzeit zu Gebote stehen.
Luther in Augsburg vor Cajetan
Aber dann erklärte er kurz: Dreierlei habe er im Auftrage Seiner Heiligkeit von ihm zu fordern: „1. Bereue Deine Irrtümer und widerrufe sie, 2. versprich, sie nicht mehr zu lehren, 3. enthalte dich aller Umtriebe, durch die der Friede der Kirche gestört werden könnte.“ Luther bat darauf, ihm seine Irrtümer anzugeben. Der Kardinal wies ihn zunächst auf die 58. der 95 Thesen hin, in der er behauptet hatte: Der Schatz der Kirche ist nicht identisch mit den Verdiensten Christi und der Heiligen. Diese Ansicht werde zur Genüge, führte Cajetan dann aus, durch die Dekretale Unigenitus widerlegt. Alsdann hob er aus den Resolutionen zur 7. These den Satz heraus: Nicht das Sakrament, sondern der. Glaube rechtfertigt. Diese Behauptung ist, meinte er, neu und falsch. Als Luther versetzte, in diesem Punkte könne er nicht nachgeben, herrschte er ihn an: „Das musst du, ob du willst oder nicht, noch heute widerrufen. Sonst werde ich um dieser einen Stelle willen alles, was du sonst sagst, verdammen!“ Die anwesenden Italiener begleiteten diese Worte „nach ihrer Art“ mit höhnischem Gelächter. Zu dem ersten Punkte erklärte Luther sodann, die Delcretale sei ihm keine Autorität, weil sie die Heilige Schrift missbrauche und deren Worte verdrehe, außerdem auch nur die Ansichten des Thomas von Aquino wiederhole. „Ich gebe daher den Bibelstellen, die ich in den Thesen zitiere, unbedingt den Vorzug.“ Das ging Cajetan wider die Natur. Obwohl er nicht mit dem „Brüderlein“ disputieren sollte und wollte, konnte er sich doch nicht enthalten, ihn zu belehren: Der Papst steht über dem Konzil und der Heiligen Schrift. Als Beweis hierfür zitierte er die Verdammung des Baseler Konzils durch Nikolaus V. „Du bist auch ein Gersonist“, fuhr er fort. „Alle Anhänger Gersons sind ebenso verdammt wie Gerson selbst.“ Als Luther ihn daraufhin an die erst jüngst getätigte Appellation der Universität Paris an ein künftiges Konzil zu erinnern wagte, grollte er: „Dafür werden die Pariser noch büßen müssen!“ Danach kam es, wie Luther meint, noch zu einem konfusen Hin- und Herreden über die Gnade Gottes. Nichts von dem, was Luther vorbrachte, ließ Cajetan gelten. Hielt er ihm eine Bibelstelle vor, so lachte er wohl gar hart auf. Dazwischen herrschte er ihn immer wieder an: „Widerrufe, erkenne deinen Irrtum. Das und nichts anderes ist der Wille des Papstes!“ Da bei diesem Hin- und Herreden doch nichts herauskam, bat Luther schließlich um Bedenkzeit und zog mit seinen Freunden wieder von dannen. Dass Cajetan sich streng an die Zusagen gehalten habe, die er Friedrich gegeben hatte, kann man danach kaum behaupten. Er hatte zwar sehr freundlich-väterlich angefangen, aber dann gar bald von seinem Temperament sich hinreißen lassen. Diesen Eindruck müssen auch Wenzel Link und Johann Frosch gehabt haben, denn sonst hätten weder die sächsischen Räte noch der überaus ängstliche Dr. Peutinger, noch auch der zu Luthers Freude eben erst in St. Anna eingetroffene, äußerst vorsichtige Dr. Staupitz sich keinesfalls bereitfinden lassen, ihn am Morgen des 13. Oktober zu der zweiten Audienz ins Fuggerhaus zu begleiten. Cajetan sah sich lächelnd diesen stattlichen Aufzug an. Lächelnd nahm er auch die förmliche Erklärung (Protestatio) entgegen, die Luther darauf in Gegenwart dieser Zeugen vorlas: solange er noch nicht überführt und widerlegt sei, könne er nicht zu einem Widerruf gezwungen werden. Er sei sich nicht bewusst, etwas gegen die Bibel, die Kirchenväter, die Dekretalen und die Vernunft gelehrt zu haben. Da er aber, wie jeder Mensch, irren könne, so unterwerfe er sich dem Urteil der legitimen Kirche und erbiete sich, sei’s in Augsburg, sei’s anderwärts, öffentlich über seine Sätze zu disputieren. Sei das Cajetan nicht angenehm, so sei er bereit, auf seine in der ersten Audienz geäußerten Einwände schriftlich zu antworten und die Entscheidung über seine Lehren dann den Universitäten Basel, Freiburg, Löwen und, falls das noch nicht genüge, auch noch der Universität Paris zu überlassen. Danach begann der Kardinal wie ein alter Professor, der nicht von seinem Lieblingsthema loskommen kann, wieder über die Dekretale Unigenitus zu sprechen. Aber Luther erwiderte ihm, er wolle ihm schriftlich antworten, mit Worten hätte er schon gestern genug mit ihm gestritten. Diese Bemerkung nahm Cajetan sehr übel auf. „Mein Sohn“, sagte er, „ich habe nicht mit dir gestritten und will auch jetzt keineswegs mit dir streiten. Nur aus Rücksicht auf Seine Durchlaucht den Kurfürsten Friedrich will ich dich väterlich und gütig verhören und dich wieder mit Seiner Heiligkeit zu versöhnen suchen.“ Als darauf jedoch auch Staupitz ihn ersuchte, Luther eine schriftliche Antwort zu gestatten, gewährte er ihm diese Bitte endlich in Gnaden, ja er entließ ihn mit den Worten: „Ich werde dich sehr gerne hören und dann alles wie ein Vater, nicht wie ein Richter erledigen.“
In St. Anna angelangt, warf Luther sofort in fliegender Eile eine ausführliche Rechtfertigung der beiden von dem Kardinal beanstandeten Punkte aufs Papier. Das Schriftstück füllt im Drucke fast dreiviertel Bogen. Mit dieser Apologie erschien er, von den sächsischen Räten Rühel und Feilitzsch begleitet, am 14. Oktober morgens zum dritten Mal im Fuggerhause. Was hatte die Räte veranlasst, mit ihm zu gehen? Der Eindruck, dass Cajetan seine Zusagen nicht halte, und die Absicht, ihn daran erneut zu erinnern. Er nahm denn auch Luthers Schrift nur mit verächtlichen Worten und Gesten entgegen, versprach aber doch, sie nach Rom zu schicken. Dann begann er wieder zu donnern: „Widerrufe!“ und in langer, leidenschaftlicher Rede vor allem über die Dekretale Unigenitus sich zu verbreiten. Wohl zehnmal versuchte Luther ihn zu unterbrechen, aber er wurde immer wieder niedergedonnert, bis endlich auch er laut und lauter zu reden anhub, wobei er einmal, was ihm sofort scharf verwiesen wurde, versehentlich den Kardinal mit „Ihr“ statt mit „Eure Väterlichkeit“ anredete. „Wenn in der Dekretale wirklich steht, der Schatz der Kirche ist das Verdienst Christi, so will ich widerrufen“, sagte er schließlich. Da rieb sich der kleine Mann, vergnügt lachend, die Hände. Hastig griff er nach einem vor ihm liegenden Buche und las daraus heftig schnaubend die Bulle vor bis zu der Stelle: Christus hat (durch sein Leiden) der streitenden Kirche einen Schatz erworben. „Dies Wort erworben“, rief Luther, „ist zu beachten. Wenn Christus durch seine Verdienste einen Schatz erworben hat, so heißt das nicht: seine Verdienste sind ein Schatz, sondern der Schatz besteht in dem, was er durch seine Verdienste verdient hat, d. h. in der Vergebung der Sünde.“ Da wurde der Kardinal verwirrt. Um seine Verlegenheit zu verbergen, sprang er schnell auf ein anderes Thema über. Aber Luther hielt ihn fest. Gewiss recht unehrerbietig, brach er in die Worte aus: „Eure Väterlichkeit meinen doch nicht, dass wir Deutschen uns nicht auf die Grammatik verstehen. Ein Schatz sein ist etwas anderes als einen Schatz erwerben.“ Daraufhin sagte Cajetan: er wolle ihn aus der Bibel widerlegen, und hielt ihm zunächst vor: Die Bibel ist nicht irrtumsfrei. Matthäus 27, 9 wird dem Propheten Sacharja eine Stelle zugeschrieben, die tatsächlich von Jeremia herrührt. Aber mit der Bibel konnte er nichts Rechtes anfangen. Daher kam er wieder auf die Dekretale Unigenitus zurück. „Widerrufe!“, schloss er, fügte aber noch hinzu: „Ich bin vom Papst ermächtigt, über dich und alle deine Gönner den Bann und über alle Orte, die dich aufnehmen, das Interdikt zu verhängen.“ Als auch diese Drohung nicht zu verfangen schien, erhob er sich endlich und rief: „Geh und komme mir nicht wieder vor die Augen, es sei denn, dass du widerrufen willst!“ „Seine Zuversicht war also gebrochen, und während er noch einmal schrie: ,Widerrufe!’, wandte ich mich zum Gehen“, schreibt Luther noch am selben Tage an Spalatin. Aber Cajetan hatte gerade den entgegengesetzten Eindruck. Er meinte, Luthers Zuversicht habe zu wanken begonnen, und beschloss daher sogleich, noch etliche andere Mittel anzuwenden, um ihn vollends mürbe zu machen. In dieser Absicht bestellte er nach dem Essen (10 Uhr) Staupitz und Link zu sich ins Fuggerhaus. Stundenlang verhandelte er mit den beiden Brüdern. Mit viel „hübschen Worten“ suchte er Staupitz zu bereden, Luther zu einem einfachen Widerrufe zu bestimmen, und versicherte ihm dabei: Luther habe kaum einen besseren Freund als ihn. Staupitz erklärte ihm darauf: Er habe Luther immer zugeredet und tue es noch heute, sich demütig dem Spruch der Kirche zu unterwerfen, aber er sei Bruder Martin weder an Gelehrsamkeit noch an Geist gewachsen. Er, der Kardinal, könne dagegen als Statthalter des Papstes auftreten und sei daher der einzige am Platze, der mit dem „Brüderlein“ fertig werden könne. Er zog sich also sehr geschickt mit einer wohlberechneten Verbeugung vor dem Statthalter des Papstes aus der Schlinge, so dass dieser ihm wegen seiner Weigerung nicht einmal böse sein konnte. Aber von einer Wiederaufnahme des Verhörs wollte Cajetan nichts wissen. „Ich will nicht mehr mit diesem Bruder sprechen“, sagte er, wohl in einer Anwandlung neapolitanischen Aberglaubens, „denn er hat tiefliegende Augen und daher wunderliche Phantasien in seinem Kopfe.“ Er erklärte sich nur bereit, die Artikel aufzusetzen, die Luther widerrufen solle. Er hielt jedoch für gut, sich damit nicht zu beeilen. Je länger der Bruder warten musste, dachte er offenbar, um so rascher werde er mürbe werden. Luther schrieb auf die Kunde hiervon sogleich an Spalatin: „Ich werde nicht eine Silbe widerrufen und meine heute abgegebene Rechtfertigungsschrift drucken lassen, damit er durch die ganze christliche Welt widerlegt wird, wenn er auch fernerhin so gewalttätig mit mir umgeht, wie er begonnen hat. Auch bereite ich eine Appellation vor.“ Nach Wittenberg aber meldet er: „Der Kardinal ist vielleicht ein tüchtiger Thomist, aber kein klarer christlicher Denker und daher zur Behandlung dieser Sache ebenso geschickt wie der Esel zum Harfenschlagen.“ Während er in St. Anna dieses wenig schmeichelhafte Urteil über Cajetan zu Papier brachte, stand im Fuggerhause Bruder Link vor dem kleinen Gewaltigen. Ob er aus eigenem Antriebe dahin gegangen oder von Staupitz geschickt oder von Cajetan direkt zitiert war, wissen wir nicht. Jedenfalls glaubte der Kardinal, als er sich wieder verabschiedete, das Spiel gewonnen zu haben. Er erklärte Bruder Wenzel zunächst: von der Frage, ob der Glaube allein rechtfertige, wolle er ganz absehen, wenn Luther nur seine Äußerung über den Schatz der Kirche widerrufen würde. Er beabsichtige, fuhr er weiter beruhigend fort, Luther jetzt nicht gleich in den Bann zu tun, sondern wolle erst weitere Befehle aus Rom abwarten, wohin er bereits Luthers Rechtfertigungsschrift durch einen Eilboten geschickt habe. Bruder Wenzel billigte, behauptet er später, durchaus seine Behandlung der Sache. Link hat sich also anscheinend im Verlaufe des Gesprächs noch konzilianter als Staupitz geäußert. Danach kann man es doch begreifen, dass Cajetan jetzt die Katze im Sacke zu haben glaubte und zu seiner Umgebung triumphierend sagte: „Dieser Bruder (Luther) hätte mit frischeren Eiern auf den Markt kommen müssen.“
Aber Staupitz war doch durchaus nicht mit seiner Behandlung der Sache so einverstanden wie, wenigstens dem äußeren Anschein nach, Bruder Wenzel. Er riet Luther zwar ebenso wie Link, noch einmal möglichst höflich und demütig an den Kardinal zu schreiben, sich wegen der unbescheidenen und heftigen Äußerungen, die er in seinen Schriften wider den Papst getan habe, zu entschuldigen und zu versprechen, dass er das gern auch öffentlich auf allen Kanzeln wiederholen wolle und entschlossen sei, sich in Zukunft zu bessern, ja er drang in ihn, es sich doch noch einmal gründlich zu überlegen, ob sein Gewissen ihm wirklich nicht den geforderten Widerruf zu leisten erlaube. Aber über das herrische und gewalttätige Verfahren Cajetans gegenüber seinem Schützling war er so entrüstet, dass er am 15.0ktober an Kurfürst Friedrich schreibt: „Der Legat von Rom benimmt sich, wie man, Gott sei’s geklagt, es daselbst zu tun pflegt: gibt hübsche, aber leere und eitle Worte. Sein Gemüt rastet allein darauf, dass Magister Martinus widerrufe. Er sucht hin und her, wie er das unschuldige Blut vertilgen und zum Widerruf zwingen könnte. Er sagt auch, es sei vom General der Augustiner ein Schreiben gegen Martinus schon im Lande. Peutinger behauptet, das sei auch gegen mich gerichtet. Man solle uns beide in den Kerker werfen und Gewalt gegen uns üben.“ Cajetan war also so unvorsichtig gewesen, gegen Staupitz etwas von dem Haftbefehl Gabriel Voltas verlauten zu lassen, der ja durch das päpstliche Breve vom 11. September nicht ausdrücklich aufgehoben war und daher jederzeit vollstreckt werden konnte. Danach zweifelte Staupitz nicht, dass er sowohl ihn wie Luther zu verderben entschlossen sei, und traf demgemäß seine Anstalten. Während die kleine Eminenz im Fuggerhause über einem neuen Aufsatz gegen Luther brütete, lief er in der ganzen Stadt herum, um ein Darlehn für Dr. Martinus aufzutreiben, denn in Deutschland, meinte er, könne Luther nicht mehr bleiben. Er müsse vielmehr jetzt sogleich sich nach einem Orte wenden, wo ihn der Arm des Papstes nicht erreichen könne, nämlich nach Paris. Es fand sich jedoch leider unter seinen Bekannten in Augsburg keiner, der so viel Geld, als er begehrte, bereitliegen hatte. Gleichwohl hielt er es doch für gut, Luther jetzt schon, damit er ohne Rücksicht auf den Orden tun und lassen könne, was er wolle, aus seiner Obedienz zu entlassen, d. h. ihn von allen Pflichten gegen den Orden förmlich zu entbinden. Alsdann verschwand er am 16. Oktober, ohne sich von Cajetan zu verabschieden, mit Bruder Wenzel aus Augsburg. Am selben Tage legte Luther in St. Anna mit Wissen und Rat der beiden sächsischen Räte in aller Form Rechtens vor Notar und Zeugen Berufung ein von dem schlecht unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Papst (a papa male informato ad papam melius informandum), d. h. er lehnte die beiden in der Vorladung vom Juli genannten römischen Richter Ghinucci und Prierias wegen Befangenheit und mangelnder Sachkenntnis ab und ersuchte um Vernehmung durch gelehrte päpstliche Kommissare an einem sichereren Ort als Rom, wo sogar der „beste Papst“ Leo voriges Jahr beinahe einem Mordanschlag zum Opfer gefallen wäre. Auch sei es ihm schon wegen seiner schwachen Leibesbeschaffenheit nicht möglich, jetzt eine so weite Reise zu unternehmen. Am 17. Oktober schrieb er dann in dem ihm von Staupitz und Link empfohlenen Sinne an Cajetan. Dieser Brief machte mit einem Schlage den frohen Erwartungen des Kardinals ein Ende, denn er bekennt darin frank und frei, sein Gewissen erlaube ihm nicht, zu widerrufen; weder durch das Gebot noch den Rat eines anderen noch durch die Rücksicht auf eine andere Person könne und dürfe er aber sich bestimmen lassen, etwas wider das Gewissen zu reden oder zu tun. Da man inzwischen auch im Fuggerhause erfahren hatte, dass Staupitz und Link spurlos aus Augsburg verschwunden seien, so war Cajetan jetzt allem Anschein nach völlig im unklaren, was er tun solle. Er machte es daher wie alle Leute in solcher Lage und Stimmung: er tat vorläufig gar nichts. Auch auf seinen zweiten Brief vom 18. Oktober, in dem Luther sich in aller Form von ihm verabschiedete und seine bevorstehende Abreise ankündigte, gab er keinen Laut von sich. Dies Stillschweigen ward den sächsischen Räten und Luthers Augsburger Freunden allmählich unheimlich. Am 20. Oktober beschlossen sie daher, ihren Schützling schleunigst aus Augsburg fortzuschaffen. Als die Nacht hereingebrochen war, öffnete ihm der Domherr Langenmantel ein Pförtchen der Stadtmauer, durch das er unerkannt entkommen konnte. Draußen wartete auf ihn schon ein alter städtischer Ausreiter mit einem zweiten Pferd, auf das er sich, so, wie er war, nur in Kniehosen, Socken, ohne Messer, Wehr und Sporen, schwingen musste. Da das Ross unglücklicherweise ein sehr harter Traber war und sein Begleiter unterwegs nicht ein Wort sprach, so dachte er noch nach Jahren mit Schrecken an diesen Ritt zurück. In Monheim, wo er zuerst haltmachte, konnte er zwar absteigen, aber nicht stehen, und fiel daher gleich wie tot in die Streu. Am 22. Oktober ritt er dann weiter nach Nürnberg, wo er von Willibald Pirckheimer mit großen Ehren bewirtet wurde und unter anderen auch den berühmten Albrecht Dürer kennenlernte.
* * *
Willibald Pirckheimer, porträtiert von Albrecht Dürer (1503)
Willibald Pirckheimer (auch Bilibald Pirkheimer, lateinisch Bilibaldus; * 4. Dezember 1470 in Eichstätt; † 22. Dezember 1530 in Nürnberg) war ein deutscher Renaissance-Humanist. Er war ein Freund Albrecht Dürers und Berater Kaiser Maximilians I.
https://de.wikipedia.org/wiki/Willibald_Pirckheimer
* * *
Noch vor seiner Abreise erreichte ihn hier ein Brief Spalatins mit einer Kopie des päpstlichen Breve vom 23. August, das seine sofortige Verhaftung befahl. In dem Gefühl, einer großen Gefahr entronnen zu sein, ritt er dann am 24. Oktober weiter gen Norden. Etwa am 26. Oktober begegnete er bei Gräfenthal unweit Saalfeld dem Grafen Albrecht von Mansfeld (Albrecht VII., Graf von Mansfeld war ein deutscher Adliger aus dem Haus der Grafen von Mansfeld, der aufgrund seines Eintretens für die Reformation über die Grafschaft Mansfeld hinaus von Bedeutung war.). Der lachte nicht wenig seiner Reiterei und lud ihn gleich freundlich zu Gaste. Von da ging die Reise dann das Saaletal abwärts nach Weißenfels und Leipzig. Hinter Leipzig verirrte er sich, fand sich aber doch schließlich wieder zurecht, so dass er am Jahrestage der Thesen, Sonntag, den 31. Oktober, morgens glücklich Kemberg erreichte, wo er sogleich – „so heilig war er damals noch“ – eine Messe las. Von da gelangte er dann im Laufe des Nachmittags nach Wittenberg. „Mir ist so froh und friedvoll zumute“, schreibt er am Abend an Spalatin, „dass ich mich wundere, was für ein Wesen so viele große Leute von meinen Kämpfen und Leiden machen.“ Wenige Tage später hatte er schon einen für die Öffentlichkeit bestimmten Bericht über das Augsburger Verhör mit urkundlichen Beilagen (Acta Augustana) fertig, der aber erst Anfang Dezember erscheinen durfte. Indes, er war eigentlich heimgekehrt, um Abschied zu nehmen. Sobald die erwartete Bannbulle eintraf, wollte er, wie ihm Staupitz geraten hatte, fort nach Frankreich. Seinem Fürsten wünschte er dann jedenfalls unter keinen Umständen mehr zur Last zu fallen.
Inzwischen hatte aber auch Cajetan endlich gesprochen.