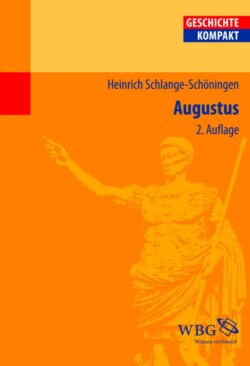Читать книгу Augustus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Die Grundlinien der Ereignisgeschichte
ОглавлениеIn der Phase seines Machtgewinns (bis zur Schlacht von Actium im Jahr 31 v. Chr.) gehörte Octavian noch ganz der blutigen Epoche der „römischen Revolution“ (Theodor Mommsen) an; seine politischen und militärischen Maßnahmen wiederholten vieles von dem, was Rom unter den Gracchen, unter Sulla, Pompeius und Caesar erlebt hatte. Deshalb ist es sinnvoll, im Anschluss an die Darstellung der strukturellen Merkmale der Krise der späten römischen Republik die Ereignisgeschichte der späten Republik in ihren wichtigsten Etappen in Erinnerung zu rufen.
Tiberius Gracchus
Als der Volkstribun Tiberius Gracchus im Jahr 133 v. Chr. mit einem Gesetzesantrag, den ager publicus neu zu verteilen, am Veto seines Amtskollegen scheiterte, ließ er ihn gegen alle Gepflogenheiten seines Amtes entheben. Tiberius Gracchus konnte daraufhin das Ackergesetz durchbringen, doch haftete von nun an allen seinen Maßnahmen der Makel des Amtsmissbrauches an. Die neuen Bauernstellen sollten aus dem an Rom gefallenen Erbe des Herrschers über Pergamon, Attalos’ III., finanziert werden, obwohl solche Entscheidungen in die Kompetenz des Senats fielen. Fragwürdig war auch die beabsichtigte Wiederwahl des Tiberius zum Volkstribun des Jahres 132 v. Chr., die zwar nicht ausdrücklich verboten, aber doch auch nicht traditionskonform war. Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, dass die Angehörigen der Nobilität, die gegen die Reformpolitik Stimmung machten, in Tiberius einen gefährlichen Umstürzler sahen und behaupteten, er wolle vermittels einer volksfreundlichen Politik eine herausgehobene, vielleicht gar königsähnliche Stellung erlangen. Hier begegnet man bereits einem Vorwurf, der später wieder gegen Caesar erhoben wurde und dem Augustus bei seinen Überlegungen, wie er seine Herrschaft gestalten sollte, auszuweichen suchte. Gegen Tiberius Gracchus ließ sich mit Vorwürfen dieser Art erfolgreich Stimmung machen. Bei einer Volksversammlung auf dem Kapitol im Jahr 133 v. Chr. kam es zu einem blutigen Tumult. Senatoren unter der Führung des Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio erschlugen Tiberius Gracchus; seine Anhänger wurden wenig später als Volksfeinde verurteilt. Während der folgenden Jahrzehnte ging der Kampf um die Ackerreform weiter. Dabei wurden immer wieder herkömmliche politische Verfahrensweisen gewaltsam außer Kraft gesetzt. Das Ackergesetz des Tiberius Gracchus war trotz seiner Ermordung gültig geblieben. Eine Kommission, die mit der Umsetzung betraut war, wurde jedoch nicht nur durch die senatorische Opposition behindert; auch die Honoratioren in den Städten der italischen Bundesgenossen, die ihrerseits einen Teil des ager publicus im Besitz hatten, versuchten die Landverteilung zu verhindern.
Gaius Gracchus
Gaius Gracchus setzte in den Jahren 123 und 122 v. Chr. die Politik seines Bruders fort. In Ergänzung zur Ackerreform verfolgte er weitere Maßnahmen, um die Notsituation der armen Bevölkerung Roms zu lindern. So sollte die Getreideversorgung des römischen Plebs durch die Festsetzung des Getreidepreises sichergestellt werden. Den verarmten Bürgern wurde auch die Möglichkeit eröffnet, in den Heeresdienst zu treten, da die Ausrüstung der Soldaten von nun an vom Staat gestellt werden sollte. Außerdem plante Gaius Gracchus die Gründung neuer Kolonien. Trafen bereits diese Maßnahmen auf den Widerstand des Senats, so wurde die Konfrontation noch dadurch verschärft, dass Gaius Gracchus die Gerichte, die über die Handlungen der senatorischen Provinzstatthalter zu befinden hatten, mit Angehörigen des zweiten Standes, des Ritterstandes, besetzen ließ. Mit seinem allerdings vergeblichen Vorhaben, den Bundesgenossen das Bürgerrecht zu geben, verärgerte Gaius Gracchus große Teile des römischen Senats noch zusätzlich. Seine entschiedenen, kompromisslosen Reformversuche führten wenig später zu einer heftigen Reaktion der konservativen Senatsaristokratie. Nachdem Gaius Gracchus für 122 v. Chr. zum zweiten Mal zum Volkstribunen gewählt worden war, verließ er Rom, um in Afrika die Kolonie Iunonia zu gründen. Diese Maßnahme wollte der Senat ein Jahr später rückgängig machen, was in Rom zu Tumulten führte, auf die der Senat wiederum mit der Verkündung des Ausnahmezustandes reagierte. Das senatus consultum ultimum erlaubte den Konsuln, mit allen Mitteln gegen Gaius Gracchus und seine Anhänger vorzugehen. Während sich Gaius in auswegsloser Lage das Leben nahm, wurden dreitausend seiner Anhänger vor Gericht gestellt und hingerichtet. Wieder hatte sich gezeigt, dass eine Reformpolitik nicht konsensfähig war, sondern in Rom zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen und zu einer Siegerjustiz führte, die auf die physische Vernichtung der gegnerischen Seite zielte. Um für die Zukunft jegliche Agrarreform zu verhindern, die den Besitz der Senatoren hätte antasten können, wurde einige Jahre später, 111 v. Chr., die lex Thoria verabschiedet, durch die das öffentliche Land denjenigen als Privatland überlassen blieb, die es bereits besetzt hatten.
Marius
Gleichwohl wurde die Frage der Landversorgung bald wieder aktuell, und diesmal verfügte Marius, der seit 107 v. Chr. Jahr für Jahr, unter Verletzung eines seit 151 v. Chr. bestehenden Verbots, Konsul geworden war, auch über die militärische Macht, um seine Forderungen durchzusetzen. Marius war zunächst in das führende Amt gewählt worden, um den Krieg gegen den numidischen König Jugurtha zu führen, der Rom 109 v. Chr. eine schwere Niederlage beigebracht hatte. Der Gesetzgebung des jüngeren Gracchus entsprechend nahm Marius erstmals in größerer Zahl Freiwillige in sein Heer auf, die über keinen Besitz verfügten. Aus dem einstmals für einzelne Feldzüge zusammengerufenen Bürgerheer wurde auf diese Weise allmählich ein Berufsheer, das seinem jeweiligen Feldherrn, der für die spätere Versorgung seiner Soldaten zuständig wurde, eng verbunden war.
Kimbern und Teutonen
Nachdem der Krieg mit Jugurtha (111–105 v. Chr.) durch Sulla entschieden worden war, der als Quaestor bei Marius diente und bald zu seinem schärfsten politischen Gegner werden sollte, fiel Marius eine andere militärische Aufgabe zu: Er musste die Bedrohung Roms durch die Kimbern und Teutonen abwenden, die im Jahr 105 v. Chr. ein römisches Heer vernichtet hatten. Zwei große militärische Erfolge in den Jahren 102 und 101 v. Chr. beseitigten die Gefahr, und als Retter Roms wurde Marius zum sechsten Mal zum Konsul gewählt. Bereits 103 v. Chr. hatte der Volkstribun Lucius Appuleius Saturninus eine Landverteilung an die Veteranen des Marius aus dem Jugurthinischen Krieg erzwungen. 100 v. Chr. musste dann für die Veteranen gesorgt werden, die an dem Krieg gegen die germanischen Völker teilgenommen hatten. Wieder brachte Saturninus für Marius ein entsprechendes Gesetz ein, gegen das diesmal die plebs urbana protestierte, da zwar die Bundesgenossen in die Landverteilung einbezogen werden sollten, nicht aber die Bevölkerung Roms. Das Problem des Umgangs mit den Bundesgenossen eskalierte einige Jahre später, nachdem der Volkstribun M. Livius Drusus, der sich für die Aufnahme der Bundesgenossen in den römischen Bürgerverband eingesetzt hatte, ermordet worden war (91 v. Chr.). Gegen eine Vielzahl aufständischer italischer Gemeinden musste Rom drei Jahre lang Krieg führen, und es gelang Rom nur durch die Gewährung des Bürgerrechts, die feindliche Front aufzubrechen.
Optimaten und Popularen
Die genannten, langwierigen Konflikte um Landverteilungen, Bürgerrechtsvergabe, Koloniegründungen, Heeresreform und ritterliche Gerichte hatten nicht nur zu Spannungen zwischen der Senatsaristokratie und dem Ritterstand geführt, sondern auch die Senatoren dauerhaft in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite standen die „Optimaten“, die sich als Garanten traditioneller Verfassungsformen ausgaben, und auf der anderen Seite die „Popularen“, die ihre politischen Ziele als Fürsprecher der Interessen der plebs urbana verfolgten. Die Ereignisgeschichte von den Reformen der Gracchen bis zum Machtgewinn Caesars zeigt einen ständigen Wechsel in der Vormacht der einen oder der anderen Seite. Dabei darf man jedoch kein Parteiprogramm erwarten; die Zugehörigkeit eines Politikers zu einem der beiden Lager sagt nur etwas über die grobe Richtung seiner politischen Vorstellungen aus.
Bürgerkrieg
Nach den Gracchen haben die Spannungen zwischen Optimaten und Popularen mit den Kämpfen zwischen Sulla und Marius ihren zweiten Höhepunkt erreicht. Schon bei ihnen zeigt sich, wie die politische Konfrontation auch aus dem jeweiligen Anspruch auf größere dignitas gespeist wurde, war doch Marius der erfolgreiche Feldherr gegen die Kimbern und Teutonen, Sulla aber der Bezwinger Jugurthas. Nach dem Ende des Bundesgenossenkriegs ging der Streit zwischen den beiden Männern und ihrem jeweiligen Anhang in eine neue Runde: Im Jahr 88 v. Chr. konnte der Volkstribun Publius Sulpicius Rufus, der über eine große, bewaffnete Gefolgschaft verfügte, durchsetzen, dass das Kommando im Krieg gegen Mithridates auf Marius übertragen wurde, obwohl vorher bereits der amtierende Konsul Sulla mit dieser Aufgabe betraut worden war. Als der Senat daraufhin den Notstand ausrief, griff Sulpicius zur Gewalt, der zahlreiche Senatoren zum Opfer fielen. Sulla konnte gerade noch rechtzeitig aus Rom entkommen und zu den Legionen gelangen, die im Süden Italiens, bei Nola, zum Kampf gegen Mithridates bereitstanden. Dass Sulpicius durch einen Volksbeschluss den Konsul seines militärischen Kommandos hatte entsetzen lassen, obwohl solche Entscheidungen nur dem Senat zustanden, stellte nicht nur eine offenkundige Gesetzesverletzung, sondern auch einen persönlichen Angriff gegen Sulla dar, der sich auf eine ehrverletzende Weise gegenüber seinem Konkurrenten Marius zurückgesetzt sah. Auf diese Provokation reagierte Sulla mit einem Schritt, der den politischen Kampf weiter eskalieren ließ: Er führte seine Legionen gegen Rom und eroberte die Stadt (88 v. Chr.). Zum ersten Mal war damit Rom, an dessen pomerium (der Stadtgrenze) doch alle militärische Befehlsgewalt zu enden hatte, der Herrschaft eines Heerführers unterworfen, womit sich Sulla über eine wichtige sakrale Tradition hinweggesetzt hatte. Seinen kurzen Aufenthalt in Rom nutzte Sulla dazu, Marius und seine Anhänger ächten zu lassen, und auch die Beschlüsse des Volkstribunen Sulpicius, der die italischen Neubürger gegen den Willen der Optimaten in alle 35 römischen Tribus hatte einschreiben lassen, wurden aufgehoben.
Sullas Marsch auf Rom war der Auftakt zu einer Reihe solcher Angriffe auf das Zentrum des Reiches. Nachdem Sulla Rom wieder verlassen hatte, um den Krieg im Osten zu führen, wurde Lucius Cornelius Cinna, ein politischer Gegner Sullas, den das Volk zum Konsul gewählt hatte, vom Senat aus der Stadt vertrieben, weil auch er als Fürsprecher der italischen Neubürger aufgetreten war. Doch auch Cinna kehrte mit einem Heer nach Rom zurück, um gemeinsam mit Marius eine Schreckensherrschaft zu errichten. Sulla wurde in Abwesenheit zum Staatsfeind erklärt, was ihn allerdings nicht daran hinderte, während der folgenden Jahre den Krieg gegen Mithridates zu führen. Im Jahr 83 v. Chr. kehrte Sulla nach Italien zurück, um mit Hilfe seiner Soldaten seine Ehre wiederzuerlangen. Ein Marsch gegen Rom war nun schon nichts Neues mehr, aber einen Kampf römischer Heere gegeneinander hatte man in der Geschichte Roms noch nicht gesehen. Im November 82 v. Chr. konnte Sulla mit einer Entscheidungsschlacht vor den Toren Roms den Bürgerkrieg gegen die Popularen für sich entscheiden (Schlacht am Collinischen Tor). Unter Sullas Herrschaft wurde in größerem Maße als je zuvor politisch gemordet; seine Rachelust führte zum Massaker an Hunderten römischer Senatoren und Ritter und setzte sich in Form der Proskriptionen noch über Monate fort. Senatoren und Ritter, die als Anhänger von Marius und Cinna galten, wurden öffentlich benannt und für vogelfrei erklärt; an ihrem Vermögen bereicherten sich die Gefolgsleute Sullas, darunter auch M. Licinius Crassus.