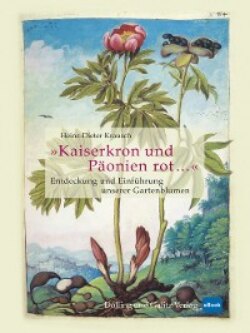Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 70
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCrocus L. Krokus
Crocus vernus (L.) Hill Frühlings-Krokus, Clusius 1601
Die etwa 80 Arten umfassende Gattung Crocus ist vor allem im Mittelmeergebiet und Vorderasien beheimatet, nur C. albiflorus Kit. ex Schult. kommt auch in den Alpen vor (an einigen anderen Stellen in Mitteleuropa lediglich verwildert oder angesalbt).
Von den im Frühling blühenden Arten wurde der auch im südlichsten Deutschland wild wachsende C. albiflorus im 16. Jh. oder früher in Gartenkultur genommen. Konrad Gessner (1561) belegt ihn unter den Namen Crocus sylvestris flore candido, Crocus montanus sive alpinus, Croci zizania und Crocus montanus für verschiedene Gärten in Deutschland. Um 1570 wuchs er im Leuschnerschen Garten in Meißen als Crocus Martius vel silvestris und 1594 im Scholzeschen Garten in Breslau als Crocus Austriacus und Crocus sylvestris montanus flore albo Lobelii. 1613 werden im Hortus Eystettensis die verschiedenen Farbformen dieser Art mit weißen, weißen violettgründigen und hellvioletten Blüten farbig abgebildet. Neben diesem erlangte seit dem 17. Jh. auch der nahe verwandte, aber größere und farbkräftiger blühende Neapolitanische Krokus (C. napolitanus Mordant et Loiseleur-Deslongchamps) aus Italien mehr und mehr als Zierpflanze an Bedeutung und verdrängte schließlich den kleinerblütigen und auch schwieriger zu kultivierenden C. albiflorus (beide Sippen werden heute nur als Unterarten aufgefaßt und zu einer Gesamtart C. vernus (L.) Hill zusammengefaßt). Im 18. Jh. war C. napolitanus in den deutschen Gärten weit verbreitet. Durch ständige Auslese und durch Kreuzungen der verschiedenen Farbformen entstanden schließlich die vielen heutigen Sorten der großblütigen, weiß, gestreift oder hell- bis dunkelviolett blühenden Gartenkrokusse.
Der gelbblühende Gold-Krokus (C. flavus Weston, syn. C. aureus Sibth. et Sm., C. luteus Lmk.), der wild in Südosteuropa und Kleinasien vorkommt, wurde 1579 von Stephan von Hausen, Mitglied einer kaiserlichen Gesandtschaft zum türkischen Sultan, auf der Rückreise von Istanbul in Mösien (heutiges Serbien und Nordbulgarien), südlich von Belgrad, gefunden. Von den von ihm ausgegrabenen und mit nach Wien gebrachten Knollen erhielt 2 der damals dort ansässige Carolus Clusius, in dessen Garten sie im März 1583 erstmals zur Blüte kamen. In seinem noch im selben Jahr in Antwerpen erschienenen Werk über die selteneren Pflanzen Österreichs und Ungarns bildete Clusius die neue Art sogleich ab und beschrieb sie als Crocum vernum Maesiacum. Von Wien aus gelangte die sehr begehrte Zierpflanze auch in deutsche Gärten. 1588 wuchs sie im Garten des Nürnberger Arztes Joachim Camerarius, der sie von dem mit ihm befreundeten Clusius erhalten hatte. Noch im 16. Jh. gelangte die Art über die Robins in Paris, in deren Gartenkatalog von 1623 sie als Crocus vernus, flore Aureo Polyanthos Mesiacus aufgeführt wird, auch zu John Gerard (1545–1607/12) in London. In Deutschland breitete sie sich dann im 17. Jh. weiter aus. Um 1610 war sie sowohl in Eichstätt als auch in Hessem vorhanden, 1646 in Altdorf, 1663 in Berlin und 1668 in Halle. Im 18. Jh. war der Gold-Krokus dann in vielen deutschen Gärten vorhanden und ist bis jetzt eine häufige Zierpflanze geblieben. Die heute dominierende Sorte ‘Großer Gelber’ (Dutch Yellow) hielt man bisher für eine besonders großblütige Auslese, doch konnte neuerdings durch Chromosomenuntersuchungen wahrscheinlich gemacht werden, daß es sich hierbei um eine triploide Hybride zwischen C. flavus und C. angustifolius handelt.
Der Goldlack-Krokus (C. angustifolius Weston, syn. C. susianus Ker-Gawl.), der auf der Krim und im Kaukasusgebiet beheimatet ist, besitzt lebhaft goldgelbe, außen braunrot geaderte Perianthblätter. Die Art kam 1587 aus türkischen Gärten nach Wien und wurde von dort aus weiter verbreitet. 1613 wird er als Crocus vernus aureus variegatus im Hortus Eystettensis abgebildet und war im 17. und 18. Jh., ebenso wie C. flavus, in vielen Botanischen, Adels- und Liebhaber-Gärten in Deutschland vertreten. Gleditsch nannte ihn 1773 zu deutsch »Der allerfrüheste ganz kleine gelbe Frühlings=Saffran« und kennzeichnete die Art als »Die früheste, die wir nach Abgang des Schnees in den Gärten sehen; die Gärtner nennen sie zuweilen Goldenlack«. 1821 war die Art nach Heinrich Link in den Gärten nicht weniger zahlreich als C. luteus (= C. flavus). 1871, als die Teppichbeete in Mode kamen, wurde der Goldlack-Krokus, aber auch andere Crocus-Arten, zu deren Bepflanzung empfohlen. Die Art ist auch heute noch hier und da in den Gärten zu sehen, aber mancherorts nicht sehr ausdauernd.
Von den zahlreichen weiteren frühjahrblühenden Crocus-Arten Südeuropas und Vorderasiens, die heute vom Handel angeboten und von denen einige Arten auch häufiger gepflanzt, die meisten aber nur von Liebhabern kultiviert werden, kam die eine oder andere Art auch früher schon einmal in deutsche Gärten, wenn auch meistens nur vorübergehend. So werden 1613 im Hortus Eystettensis unter der Bezeichnung Crocus polyanthus variegatus bzw. albus 2 Formen von Crocus biflorus Miller abgebildet. Zwei heute in unseren Gärten ziemlich häufig anzutreffende Krokus-Arten gelangten jedoch erst in neuester Zeit in allgemeine Gartenkultur. C. chrysanthus Herb. aus Südosteuropa und Kleinasien wurde um 1840 entdeckt und 1841/43 von dem englischen Botaniker William Herbert (1778–1847) beschrieben. Heute gibt es zahlreiche durch Einkreuzung von C. biflorus und Auslese vor allem in England (Edward Augustus Bowles) und den Niederlanden (J. Hoog) gezüchtete Sorten. Auch die Erstbeschreibung des auf der Balkanhalbinsel heimischen Elfen-Krokus (C. tommasinianus Herb.) erfolgte durch Herbert. Seit 1847 in England kultiviert, fand er erst im 20. Jh. allgemeine Verbreitung als Zierpflanze. Heute gibt es von dieser zart purpurviolett blühenden Art verschiedene durch Auslese entstandene Sorten mit dunkleren und auch rötlich-violetten Blüten.
Von den herbstblühenden Crocus-Arten ist zunächst der schon im Altertum kultivierte, aus dem Orient stammende Safran (C. sativus L.) zu nennen, dessen Narben einen begehrten und hochbezahlten gelben Farbstoff und ein Gewürz liefern, und dessen griechischer, aus einer kleinasiatischen oder semitischen Sprache entlehnter Name krokos zum Gattungsnamen geworden ist. Die Art wurde bereits seit dem Mittelalter in Gärten, stellenweise aber auch auf Feldern Deutschlands als Nutzpflanze kultiviert und vielerorts als Zierpflanze gezogen. Die Kultur dieser in Mitteleuropa meist nur schwierig zu haltenden Art ist hierzulande jedoch erloschen, und auch als Zierpflanze ist der Safran kaum noch zu sehen.
Der in Siebenbürgen heimische C. byzantinus Ker-Gawl. kam 1587 nach Wien, blieb aber in den deutschen Gärten stets eine Seltenheit. Der heute am häufigsten anzutreffende herbstblühende Krokus ist der Pracht-Krokus (C. speciosus M. B.) aus Kleinasien und dem Kaukasusgebiet. Er war bereits um 1700 von Tournefort auf seiner Orientreise gefunden und von ihm 1703 als Crocus autumnalis sativo similis, flore capillamentis tenuissimus, minore odore beschrieben worden. Marschall von Bieberstein entdeckte die Art 1796 im östlichen Kaukasus erneut und gab ihr in der 1800 erschienenen deutschen Fassung seiner Beschreibung der Länder zwischen den Flüssen Terek und Kur ihren heute gültigen wissenschaftlichen Namen. Über russische Botanische Gärten kam die Art um 1835 auch nach West- und Mitteleuropa. 1844 war sie nach Friedrich Gottlieb Dietrich »nun häufig in unsern Gärten«.