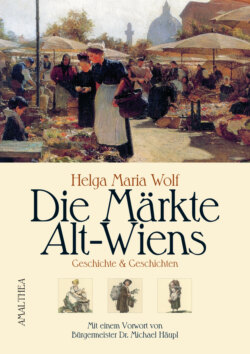Читать книгу Die Märkte Alt-Wiens - Helga Maria Wolf - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frau Sopherl & Co
ОглавлениеDie viel zitierte Frau Sopherl und ihre Kolleginnen zählten zur Kategorie der Standlerinnen (in der Stadt) oder Höckerinnen (in den Vorstädten). Diese Spezies ist entstanden, nachdem durch die Verordnung von 1792 wie erwähnt die Polletenleute abgeschafft und eine bestimmte Anzahl von Viktualienständen erlaubt worden waren. Die Betreiber wurden als »Mittelding zwischen Marktleuten und ansässigen Gewerbetreibenden« definiert. Ihre Artikel waren vorwiegend Mehl, Hülsenfrüchte, Fleisch, Obst, »grüne Waare und Kräuterwerk«.
Die »Ständel« in der Stadt durften erst aufsperren, wenn die Produzenten nach der offiziellen Marktzeit ihren Heimweg angetreten hatten (sommers um 11, winters um 12 Uhr). Höckerinnen in den Vorstädten konnten ganztägig verkaufen. Sie erhielten ihre jährliche Befugnis um 4, später um 6 Gulden, zudem hieß es: »Das Vorkaufen, Hausiren und Terrorisiren der Marktplätze ist verboten.«27 1792 gab es 200 Standinhaberinnen in und vor der Stadt, die von Ziergärtnern ihre Ware bezogen. Damit unterschieden sie sich von jenen Ablösern, die von den Bauern, nachdem diese das Publikum bedient hatten, die Restbestände erwarben und nach Ende des Marktes selbst verkauften.
Die Kleinverkäuferinnen auf dem Markt zählten zu den klassischen Alt-Wiener Volkstypen und waren für ihre Schlagfertigkeit bekannt. Die abwertende Einschätzung ihrer Vorgängerinnen wich nun – von anderer Seite – literarisch-nostalgischer Wertschätzung. Wie es in bürgerlichen Kreisen Mode war, sich von »groben Wirten« wie dem Narrendattel in Lichtental (Wien 9) beflegeln zu lassen, liebten es manche der Herren Biedermeier, wenn die Marktfrauen sie »ausschimpften«. Joseph Richter (1749–1813) schrieb in seinen »Briefen eines Eipeldauers« über die »Obstweiber«: »Das sind rare Weiber. Die heissen den Herrn Vetter einen gnädigen Herrn, und gleich darauf ein Spitzbuben.« Um 1812 bestätigte der Reiseschriftsteller Wenzel Kremer die Gewohnheit der Höckerinnen, Kunden mit Kraftausdrücken aller Art zu belegen: »Vielen Spaß gewährte es mir, zuweilen mich durch Fratschlerweiber ausschimpfen zu lassen. Man muss diese Volksklasse in Wien gehört haben, um sich einen Begriff von der unendlichen Geläufigkeit im Schimpfen und dem Reichtum von Schimpfworten zu machen. […] Zu meiner Zeit excellierten in dieser edlen Kunst zwei Weiber: Eine namens Baberl an der Brücke vor dem Burgtor, die andere am Roten Turm, Anna Katherl genannt. […] Kaufte man etwas bei ihnen, dann überhäuften sie einen mit Euer Gnaden, Exzellenz, schöner Herr und sonstigen Schmeicheleien, nur mußte man auch zahlen, was sie forderten und dies war unverschämt hoch; tat man dies aber nicht und bot niedriger, dann brach der Scheltsturm los. Wer dies nicht wußte, entfloh beschämt, kannte man aber diesen Unfug, konnte man ruhig stehen bleiben und mit den Umstehenden mitlachen.«28
Ein andermal hieß es, der Bürgermeister hätte die Märkte inspiziert und Veränderungen überlegt. Doch »unter den Fratschlerinnen fand sich gleich eine Sprecherin, welche […] dem entsetzten Oberhaupte der Stadt in Aussicht stellte, demnächst an der Spitze von 200 Kolleginnen als Deputation zu erscheinen und die Beschwerden des Standes vorzubringen.« Zur Zeit des Wiener Kongresses soll auch Zar Alexander I., der den Markt besuchte, ein Opfer von Frau Katherls Spott geworden sein.
Selbstverständlich – und 2005 vom Wien Museum in einer Ausstellung mit dem programmatischen Titel »Alt-Wien, die Stadt die niemals war« drastisch vor Augen geführt – war dies nur die eine Seite des Alltags. Die »Sopherln« leisteten ungesunde Schwerarbeit. Das verschweigen auch jene Feuilletonisten nicht, die im 1895 erschienenen Buch »Wienerstadt« das Volksleben beschworen: »Man sitzt […] mit vom Frost oder von der Hitze gerötheten Wangen unter Gottes freiem Himmel und kauft und verkauft die kleinen Pyramiden von Obst, die Berge von Gemüsen, das blutige Fleisch und den im Wasserkübel schlagenden Fisch […]. Der Wind mag stürmen, der Hagel schlagen, der Regen peitschen, die Sonne braten, die Wiener Hausfrau geht auf den offenen Marktplatz, und das Wiener Marktweib lässt sich die Gischt an den Leib treiben und bleibt sitzen, wo sie war.«29
Der biedermeierliche Viennensia-Autor Ludwig Scheyrer wusste von guten und schlechten Standplätzen: Die besten Verkaufsplätze waren am Anfang einer »Gasse«. Eine tüchtige »Sopherl«, die ihre Waren lautstark anpries, konnte schon zwischen 8 und 9 Uhr ausverkauft sein, während Kolleginnen an schlechteren Plätzen bis Mittag dazu brauchten.30
»Die Öbstlerin ist nebst dem Greißler, der Kräutlerin und der Milchfrau ein Wiener-Typus, und zwar der hervorstechendste, daher auch in allen Stadttheilen und Gassen zu finden. Die Vornehmern thronen im Innern der Stadt in einer hölzernen Bude, vor der je nach Jahreszeit der Reichthum des Obstes sehr sinnreich und anlockend geordnet ist. […] Die zweite Art […] sind die in den beiden ersten Gliedern des Obstmarktes an Hofe stehenden. […] Sie haben weder Buden noch Ständchen, sondern nur eine Bank vor sich, auf der ihr Vorrath steht; auch dürfen sie nur bis zwei Uhr Nachmittags feilbieten. Nach diesen kommen die Öbstlerinen in den Straßen der Stadt; diese haben ein kleines Ständchen und sind eigentlich die Essenz der Öbstlerinen, ihrem Alter nach kann man sie für pensionierte oder invalide Fratschlerinen halten«, schrieb der Feuilletonist Sylvester Wagner.
»Die Gnädige mit dem Küchentrabanten« beim Gemüseeinkauf auf dem Markt
Manche Standlerinnen verschafften sich einen einträglichen Nebenverdienst, indem sie Dienstboten vermittelten. Durch die Verkaufsgespräche kannten sie die »Gnädigen »(Hausfrauen) ebenso genau wie die Köchinnen und Dienstmädchen. »Auf diese Weise unterrichtet die Öbstlerin ihre besten Klientinnen schon früher von allem, ehevor sie in den Dienst kommen, macht sie dadurch auf Kleinigkeiten aufmerksam, die den Herrenleuten anstößig sind, ihr aber wenn sie dieselben früher kennt, leicht vermeidbar werden, und verpflichtet sich somit den Herrenleuten und den Dienstboten«, wusste Wagner.31
Außer diesen befugten (und Erwerbssteuer zahlenden) gab es unbefugte Händlerinnen. Sie verkauften nächst der heutigen Schwedenbrücke billig Obst und mussten gewärtig sein, jederzeit von einem Marktaufsichtsorgan weggewiesen zu werden. »Um vor dem Einschreiten der Marktobrigkeit sicherer zu sein, bieten sie das Obst äußerst billig an und suchen durch unaufhörliches Geschrei […] zahlreiche Kunden aus der stets hin und herwogenden Menschenmenge anzulocken. […] Entdeckt nun eine Verkäuferin diesen Mann des Schreckens, welcher die Gewalt hat, ihnen das Obst zu confisciren, so thut sie einen durchdringenden Schrei, durch welchen alle ihre Genossinen von dem drohenden Unheil in Kenntniß gesetzt werden. Indem diese gleichfalls verschiedene kreischende Ausrufungen von sich geben […] laufen sie auch öfters auf die Bastei hinauf und schauen von da ganz bequem und keck nach dem gefürchteten Manne herunter«, schilderte Ludwig Scheyrer.32