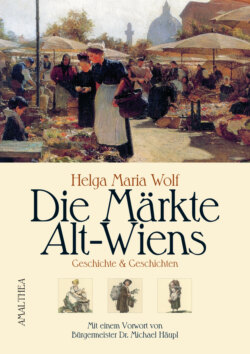Читать книгу Die Märkte Alt-Wiens - Helga Maria Wolf - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fragner, Krämer, Greißler
ОглавлениеDas Mittelhochdeutsche Taschenwörterbuch von Matthias Lexer vermerkt unter dem Eintrag »phragen, vragen«: Markt, Handel, Wucher. Für »phragener, phregener, vragener« nennt der Germanist und Dialektforscher die Übersetzung Kleinhändler, Viktualienhändler.33 Jakob und Wilhelm Grimm zitierten Hans Sachs (1494–1576), der reimte: »holtz, saltz, schmaltz, zimes, kraut und fleisch, wann sies bedarf, lauft sie erst hin und gibt dem pfragner den gewin.« Über die Berufsbezeichnung schrieben die Germanistenbrüder: »ahd. phragenari (marktmeister), von phragina, schranke.«
Sibylla Kopf hat den Fragnern 1986 ihre Diplomarbeit gewidmet. Sie fand heraus, dass es sich bei den »Stadtfragnern« um eine völlig andere Berufsgruppe handelte, als bei den »Landfragnern«. Stadtfragner war ein zünftisches Gewerbe. 1362 kauften »Seifried der Fragner« und seine Ehefrau ein Haus am Hohen Markt. 1486 gab es eine Innungsordnung der Fragner, befugter Nahrungsmittelhändler, die in Geschäften, Läden oder Gewölben handelten. Bei den Produzenten am Markt durften sie erst nach dem Abnehmen der Marktfahne kaufen (1510). Besorgten sie ihre Waren auf dem Land, hatten sie nachzuweisen, dass die Ursprungsorte mehr als 4 Meilen (ca. 30 km) von Wien entfernt lagen (1534). Größere Mengen mussten sie gemeinsam erwerben und den Warenvorrat (»Stock«) untereinander aufteilen.
Landfragner waren hingegen die ländlichen Aufkäufer, die meist mit Eiern und Milchprodukten handelten. Gäu nannte man das Gebiet, in dem ein Händler üblicherweise seine Waren erwarb. »Ins Gäu gehen« (für »ins Gehege kommen«) ist in Wien eine bekannte Redensart geblieben. Die Tätigkeit der ländlichen Butten- bzw. Gespannfragner ersparte den Produzenten die mühsame Marktfahrt. Die Aufkäufer belieferten Greißler, Wirte, Bäcker, Konditoren und Privatpersonen. Zweimal wöchentlich bis 14-tägig traten sie Arbeitsreisen nach Wien an, um ihren festen Kundenkreis zu bedienen.34 Auch für sie galt die 4-Meilen-Grenze. 1791 bestand Grund zur Klage gegen Landfragner, die in stadtnahen Gemeinden wie Nussdorf, Stockerau und Bad Vöslau Vorkauf in großem Stil betrieben. Sie nahmen den Bauern die Waren ab, »dass diese nicht mehr auf den Markt gehen, wie sie es früher getan.« Die Behörden fanden aber, dass es für Wien gleich schädlich sei, egal ob »hiesige Vorkäufler« oder Landfragner alles aufkauften und um 50 bis 100 % verteuerten. Abschaffen wollten und konnten sie diesen Berufsstand nicht, sondern verfügten: »Landfragner, die nach Wien handeln wollen, müssen über drei Meilen von Wien entfernt mit einem Kreisamtspasse versehen sein und dürfen nicht inner vier Meilen um Wien vorkaufen. Einige wenige besonders verlässliche Landfragner dürfen auch aus geringerer Entfernung – zwei bis drei Meilen – nach Wien kommen, doch auch nur ausserhalb des Umkreises der vier Meilen um Wien vorkaufen. Die Pässe gelten auf ein Jahr.«35
Krämer war im mittelalterlichen Wien die Bezeichnung für einen Einzelhändler mit Waren aller Art. Gemischtwarenhändler verkauften entweder im eigenen Lokal oder in – von der Stadt gemieteten – Krambuden auf öffentlichen Plätzen. Aus dem 15. Jahrhundert sind mehrfach Kompetenz- und Konkurrenzkonflikte mit Laubenherren und Leinwatern sowie Kaufleuten überliefert. Schiedsrichter dafür war der Landesfürst. Wie angesehen die Krämer damals waren, zeigt die Reihenfolge in der Fronleichnamsprozession, wo ihre Zunft unter 61 Gruppen die vierte Stelle einnahm.36
Die Wiener Bezeichnung »Greißler« für »Viktualienhändler mit Gewölbe« soll sich von der Ware Grieß ableiten. Nach einer anderen Erklärung handelten die Greißler ursprünglich mit Salz, das mit Schiffen auf dem Salzgries ankam. Gries bedeutete in diesem Fall den Sand am Donauufer.37
Sylvester Wagner schrieb 1844 in »Wien und die Wiener« über die »bedeutendsten Kleinverschleißer von Viktualien und anderen Utensilien«. Die dazu gezeigte Abbildung stellte einen stämmigen Mann in seinem Laden dar. Waren- und Preiskenntnisse waren für ihn besonders wichtig: »Artikel die entweder gar nicht oder doch nicht leicht verderben, kauft er zu einer Zeit, wo sie etwa der Zeit wegen oder weil der Markt damit gerade überschwemmt ist, im kleinsten Preise stehen, und zwar in großer Quantität. […] Der Freitag ist für ihn der wichtigste Tag, denn seine bedeutendsten und einträglichsten Artikel holt er an diesem von der Seilerstätte.« Nach intensiver Beobachtung und klugem Feilschen erstand er seine Artikel auf dem Viktualienmarkt, ebenso auf dem Naschmarkt und Schanzel, für den Wiederverkauf. »Die meisten Greißlerwaren werden groschen- ja sogar kreuzerweise verschlissen, wobei dessen Ehehälfte, die in der Regel den Verkauf versieht […] ein thätiges und allen Leuten freundliches Weib sein muß.« Im Biedermeier ging man zum Greißler nicht nur einkaufen, er »ist ferner auch das Anfrage- und Auskunftsbureau der ganzen Nachbarschaft. […] Ein nicht zu beseitigender Übelstand für den Greißler ist das Borgen, dem er, um den Zuspruch zu erhalten, nicht ausweichen kann. […] Besitzt der Greißler sammt seiner Gemahlin alle die oben angeführten Eigenschaften, so kann es bei der Einträglichkeit des Geschäftes nicht fehlen, daß er gut besteht und sein Schäflein im Trockenen hat.38