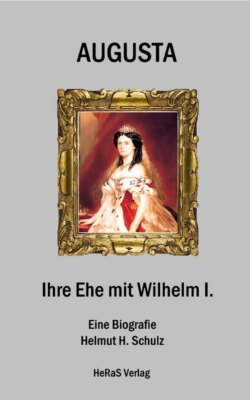Читать книгу Augusta - Ihre Ehe mit Wilhelm I. - Helmut H. Schulz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1811 GEBURT UND ERZIEHUNG
ОглавлениеDas Kind, wusste Charlotte von Schiller zu melden, liegt so vornehm und so vernünftig, dass man sich gar nicht wundern würde, wenn eine Krone mitgeboren worden wäre. Diesem Kind Augusta, das am 30. September 1811 geboren worden war, die künftige Kaiserin oder bloß Königin anzusehen, dazu gehörte entweder hellseherische Begabung oder die Biegsamkeit eines in höfischer Luft verkrümmten Nackens. Den frühen, gleichwohl völlig aus der Luft gegriffenen Prophetien folgten alsbald die Beobachtungen wachsamer Hofdamen. Die Prinzessin, bemerkt die Schillerwitwe später, hat einen kräftigen Willen und ist so stark und fest; sie läßt nicht los, was sie anfaßt. Zu dieser Zeit war die künftige Kaiserin ein Kleinkind, für das der Ausdruck Prinzessin ziemlich euphemistisch erscheint. Sie zählte erst zwei Jahre und mag nach allem gegriffen haben, was in ihre Nähe kam, wie es einem Kind im unbequemen Steckkissen zukommt. Immerhin aber war Augusta gesund, und die uns überlieferten Bilder einer Frau zwischen fünfzig und sechzig Jahren lassen auf einen hageren, knochigen Typus schließen. Goethe, der sich zu jener Zeit schon angeschickt hatte den Parnass seiner ministeriellen Karriere wieder zu räumen, verfasste ein hübsches Gedicht auf die junge Kaiserin in spé, die freilich erst neun Jahre alt war, aber sich um so lieber von dem inzwischen bekanntermaßen größten Poeten der Deutschen andichten ließ. 1820 war jener ein Greis, aber die junge Dame nahm das Werk des Meisters huldvoll an, und wie sollte sie nicht an einem Musenhof huldvoll gegenüber ihren Anbetern geworden sein? Alle Pappeln hoch in Lüften, jeder Strauch in seinen Düften, alle sehn sich nach Dir um! Schrieb immerhin der Meister der Deutschen neben seinem klassischen Spätwerk. Nach dem die Pappel gefällt, der Duft der Sträucher verweht war, kam allerdings Alexander von Humboldt, auf dessen Urteil vielleicht mehr Verlass ist oder wenigsten sein sollte, und stellte an der inzwischen Fünfzehnjährigen eine ungewöhnliche große Ausstrahlung fest. Ihre Züge sind im höchsten Grade bedeutungsvoll, und ihre ganze Gestalt wird sich, wenn sie nicht ein wenig zu stark sein wird, in einigen Jahren gewiß noch schöner, als sie schon jetzt erscheint, entwickeln.
Nun, ja, wir befinden uns in einem Zeitalter, in welchem die hässliche Herzogin einer bürgerlichen Schönheit allemal vorgezogen wurde. Augusta ist also schön, und was wird die Welt erleben, wenn sie erst ganz entwickelt ist, ohne überflüssiges Fett angesetzt zu haben. Aber lassen wir die gehässigen Bemerkungen zu servilen Lobhudeleien gegenüber einem Kind, einer Heranwachsenden oder einem Duodezhof, und sehen wir nach, wie weit Augusta wirklich über den trüben Durchschnitt der Abkömmlinge von Fürstenhäusern hinausragte. Auch haben wir noch nie neben einem nässenden, wenn auch niedlichem Säugling eine Krone liegen sehen.
Ihr Großvater Karl August, an dessen Vortrefflichkeit kein Zweifel besteht, hatte seinen Sohn Karl Friedrich mit einer Zarentochter vermählt, der Großfürstin Maria Pawlowna. Dieser Karl Friedrich war 1783 geboren worden. Er hat mit 21 Jahren die um drei Jahre jüngere Zarewna geheiratet, und sie von St.-Petersburg nach Weimar gebracht. Immerhin war Großfürstin Maria Pawlowna, nunmehr weimarerische Großherzogin, sicherlich an andere Ausdehnungen gewöhnt, und durfte daher auch einen höheren Anspruch stellen. Nachgesagt wird ihr ein energischer Wille. Übrigens hatte sie am häuslichen Herd einiges miterlebt. Paul I., russisch Pawel Petrowitsch, ein Sohn Katharinas II, war 1796 Zar aller Russen und Reußen geworden, und hatte ein beispiellos brutales Regime aufgerichtet. Als geschworener Feind der Französischen Revolution trat er 1798 der so genanten Zweiten Koalition bei. Seine Generale kämpften nicht ohne Erfolge, da trat Pawel aus dem Freundschaftspakt wieder aus, und suchte die Liebe der Franzosen. Dies hatte einen wichtigen Grund, er war nämlich zum Großmeister der Johanniter gewählt worden, und erhob als solcher Anspruch auf die unter britischer Herrschaft stehende Insel Malta, dem Stammsitz des Ordens. Aber die englischen Verwandten und Freunde wollten das gute und strategisch wichtige Stück Empire nicht herausrücken. Das zog ihnen den Grimm Pauls zu. Der Zar hatte sich auch noch andere, innere Feinde herangezüchtet, nämlich unter den Militärs. Benningsen und die Gebrüder Subow führten sie. Und so fand Pawel Petrowitsch in seinem eigenen Schlafzimmer ein jämmerliches Ende. Als ihm die Verschwörer den sofortigen Rücktritt ultimativ nahe legten, weigerte er sich, und starb mannhaft eigensinnig unter dem erdrosselnden Strick. Da solche kleinen Vorkommnisse unter Fürstendächern nichts Besonderes waren, trat der Sohn Alexander als der Erste seines Namens ohne große Schwierigkeiten innen wie außen die Nachfolge an. Nach ihm kam Nikolaus I., auch ein Sohn des unglücklichen Tyrannen. Alsbald aber hatte sich dieser Zar mit den Dekabristen herumzuschlagen, und machte sich auch einen Namen als blutiger Unterdrücker. So etwa sah es in der Familie der Maria Pawlowna aus, die 1804 als Gemahlin unseres Karl Augusts sozusagen noch einmal davongekommen war. Von den furchtbaren Ereignissen in Petersburg und anderswo hatte die zur Mordstunde ihres Vaters 1801 gerade 15 Jahre alte Prinzessin genügend mitbekommen. Maria Pawlowna, die Enkelin Katharinas der Großen, Tochter des Zaren Paul, Schwester der Zaren Alexander I. und Nikolaus I. kam an einen zwar kleinen, aber säuberlich geordneten Kulturhof. In Alexander I. hat Europa seinen Befreier gefeiert, die Wiederherstellung des europäischen Königtums ist jedenfalls auf ewig mit seinem Namen verbunden. Er starb 1825, und seine Schwester durfte sich also des Glanzes erfreuen, den sein Name über Europa ausstrahlte. Die Großfürstin, alt-russisch und westlich gebildet, zog zur Erziehung ihrer Tochter heran, wessen sie im Weimarischen habhaft werden konnte. Ihr Schwiegervater Karl August war der äußeren Not gehorchend dem von Napoleon über die Fürsten verhängtem Rheinbund widerstrebend beigetreten, aber 1806 stand er wieder im Lager der Verbündeten der Vierten Koalition, preußentreu übrigens, denn seit 1792 und 1793 war Karl August schon mehr als ein Verbündeter Preußens gewesen, ein wahrer Glaubenspreuße. Dass Preußen die Führung in Deutschland zukam, vertrat er mit innerer Überzeugung. Alle diese Wandlungen, auch die der Überzeugungen, hatte Maria Pawlowna mit erlebt, sie genoss und nutzte auch die Segnungen, die dieser Kleinstaat der Klugheit seines Großherzogs verdankte. 1779 hatte die Regierung eine Zeichenschule eingerichtet, 1791 das Hoftheater; 1806 nach den Vereinbarungen des Wiener Kongresses wurde die Landständische Verfassung eingeführt, in einem der ersten Staaten, die sich zur Konstitution verpflichtet hatten. Die Universität Jena blühte auf; Botanische Gärten wurden angelegt und landwirtschaftliche Mustergüter; kurzum, es war eine Lust geworden zu leben, um mit Schiller zu sprechen. In der Tat lebte es sich in Karl Augusts Ländchen vergleichsweise frei und auch ganz gut. 1811, einige Jahre nach ihrer Übersiedlung, brachte Maria Pawlowna Augusta zur Welt. Und das Kind, dessen Begabung aus der Körperhaltung, aus der Kopfstellung, aus dem Druck der Fingerchen leicht festzustellen war, falls man Hofschranze ist, bekam denn auch Zeichenunterricht und ging in die Musikstunde. Goethe selbst fungierte zwar nicht unmittelbar als Pädagoge, zu nichts war er wahrscheinlich weniger geeignet, pflegte aber gern Umgang mit dem aufgeweckten Kind, was, je länger, je mehr Wirkung auf die Entwicklung der jungen Dame zeigte. Ihre lebhafte Art, ihre Geschicklichkeit in der Malerei, ihre Lernbegier dürften den alten Herren gereizt und amüsiert haben. Der Verkehr zwischen diesen beiden Menschen dauerte beinahe 20 Jahre. Nach dem Wiener Kongress waren ruhigere Zeiten für die Fürstenhäuser gekommen; eine unmittelbare revolutionäre Gefahr drohte ihnen nicht. Der Zusammenhang zwischen den Duodezstaaten hielt, und Preußen hatte sich jedenfalls in den Befreiungskriegen als eine bedeutende, als eine führende Macht gezeigt. Die Frucht war noch nicht reif. Mit dem Geist von Weimar, mit der Milch klassisch-frommer Denkungsart, an der Quelle eingesogen, erhielt Augusta zugleich den äußeren Schliff französischer Bildung. Sie sprach ein bemerkenswert gutes Französisch, meinen die Zeitgenossen, und fiel auch später, wenn ihr was gegen den Strich ging, gern in diese zweite Muttersprache, wohl wissend, dass man sie umso mehr respektierte, je weniger man sie verstand. Diese Erziehung hatte leider einen Nachteil; sie förderte in Augusta die Familienanlage zur Hochnäsigkeit. Sie verehrte Goethe als den Meister, aber sie war auch Kind des neuen sentimentalen Zeitalters, der romantischen Dichtung, der aufkommenden Deutschtümelei wie der Neugier darauf, was anderswo besser gemacht wurde. Davon mag der alte Herr nichts gewusst haben, oder er sah darüber hinweg. Aber sie lernte auch alles Russische aus tiefer Seele zu hassen, und alles Englische zu bewundern. Das erstreckte sich bis auf die kleinen Dinge des Alltags. Und ihre spätere Umgebung wusste sich nicht genug zu tun, über Augustas Mäkelei an Haus- und Tischgerät, an Maschinen vielleicht, Klage zu führen. Nichts war der Augusta also gut genug, und diese kritische Anschauung der Dinge geht ebenfalls auf die lockere Pädagogik in Weimar zurück. Goethe war ein zu eifriger Sammler von allerlei Gegenständen, um dieser Beobachtung der Dinge nicht einen hohen Wert beizumessen und seine Auffassung an solch einem Ziehkind zu vererben. Hiermit förderte er sicher auch die mentalen Anlagen der Prinzessin. Obwohl der Meister im Grunde keine gelehrten Frauen schätzte, sondern einfache, schlichte Schönheit bei Frauen suchte, fand seine Vorstellung von tätigem Fürstentum sehr wahrscheinlich in Augusta genau das Objekt solcher Begierde; das kluge junge Mädchen, nicht ohne den Charme, den kluge junge Mädchen bisweilen ausstrahlen, was vergessen lässt, dass sie nicht auffallend hübsch sind, kam dem Alten also entgegen. Ihr bildnerisches Talent, sie lernte an seiner Malschule, oder der von ihm mitbegründeten Anstalt, den Umgang mit allerlei Material, für Goethe ein wichtiges Element der Erfahrung. Der Herr Minister besuchte sogar einen Scharfrichter regelmäßig, von dessen Sammlungen er gehört hatte, tauschte mit ihm Mineralien, und dergleichen war damals unvergleichlich vorurteilslos, wo dem Freimann selbst der Besuch öffentlicher Gasthäuser verboten war, wie er vom gesamten bürgerlichen Verkehr ausgeschlossen blieb.
Dem Urteil so vieler Leute über die auffallend fortgeschrittene Reife des jungen Mädchens ist wohl zu trauen. Schwer vorstellbar, dass es im damaligen Deutschland noch einen Duodezhof gegeben habe, wo sich derart viele Persönlichkeiten trafen, nicht nur ungezwungen ein- und ausgingen, sondern manchmal bleibende Quartiere aufschlugen. Herder, Bonnet, Humboldt, Saussure, Schiller natürlich, Jean Paul wenigstens vorübergehend, lebten in oder streiften Weimar und traten also auch in die Welt Augustas, was auf das junge Mädchen nicht ohne Einfluss geblieben ist. Hauptform des Kontaktes jener Zeit war der Brief; er enthielt nicht das Stenogramm bloßer Mitteilung, Briefe waren ausschweifende Darlegungen der Lage des Schreibers, seiner Beziehungen zur Welt. Es war ein Glück, dass der jungen Augusta die Last pietistischer Religiosität oder auch katholischer Dogmatik erspart blieb, obschon sie protestantisch getauft worden war. Evangelische Christin blieb sie zwar ihr Leben lang, aber ihr Christentum war weithin an die historische bis pantheistische Beobachtung ihres großen heimlichen Erziehers gebildet. Rituale reizten die junge Dame bestenfalls optisch. Gewiss erfuhr sie die Süße der griechisch-orthodoxen Liturgie, den schwellenden Singsang der Psalmodisten, die mit den Elementen einer ursprünglichen, den mit einer russisch-dörflichen Heilssuche verbundenen Gottesdienst; sie hörte der schlichten Predigt des Pastors eher religionskritisch bis philologisch interessiert zu, und wahrscheinlich konnte niemand mit Goethe inniger verkehren und dogmatischer Religiosität aufgeschlossen bleiben. Für Augusta mag das Streben des Doktor Johann Faust fast aufklärerischen Bezug gehabt haben. Weihrauch, die goldüberladene Ikone, deren Wirkung sich selbst der religiöse Skeptiker oder Atheist wie einer mystischen Beschwörung nur schwer entziehen kann, haben sie also ebenso wenig berührt, wie die römisch-katholische Liturgie; es gibt kaum eine schriftliche Hinterlassenschaft von Augusta, in der sie sich maßlos übertrieben auf eine fürstliche Gottesgnadenschaft beruft oder sich christlicher Phrasen bedient wie ihr späterer Gatte Wilhelm. Was ihr an der Fürstenherrlichkeit blieb, ihr Hochmut gegenüber niedriger klassierten, ist immerhin ganz und gar von dieser Welt.
Als 1828 oder 1829 der preußische Wilhelm in ihr Leben trat, nach manchem Hin und Her um sie warb, nahm sie die Werbung mit der Gelassenheit einer Philosophin entgegen, als habe sie ihn wegen seines Schrittes zu trösten. Sie dachte über ihn nach, über sein Leben und seine Vorstellungen. Sie hat im Grunde bis in ihre Witwenzeit hinein, den Stil von Weimar gepflegt, hat gemalt und nicht einmal ungeschickt, und wusste sich den Genuss zu verschaffen, der ihr einst in der Jugend aus dem Umgang mit erhabenen Geistern und tiefgründiger Unterhaltung erwachsen war. Dergleichen konnte sie bei Wilhelm nicht bekommen, und die literarischen Salons, die wenigen, die in Berlin noch blühten, waren ihr aus Standesrücksichten verschlossen, aber gerade dort wurden alle die wichtigen öffentlichen Angelegenheiten bei aufgeregtem Gehabe behandelt, die Augusta ihrer Erziehung und Natur nach reizten. Und die Gazetten, die Presse bestimmte den Ton der Gebildeten.