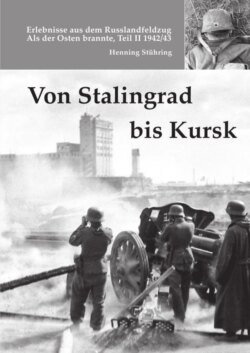Читать книгу Von Stalingrad bis Kursk - Henning Stühring - Страница 4
Vorwort
Оглавление„Unter der großen Birke, da liegt er.“
Ein älterer Herr weist den Weg. Zu einer bestimmten Grabstelle auf dem Dorfmarker Friedhof in der Lüneburger Heide. Es ist ein drückend heißer Mittwochabend, dieser 14. Juli 2010 – der französische Nationalfeiertag. Noch ein paar Schritte, eine letzte Wegkreuzung. Und tatsächlich, da liegt er. Unter einer schweren Steinplatte. Er, der Generalfeldmarschall Erich von Lewinski, genannt von Manstein. Neben ihm ist seine Frau Jutta Sybille gebettet, und an der Ecke der Grabstelle steht noch ein schlichtes Holzkreuz. Für den Sohn Gero Erich Sylvester. Dessen Gebeine liegen allerdings in Russland begraben. Am Südufer des Ilmen-Sees. Gefallen am 29. Oktober 1942 im Nordabschnitt der Ostfront durch die Explosion einer Fliegerbombe. Als Leutnant, im Alter von 19 Jahren. Sein Vater, der berühmte Stratege der Wehrmacht und „gefährlichste Gegner der Alliierten“, durfte 85 werden.
Die Schatten werden länger. Es ist ein ausgesprochen ruhiger Abend. Eine geradezu friedliche Stimmung. Als stünde die Zeit still. Der passende Augenblick, sich auf die kleine Bank unter der mächtigen Birke zu setzen, eine Zigarre anzuzünden und in Gedanken zu versinken. Grübeln über ihn, den Generalfeldmarschall. Ironie der stillen Begegnung: Ausgerechnet heute feiern die Menschen in Frankreich ihren Nationalfeiertag! Laut und freudig. Vor 70 Jahren, im Mai 1940, versetzte die atemberaubend erfolgreiche Ausführung von Mansteins genialem „Sichelschnitt“-Plan, der die Grundlage zum phänomenalen Blitzsieg im Westen bildete, Frankreich plus die halbe Welt in Angst und Schrecken. Stalin soll laut Chruschtschow angesichts der unerhörten Niederlage der vermeintlich stärksten Landstreitmacht der Erde verzweifelt ausgerufen haben, dass Hitler nun auch die Sowjets „fertigmachen“ werde.
Ja, Mansteins Feinde verloren ob seiner brillanten Operationsideen schon mal die Fassung. Schlachten lenken, sich in den Gegner denken, konnte er wie kein Zweiter. Zwar wurde der vornehme Preuße bisweilen von Hitler als „Pinkelstratege“ verspottet. Aber ebenso bemerkte der Führer gegenüber Generaloberst Guderian, Manstein sei „vielleicht der beste Kopf, den der Generalstab hervorgebracht hat“. Davon konnte neben anderen auch der legendäre Marschall Schukow ein Klagelied singen. Noch im Frühjahr 1944 wurde der „Held der Sowjetunion“ von Manstein regelrecht vorgeführt, als ihm dieser in überragender Feldherrnkunst die schon sicher geglaubte Beute, die eingekesselte 1. Panzerarmee, entwand. Es sollte allerdings die letzte Großtat des blonden Strategen im Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Hitler verabschiedete seinen fähigsten Feldmarschall am 30. März, da „im Osten die Zeit der Operationen größeren Stiles [...] abgeschlossen“ sei. Damit war Mansteins glänzende Karriere abrupt beendet. Geblieben sind viele Fragen. Bis heute. Zwar kann es keine Zweifel am operativen Genie Mansteins geben, aber dafür umso mehr an seiner Einstellung gegenüber dem NS-Regime und seiner charakterlichen Veranlagung. Der zweifellos überaus ehrgeizige Stratege, der 1942 für die sehr blutige Eroberung der Seefestung Sewastopol auf der Krim den Marschallstab erhielt, sah sich selbst als unpolitischen Soldaten; bezeichnend sein Ausspruch:
„Preußische Feldmarschälle meutern nicht!“
Untergebene wiederum nahmen Manstein gelegentlich als gefühlskalt wahr. Wer aber war dieser im persönlichen Umgang gewiss nicht einfache Mann, der zur zentralen Figur unter den deutschen Heerführern in einer schicksalhaften Kriegsphase, nämlich zwischen den historischen Wegmarken Stalingrad und Kursk, avancierte und ein atemberaubendes Kapitel an der Ostfront entscheidend mitschrieb?
Manstein ist tatsächlich Zeit seines Lebens vor allem Soldat gewesen. Wie ein roter Faden zieht sich das Militärische durch sein gesamtes Dasein – vom jugendlichen Kadetten über den Frontkämpfer im Ersten und Heerführer im Zweiten Weltkrieg bis hin zum Bundeswehr-Berater im Kalten Krieg. Das Soldatentum legte man dem Sprössling einer preußischen Offiziersfamilie quasi in die Wiege, und als Soldat ist er schließlich von der Bundeswehr ehrenhaft zu Grabe getragen worden.
Man wird Manstein und auch anderen Feldherrn seiner Generation nicht gerecht, indem fortlaufend der Grad seiner Zustimmung zum Nationalsozialismus oder Antisemitismus gemessen wird. Ob unter Kaiser, Führer oder Kanzler – dieser Mann wollte vor allem eines: Operationen auf dem Schlachtfeld lenken! Er war geschmeidig genug, seine überragenden Fähigkeiten den verschiedenen Systemen anzudienen. Solange er nur planen und operieren durfte. Dass er dabei auch kalt bis rücksichtslos wirkte beziehungsweise handelte, liegt in der Natur von militärischen Angelegenheiten. Unter Mansteins Führung starben gewiss Zigtausende Menschen. Soldaten wie Zivilisten. Man muss aber seine Biografie kennen, um die kriegerische Mentalität erfassen zu können. Was der eigenen Karriere nützte, goutierte Manstein. Einerseits. Andererseits denkt ein reinrassiger Soldat in anderen Kategorien als ein friedliebender Zivilist. Manstein hat als junger Oberleutnant im Ersten Weltkrieg für sein Vaterland geblutet und eine schwere Schussverletzung nur dank der Hilfe seiner Kameraden überlebt. Und er beerdigte seinen Sohn Gero an der Ostfront. Ein solcher Mann weiß, dass Leben und Sterben auf dem Schlachtfeld oft nur einen Schritt voneinander entfernt liegen. Er akzeptiert das Gesetz des Krieges. Es gehört einfach zum Soldatensein. Was der Feldmarschall von Manstein seinen Landsern befahl, hat er selbst an Leib und Seele erfahren. Daraus zog er wohl auch die Berechtigung, buchstäblich alles von den Untergebenen fordern zu dürfen. Nicht wenige Feldherren verschließen sich gegenüber sentimentalen Kategorien wie Mitleid – erst recht gegenüber dem Feind, Zivilisten eingenommen. Andernfalls zerbricht der militärische Führer an seiner Aufgabe, zumal einer solch übermenschlichen, wie sie zweifellos das Kommando über eine Heeresgruppe im Kriege darstellt. Besser man legt das Menschsein ab und sieht die Dinge rein vom militärischen Standpunkt her.
Dazu gehört, potentiellen Unruhen im Operationsgebiet vorzubeugen. Also lässt man die Einsatzgruppen der SS nicht nur gewähren, sondern unterstützt sie auch noch. Oder die Bekämpfung der Partisanenbewegung mit brutalen Repressalien. So geschehen 1941/42 im Herrschaftsbereich seiner 11. Armee. Man darf Manstein sicher nicht gleichsetzen mit einem Reichenau. Jener berüchtigte Nazi-General, der als leidenschaftlicher Juden- und Russenfresser galt. Mansteins Verhältnis zu Hitler war durchaus ambivalent. Der eher feine preußische Pinkelstratege und der öfter grobe ostmärkische Gefreite wurden nie richtig warm miteinander. Aber der eine brauchte eben den anderen, und beide wussten es. Ohne Hitler, der Aufrüstung und Krieg verhieß, konnte Manstein sein operatives Genie nicht endlich auch auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellen. Und der im Anfangsstadium des Völkerringens in militärischen Fragen noch unsichere Führer war zunächst auf seinen besten Kopf angewiesen, vor allem um Frankreich vernichtend schlagen zu können. Wer weiß, welchen Lauf die Geschichte genommen hätte, wenn nicht Halder, sondern Manstein zum Generalstabschef des Heeres ernannt worden wäre. Das erschien damals durchaus eine reelle Option. Seinerzeit fungierte Manstein als Oberquartiermeister I im Generalstab des Heeres. Er galt in dieser Schlüsselposition als ein potentieller Nachfolger von Generalstabschef Beck, den Hitler 1938 aus dem militärischen Spitzenamt entfernte. Gesetzt diesen Fall: Wären die deutschen Panzer im Westfeldzug 1940 kurz vor Dünkirchen ebenfalls angehalten worden oder hätten sie das britische Expeditionskorps von diesem letzten Hafen für eine Evakuierung abgeschnitten und den Westalliierten damit die totale Niederlage bereitet? Vielleicht würde ein von Manstein, der Schöpfer des „Sichelschnitts“, bei Hitler mehr Gehör gefunden haben als eben Halder, der lange Zeit gegen den Plan intrigierte. Aber auf Dauer hätte Hitler wahrscheinlich den Preußen mit der Hakennase noch weniger ertragen als den Bayern mit dem Bürstenschnitt. Gut möglich, dass Mansteins größter Triumph zugleich auch sein letzter als OKH-Chef gewesen wäre. Aber immerhin hätte die Wehrmacht dann mit aller Macht die Rote Armee laut Stalin „fertigmachen“ können, statt den doppelt riskanten Zweifrontenkrieg, wie er 1941 ausbrach, wagen zu müssen. Zugegeben: Alles reine Hypothese im Großreich der Spekulation, wenngleich auch eine höchst interessante. Sicher dürfte allerdings sein, dass es viele Feldherrn – ob nun ein Patton, Montgomery, Schukow oder Manstein – mit dem Wort Wellingtons hielten: „Das Zweitschlimmste nach einer verlorenen Schlacht ist eine gewonnene Schlacht.“
Denn in beiden Fällen ist der Krieg, „die schönste Zeit“1 für die Herren Generale, vorbei; der populäre US-Panzergeneral Patton schrieb während der Schlacht um die Normandie in sein Tagebuch: „Das zivile Leben wird stinklangweilig werden. Keine jubelnden Menschen, keine Blumen und keine Privatflugzeuge mehr. Ich bin überzeugt, das beste Ende für einen Offizier ist die letzte Kugel des Krieges.“
Dafür mag man sie verfluchen, die großen Marschälle, weil andere für ihren Lorbeer verbluteten. Man selbst kann es im Angesicht von Mansteins letzter Ruhestätte nicht. Trotz allem, was geschehen. Dazu muss man freilich bereit sein, die Menschen und die Zeit, in der sie lebten, emotional zu verstehen, statt sie allein aus nachträglicher Sicht „politically correct“ analysieren zu wollen. Man wird das Gefühl nicht los, dass gewisse der heutigen moralisierenden TV-Professoren damals wohl eher nicht nicht zu Bombenlegern, sondern „Hitlers Helfern“, Eliten des Dritten Reichs, getaugt hätten. Jedenfalls wird oft nur dieser zweite Schritt gesetzt. Wer sich aber die Mühe macht, die damalige Zeit unvoreingenommen zu betrachten, bleibt früher oder später an der unbequemen Frage hängen: Wie hätte man selbst als Angehöriger der Kriegsgeneration gehandelt? Zum lebensgefährlichen Widerstand in Diktaturen taugt bekanntlich nur eine mutige Minderheit. Das möge sich unsere Friedensgeneration vielleicht zuerst oder überhaupt mal fragen. Denn es waren jene, aus deren Blut und Fleisch wir entsprungen sind, nämlich unsere Väter und Großväter, Mütter und Großmütter; jene, an deren Gräbern wir trauern statt sie zu verfluchen, obwohl die meisten damals mitmachten. Wer von uns hätte die Hakenkreuzfahne verbrannt und nicht geschwenkt? Wäre man selbst damals wirklich klüger, mutiger gewesen?
Die Zigarre erlischt. In Frankreich wird weiter gefeiert. Aus Erbfeinden sind Partner, Motoren, Hauptantriebskräfte des europäischen Einigungsprozesses geworden. Der Sichelschnitt ist Geschichte, Manstein Legende lebendig. So wird er es wohl gewollt haben, auch wenn der viele Lorbeer auf ewig schmutzig blutbefleckt bleibt.