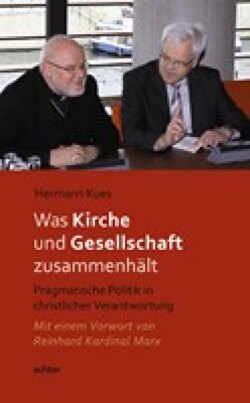Читать книгу Was Kirche und Gesellschaft zusammenhält - Hermann Kues - Страница 10
Die Würde des Kompromisses
ОглавлениеAls Politiker stehe ich für Werte ein. Deshalb achte ich auf die Positionen der Kirchen und suche den Dialog mit ihnen. Kirchen sind und bleiben moralische Autoritäten. Allerdings: Ich muss mich auch mit den Folgen politischer Entscheidungen auseinandersetzen. Fundamentale Positionen, die keine Mehrheiten finden, bewirken im gesellschaftlichen Kräftespiel oft gerade das Gegenteil dessen, was sie eigentlich beabsichtigen. Das Problem ist seit Max Weber oft diskutiert worden. Weber hielt es für einen abgrundtiefen Gegensatz, „ob man unter der gesinnungsethischen Maxime handelt – religiös geredet: ‚Der Christ tut recht und stellt den Erfolg anheim‘ – oder unter der verantwortungsethischen: dass man für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat“ (Weber 1992, 70). Nach seiner Vorstellung muss der Politiker die Folgen einer Entscheidung im Blick haben, wenn sie denn absehbar sind. Die Kirche – Weber spricht tatsächlich von dem ‚Heiligen‘ – braucht das in seiner Vorstellung nicht. Sie bewertet nur, ob eine Handlung in sich moralisch richtig ist oder nicht.
Mit dieser Aufgabenteilung kann ich mich nicht anfreunden. Ein Politiker fragt niemals nur nach den Folgen seiner Entscheidungen. Immer muss er auch prüfen, ob der ‚Kompass‘ noch stimmt, ob die einzelne Entscheidung mit der allgemeinen Ausrichtung an Werten und Überzeugungen verträglich ist. Ohne stabiles Wertefundament, das mich verpflichtet, geht es nicht, ohne verantwortliche Abschätzung der Folgen einer Entscheidung aber auch nicht. Beides zusammenzuführen, genau das ist meine Aufgabe als christlicher Politiker.
Ich wünsche mir von der Kirche, dass sie die Würde des Kompromisses anerkennt und damit auch diejenigen, die sich der mühseligen Aufgabe unterziehen, solche Kompromisse zu finden. Man tut das aus Respekt vor der Meinung der anderen und aus gesunder Skepsis gegenüber der eigenen Überzeugung, weil man Pluralität aus Überzeugung bejaht und trotzdem versucht, die Vielfalt der Meinungen und Lebensformen irgendwie zusammenzuhalten.
Als der gegenwärtige Papst Benedikt XVI. noch Präfekt der Glaubenskongregation war, hatte ich einmal die Gelegenheit, mit ihm über das Dilemma des christlichen Politikers zu sprechen. Gesetzt den Fall, so fragte ich ihn, ich müsste eine Ethik-Kommission leiten, deren Ergebnis sich mit der Position der Kirche nicht deckt: Erhalte ich von der Kirche Zustimmung oder werde ich verurteilt? Seine Antwort: Weder noch. Die letzte Verantwortung müsse ich vor mir selbst, vor meinem Gewissen tragen.
Die Kirchen können sich hierzulande nicht darüber beklagen, zu wenig Gehör zu finden. Allerdings überzeugen sie umso mehr, je positiver sie sich auf die Vielstimmigkeit der pluralen Gesellschaft einlassen. „Moralische Autoritäten“, sagt der Mainzer Sozialethiker Gerhard Kruip, „können heute nicht mehr einfach Gehorsam einfordern. Im Gegenteil: Wer dies tut, macht sich verdächtig. Er scheint zu befürchten, seine moralischen Forderungen seien zu schwach, um argumentativ begründet und eingesehen werden zu können“ (Kruip 2011,174).
Kirche und Politik dürfen sich nicht gegenseitig überfordern. Die Politik kann nichts ‚verordnen‘, was nicht letztlich von den Menschen auch mitgetragen wird. Hier – wo es um Überzeugungen in den Köpfen und Herzen der Leute geht – sind auch die Kirchen gefragt. Da geht der Ruf an die Politik oft ins Leere. Man kann sonntagsfreundliche Ladenöffnungszeiten fordern, aber man kann nicht daran vorbeisehen, dass sich sonntägliches ‚Shopping‘ ständig steigender Beliebtheit erfreut. Mit Verboten und Geboten allein richtet man da gar nichts aus. Die Kirchen selbst müssen überzeugen und ein Bewusstsein für den Wert des Sonntags schaffen, das aufs Ganze gesehen in unserer Gesellschaft verlorengegangen ist. Ich glaube, das meint auch der Papst, wenn er sagt, die Kirche wolle keine Macht über den Staat und wolle auch nicht „Einsichten und Verhaltensweisen, die dem Glauben angehören, denen aufdrängen, die diesen Glauben nicht teilen. Sie will schlicht zur Reinigung der Vernunft beitragen“ (Deus Caritas Est Nr. 28).
Im Feld der Fortpflanzungsmedizin heißt das: den Sinn für den Wert des Lebens wachzuhalten. Dabei wird sie viele Verbündete finden. Frank Ulrich Montgomery, den ich oben schon zitiert habe, fragt beispielsweise, ob die Erfüllung des Kinderwunsches um jeden Preis nicht völlig überschätzt wird, weil Paare die ungewollte Kinderlosigkeit als ein großes Unglück, vielleicht sogar als einen Makel sehen. Wenn sie sich fragen, welchen Sinn ihr Schicksal haben mag, ist die Politik überfordert, die Kirchen sollten es nicht sein. Von ihnen werden verständliche Antworten erwartet. Aufgabe der Politik ist es, pragmatisch zu helfen. Dazu gehört es, über die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit aufzuklären, bei der Finanzierung künstlicher Befruchtung zu helfen, die Chancen für eine Adoption zu erleichtern und Frauen zu helfen, die sich früh – möglicherweise noch während des Studiums oder der Ausbildung – für ein Kind entscheiden.