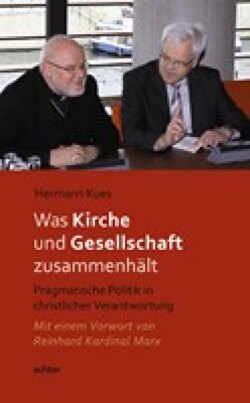Читать книгу Was Kirche und Gesellschaft zusammenhält - Hermann Kues - Страница 12
Die Attraktivität des christlichen Menschenbildes
ОглавлениеImmer dann, wenn von „christlicher Politik“ die Rede ist, kommt das ‚christliche Menschenbild‘ als ihr Fundament ins Spiel. Was es damit auf sich hat, würde ich so übersetzen: Christlich ist zuallererst die Würde, die Unersetzbarkeit, der Wert jedes Einzelnen. Christen leiten ihn daraus ab, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Die schlechteste christliche Gesellschaft – so hat es Heinrich Böll einmal formuliert – würde er der besten heidnischen vorziehen, weil in ihr Platz für Alte, Kranke und Schwache sei. Konkret heißt das: Der Mensch ist, gleich ob er arm oder reich, gesund oder krank, jung oder alt, Deutscher oder Ausländer, geboren oder ungeboren ist, von Gott gewollt. Und für Gesellschaft und Politik kommt es darauf an, allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen.
Zweitens: Der Mensch ist zur Freiheit und zur Selbständigkeit berufen. Er soll sich etwas zutrauen und etwas aus sich machen. Es gehört zur Menschenwürde, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. In diesem Sinne ist es, auch wenn das hart klingen mag, menschen unwürdig, auf Dauer „am Tropf“ staatlicher Leistungen zu hängen, wenn man sich auch selbst helfen könnte.
Drittens: Der Mensch ist ein soziales, ein solidarisches Wesen. Er steht nicht allein da, er kann niemals nur an sich denken. Er ist auf Gemeinschaft angewiesen, in erster Linie auf die Familie. Er braucht Solidarität, kann aber auch Solidarität geben. Eine solidarische Gesellschaft fördert deshalb die Familie, weil sie der beste Schutzraum für Menschen ist. Sie integriert Arbeitslose, damit sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Sie will, dass keiner aufgegeben wird.
Und schließlich viertens: Solidarität gilt heute über unsere Generation hinaus im Blick auf unsere Kinder und deren Kinder. Je mehr wir in Natur und Schöpfung eingreifen und die Welt ‚umgestalten‘, umso mehr muss das Prinzip Nachhaltigkeit gelten. Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Menschheit auch in Zukunft existieren kann.
So sehe ich – kurz und knapp – den Kernbestand des christlichen Menschenbildes. Zu ihm gehört aber auch, die Menschen nicht zu überfordern, sondern mit ihren Schwächen, ihrer Unvollkommenheit und ihren Fehlern zu rechnen. Das christliche Menschenbild propagiert nicht den idealen Menschen, sondern den Menschen, wie er nun einmal ist. Als ich Büroleiter des niedersächsischen Umweltministers in den 1980er Jahren war, habe ich darüber viel nachdenken müssen. Nirgendwo auf der Welt war das Umweltbewusstsein so ausgeprägt wie hierzulande. Manchmal hat es sich zu echten Untergangsszenarien ausgewachsen. Aber wenn es dann darum ging, von der Straße auf die Schiene auszuweichen, innerhalb Deutschlands auf das Flugzeug zu verzichten, die Kinder mit dem Fahrrad statt mit dem Auto vom Kindergarten abzuholen – dann klafften Theorie und Praxis weit auseinander. Wie kommt das? Offenbar können wir Menschen das logisch Unverträgliche ganz gut vertragen. Werte sind das eine, Bequemlichkeiten das andere. Als Politiker sollte man sich klarmachen, dass sie auch ihr, allerdings begrenztes, Recht haben.
Schließlich sollte im Kontext des christlichen Menschenbildes die Gelassenheit nicht vergessen werden. Wer Politik betreibt, merkt schnell, dass viele Vorhaben Stückwerk bleiben. Das ist schmerzlich, sollte aber für den Christen leichter zu ertragen sein als für den Nicht-Gläubigen. Denn wer sich erlöst weiß, braucht sich nicht selbst zu erlösen. Wer darauf vertraut, dass Gott das Seine dazutut, muss nicht auf Gedeih und Verderb die gute Gesellschaft schaffen – ein politischer Traum, der sich ohnehin noch nie verwirklicht hat. Wenn man es in dieser Tugend der Gelassenheit weit gebracht hat, sollte man mehr Geduld im Umgang mit dem politischen Gegner aufbringen und auf die letzte Schärfe in der Auseinandersetzung verzichten.
Während ich dies schreibe, liegt die Affäre um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff schon etwas zurück, ist aber, wenn man tiefer blickt, noch längst nicht ausgestanden. Sie hatte Züge einer mittelalterlichen Hexenjagd, in der es keinen Respekt der Medien – leider auch der öffentlich-rechtlichen – vor der Privatsphäre und keine Unschuldsvermutung mehr gab, auf die doch jeder von uns Anspruch erheben darf. Es war für mich einer der wenigen Lichtblicke, dass der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze auf der Höhe der Kampagne Barmherzigkeit für Wulff forderte, eine christliche Tugend, die darin besteht, dann nicht mehr nachzutreten, wenn jemand ohnehin schon am Boden liegt. Und was die Sache noch schlimmer macht: Während der Beschuldigte mit seiner Familie öffentlich am Pranger steht, wird er aus der sicheren Deckung der Anonymität mit Häme überzogen. Wir haben, sagt der Hannoveraner Landesbischof Ralf Meister, „eine Kultur der permanenten Beschuldigung und Anklage entwickelt“ (Neue Osnabrücker Zeitung vom 30. Januar 2012). Und es ist sehr feinsinnig, wenn er hinzufügt: Wo es die öffentliche Anklage gibt, da müsste es eigentlich auch die öffentliche Vergebung geben. Sie würde unsere Gesellschaft menschlicher und christlicher machen.