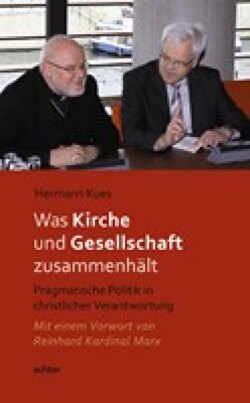Читать книгу Was Kirche und Gesellschaft zusammenhält - Hermann Kues - Страница 13
Familienpolitik: wertbezogen und pragmatisch
ОглавлениеIn der katholischen Soziallehre spielt ein idealtypisches Bild der Familie eine gewichtige Rolle. Der Mann ist (alleiniger) Ernährer, die Frau Hausfrau und Mutter. Dieses Modell schlägt durch bis zu dem zentralen Problem der Sozialethik, der Frage nach dem gerechten Lohn: Er müsse so bemessen sein, dass der gemeinsame häusliche Aufwand angemessen bestritten werden könne, heißt es in der Sozialenzyklika Quadragesimo Anno. Dass Mütter einer außerhäuslichen Tätigkeit nachgehen und dafür den Haushalt und die Kindererziehung vernachlässigen müssten, sei ein „schändlicher Missbrauch“ (QA Nr. 71). Diese Position zieht sich bis in die jüngsten päpstlichen Verlautbarungen zu sozialen Fragen durch. Benedikt XVI. nennt in seinen Überlegungen zur Würde der Arbeit sechs Faktoren, von denen vier familienorientiert sind: Arbeit müsse die unmittelbaren Bedürfnisse der ganzen Familie abdecken, Schulbildung der Kinder ermöglichen, Kinderarbeit ausschließen und genügend Raum für eine spirituelle Familienkultur lassen (vgl. Caritas in Veritate Nr. 63).
Das Bild der Hausfrauen- und Alleinverdienerehe wird aber schon von Joseph Höffner kritisch ‚gegengelesen‘. Er ist dabei – wie auch sonst – wohltuend undogmatisch. In seiner Christlichen Gesellschaftslehre schreibt er, es sei zwar üblich geworden, über die Krise und den Zerfall der Familie in der industriellen Gesellschaft bewegte Klage zu führen, dieses verallgemeinernde Urteil sei aber falsch. „Auch im vorindustriellen Zeitalter stand die Frau keineswegs nur unter dem Leitbild der Gattin und Mutter. Sie arbeitete vielmehr im landwirtschaftlichen, handwerklichen und kaufmännischen Familienbetrieb mit“ (Höffner 1978,116). Die Eingliederung der Frau in das Berufs- und Erwerbsleben nimmt er zur Kenntnis, bedenklich sei in erster Linie, dass in der Regel die Frau die Doppelbelastung durch berufliche und häusliche Pflichten tragen müsse.
Das hat sich bis heute nicht wesentlich geändert. Der weit größte Teil der Erziehungsarbeit wird weiterhin von den Müttern geleistet. 80 Prozent der jungen Frauen wünschen sich ein gleichberechtigtes Lebensmodell, aber nur 40 Prozent der Männer können sich eine Partnerschaft vorstellen, in der alle Aufgaben gleichberechtigt verteilt werden (vgl. 15. Shell Jugendstudie 2006). Die Doppelbelastung ist immer noch weiblich.
Ansonsten haben sich die Verhältnisse seit den 1970er Jahren geradezu dramatisch verändert. Damals waren von 15 Mio. verheirateten Frauen in der alten Bundesrepublik nur 5,5 Mio. erwerbstätig, davon 2 Mio. als mithelfende Angehörige haushaltsnah in Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Einer außerhäuslichen Tätigkeit im strengen Sinne gingen 3,5 Mio. Ehefrauen nach. Die Erwerbsquote der Mütter lag unter 20 Prozent, solange das jüngste Kind noch nicht 18 Jahre alt war.
Und heute? – Die Erwerbsquote von Müttern insgesamt liegt bei 65 Prozent. Sie steigt mit dem Alter des jüngsten Kindes an und erreicht rund 78 Prozent, wenn es mindestens 12 Jahre alt ist. Aber schon in der Kindergartenzeit vereinbaren rund 50 Prozent der Mütter Beruf und Familie. Lediglich das ‚Babyjahr‘ ist weitgehend der Familie vorbehalten. In dieser Zeit sind rund 11 Prozent der Mütter berufstätig. Dieser Schonraum für die junge Familie entspricht einem tief verinnerlichten Wunsch der Eltern, beim Start ins Leben viel Zeit füreinander zu haben. Die Familienpolitik hat mit dem im Jahre 2008 eingeführten Elterngeld die richtigen Akzente gesetzt und vielen jungen Paaren geholfen, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Und es hatte einen schönen Nebeneffekt. Die seinerzeit aus Skandinavien entlehnten und hierzulande anfangs viel belächelten ‚Partnermonate‘ werden mittlerweile von einem guten Viertel der jungen Väter in Anspruch genommen.
Zu Gast in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Lingen. In Kindertagesstätten geht es nicht um Betreuung, sondern um Förderung. Wer die Potenziale von Bildung in dieser Lebensphase unterschätzt, verbaut den Kindern ihre Chancen. (Foto: Manfred Buschhaus)
Die Erwerbsorientierung der Frauen ist – das kann man allein dem Längsschnitt über 40 Jahre entnehmen – eine der dynamischen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Sie ist zugleich Folge der verbesserten Schul- und Berufsausbildung, eines neuen Leitbildes von gleichberechtigter Partnerschaft und eines dynamischen Arbeitsmarktes, der in nächster Zeit weniger von Arbeitslosigkeit denn vom Fachkräftemangel geprägt sein wird. Gut ausgebildete Frauen sind da gesucht und umworben. In den 1980er Jahren ging man bei Überlegungen zu einer „weiblichen Normalbiografie“ noch von einer durchschnittlich 15-jährigen Auszeit aus, in der sich die Frau ausschließlich der Familie widmen würde. Danach kam der ‚Neue Start ab 35‘. Von diesem Modell haben wir uns mittlerweile weit entfernt. Entscheidend ist: Die Möglichkeiten der Lebensgestaltung sind vielfältiger geworden. Auch die traditionelle Rollenverteilung ist nicht tot. Die Zahl der Familien, in denen der Mann den Lebensunterhalt verdient und die Frau die Kinder betreut, wird zwar weniger, aber immerhin: Gut die Hälfte (52 Prozent) der Paare mit Kindern ‚fahren‘ das Doppelverdienermodell, die andere Hälfte hat sich für die traditionellere Variante entschieden.
Wertorientierte Familienpolitik sollte deshalb ‚asketisch‘ sein. Sie tut gut daran, nicht dem einen oder anderen Lebensmodell den Vorrang zu geben, sondern die Wahlfreiheit ganz oben anzusetzen. Sie hat schon eine Menge erreicht, wenn sie Chancen eröffnet und junge Leute dazu ermutigt, sich für Partnerschaft und Familie zu entscheiden. Wie sie die dann ausgestalten, sollte ihre eigene Sache sein. „Wir werden es“, haben CDU und CSU 2009 als ihr Leitziel formuliert, „Familien leichter machen, so zu leben, wie sie es selbst wollen.“ Anders gesagt: Der Staat hat den Menschen nicht vorzuschreiben, wie sie leben sollen, sondern muss ihnen helfen, dass sie so leben können, wie sie wollen.
In dem Zusammenhang – und wenn man sich nach den tatsächlich gelebten Werten fragt – ist das Votum der Kinder ganz interessant. Der Kinderwerte-Monitor 2010 weist nämlich aus, dass die Kinder selbst der Berufstätigkeit ihrer Mütter und Väter durchweg positiv gegenüberstehen. Sie sehen die damit verbundene finanzielle und materielle Sicherheit, traurig sind sie allerdings über Zeitstress und Ungeduld der Eltern als Schattenseite der doppelten Belastung. Ein deutliches Defizit: Die Väter haben immer noch zu wenig Zeit für ihre Kinder. Aus Sicht der Kinder nehmen sich Mütter unter der Woche zu 80 Prozent viel Zeit, die Väter fallen mit 44 Prozent weit ab (vgl. Familienreport 2011,55).
Jenseits der Grundsatzdiskussionen um das ‚richtige‘ Familienmodell stellt sich die Zeitgestaltung als das zentrale Problem unserer Familien heraus. Zeit, so hat Bundesfamilienministerin Kristina Schröder prägnant formuliert, ist die „Leitwährung der Familienpolitik“. Der aktuelle Achte Familienbericht der Bundesregierung zeigt an vielen Beispielen, wie vertrackt die Situation sich immer noch darstellt: Teilzeitbeschäftigte Mütter würden gern länger arbeiten, finden aber keine passenden Arbeitszeitmodelle. Väter würden im Gegenzug gern reduzieren, arbeiten aber in Betrieben, die keine Teilzeitstellen anbieten. Zeitstress entsteht, weil Behörden geschlossen sind, wenn Eltern von der Arbeit kommen. 14 Wochen Schulferien bedeuten für viele Eltern ein Riesenproblem, würden da nicht die Großeltern einspringen. Gefragt sind familiengerechte Arbeitsplätze und nicht arbeitsplatzgerechte Familien.
Ein Reizthema ist der Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung geblieben. Die Katholische Kirche betont den Primat der Elternverantwortung, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken meint, die Kindertagesbetreuung könne „Erziehung und Bildung in der Familie jedoch sinnvoll ergänzen“ (ZdK 2008,23). Auch Franz-Xaver Kaufmann (2006) hat ins Feld geführt, dass Kinder in der Regel in den ersten zwei Lebensjahren am besten in der Familie aufgehoben sind.
Auf der anderen Seite: Jedes dritte Kind unter sechs Jahren hat eine Zuwanderungsgeschichte. Viele von ihnen benötigen Unterstützung, beispielsweise beim Erlernen der deutschen Sprache. 1,7 Mio. Kinder beziehen Hartz IV – in einigen Großstädten ist das jedes dritte Kind. Bildung kann der Vererbung der Armut entgegenwirken. Manche Eltern haben erhebliche Schwierigkeiten in der Erziehung. Und was nicht vernachlässigt werden darf: Kindern tut Gemeinschaft gut. Die klassischen Großfamilien oder nachbarschaftliche Spielgruppen werden weniger. Geschwister sind selten geworden.
Wir sollten deshalb die Spitzen aus der Diskussion nehmen. Wichtig ist aus meiner Sicht: In Kindertagesstätten geht es nicht um Betreuung, sondern um Förderung. Wer die Potenziale von Bildung in dieser Lebensphase unterschätzt, verbaut den Kindern ihre Chancen. Was hier versäumt wird, lässt sich später schwer nachholen. Nie wieder lernen Menschen im Lebenslauf so leicht, geradezu spielerisch, kann ihre Entdeckungsfreude kaum befriedigt werden, sind sie für alle möglichen Lernanregungen dankbar.
Oft wird in der Debatte angeführt, Kindertagesstätten seien mit diesen Aufgaben überfordert. Sie sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichern, Versäumnisse familiärer Erziehung ausgleichen und die Kinder fit fürs Leben machen. Das sind tatsächlich hohe Anforderungen. Doch man tut den Erzieherinnen unrecht, wenn man ihnen nicht zutraut, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ihr Beruf muss aufgewertet, ihre Professionalität erhöht werden. Es braucht sicher transparente Qualitätsstandards und entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten, vielleicht sogar eine Akademisierung der Ausbildung. Mein allgemeiner Eindruck ist aber, dass der Bereich der frühkindlichen Bildung sich schon heute durch viel Kreativität und Engagement des Personals auszeichnet. Das wird mir bei Besuchen in Kindertagesstätten immer wieder bestätigt und zeigt sich auch in Umfragen unter Eltern.
Frühkindliche Förderung ohne Beteiligung der Eltern läuft ins Leere. Es muss ein Miteinander im Sinne einer echten Erziehungspartnerschaft geben. Erste Bildungseinrichtung bleibt die Familie. Kindertagesstätten haben geradezu ideale Möglichkeiten, gerade die Eltern anzusprechen, die sich sonst Angeboten von außen verschließen.