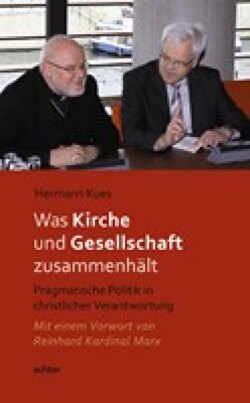Читать книгу Was Kirche und Gesellschaft zusammenhält - Hermann Kues - Страница 9
Christliche Politik – zwischen festen Grundsätzen und praktikablen Lösungen
ОглавлениеEine künstliche Befruchtung ist für Paare, deren Kinderwunsch sich auf natürlichem Wege nicht erfüllt, eine belastende Prozedur. Die Frau muss sich einer Hormonbehandlung unterziehen, damit mehrere Eizellen in einem Zyklus reifen. Sie werden operativ entfernt und künstlich in Reagenzglas und Brutschrank befruchtet. Anschließend werden bis zu drei Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt, in der Hoffnung, dass sich einer von ihnen in die Gebärmutterschleimhaut einnistet und weiterentwickelt. Die Aussicht, tatsächlich schwanger zu werden, liegt bei rund 28 Prozent. Häufig muss das Verfahren mehrmals wiederholt werden, bis sich der Erfolg einstellt.
Eine kleine Gruppe werdender Eltern, die sich der In-Vitro-Fertilisation unterzieht, trägt ein zusätzliches Risiko, die Veranlagung zu einer schweren Erbkrankheit oder die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt. Die Präimplantationsdiagnostik (PID) minimiert dieses Risiko. Sie untersucht Embryonen nach einer künstlichen Befruchtung auf genetisch bedingte Krankheiten. Gesunde Embryonen werden der Mutter eingepflanzt, belastete aber verworfen. Das Verfahren gibt es seit den 1990er Jahren, es ist bislang weltweit in rund 11 000 Fällen angewendet worden.
Für die Eltern bedeutet die erfolgreiche PID häufig die letzte Chance auf ein gesundes Kind. Vor allem vermeidet sie – darauf weisen ihre Befürworter hin – die Abtreibung im Verlauf der Schwangerschaft, wenn sich bei der Pränataldiagnostik herausstellt, dass das Ungeborene tatsächlich schwer behindert ist. Andererseits gibt es eine Reihe ethischer Bedenken gegen die PID. Sie greift massiv in den Anfang menschlichen Lebens ein, der eigentlich der Verfügbarkeit durch Wissenschaft und Technik entzogen sein sollte. Embryonen sollten den höchsten Schutz genießen, gerade weil sie die schwächsten Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft sind. Sie dürfen nicht von bestimmten Eigenschaften abhängig gemacht werden, Menschen dürfen keinen Qualitätstests unterliegen. Zudem sind Fernwirkungen der PID zu bedenken, die zwar nicht sofort eintreten, aber in Zukunft zu erwarten sind. Die Fachleute nennen das ‚slippery slope‘, die schiefe Ebene: Mit der PID könnte eine neue Eugenik salonfähig werden, die Entscheidungen über den Wert oder Unwert menschlichen Lebens trifft. Designerbabys sind denkbar, Eltern können via Präimplantationsdiagnostik bestimmte Eigenschaften ihres Kindes vorausplanen. Was das Geschlecht angeht, so ist dies in den Vereinigten Staaten und Israel heute schon der Fall. Die gesellschaftliche Akzeptanz von kranken und behinderten Menschen könnte nachlassen, wenn sich zukünftig Behinderungen vorhersagen und möglicherweise ausschließen lassen. Zusammengefasst: Die Präimplantationsdiagnostik mag eine beeindruckende technische Möglichkeit der Fortpflanzungsmedizin sein, sie lässt sich aber mit dem Grundwert der uneingeschränkten Würde jedes Menschen von Anfang an nicht vereinbaren.
Mit Kardinal Ratzinger, damals noch Präfekt der Glaubenskongregation, in Rom. Gesetzt den Fall, so habe ich ihn gefragt, ich müsste eine Ethik-Kommission leiten, deren Ergebnis sich mit der Position der Kirche nicht deckt. Erhalte ich von der Kirche Zustimmung oder werde ich verurteilt? Seine Antwort: Weder noch. Die letzte Verantwortung müsse ich vor mir selbst, vor meinem Gewissen tragen. (Foto: Privat)
Diese – notwendigerweise knappe und sicher nicht vollständige – Darstellung eines schwierigen Problems habe ich mit Bedacht an den Anfang dieses Buches gestellt. Der Deutsche Bundestag hat am 7. Juli 2011 über die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik entschieden. Vorausgegangen war eine jahrelange Diskussion, und die Voten waren quer über die politischen und weltanschaulichen Lager verteilt. Der Bundesgerichtshof hatte einen Arzt freigesprochen, der die PID angewendet und sich selbst angezeigt hatte, um Rechtssicherheit zu erlangen. Die Bundesärztekammer sprach sich für die Zulassung bei hohem genetischem Risiko der Eltern aus, ihr Vorsitzender Frank Ulrich Montgomery allerdings lehnt sie als einen „Ansatz zur Selektion menschlichen Lebens“ ab. Der deutsche Ethikrat, der sich wohl am intensivsten mit der Problematik auseinandergesetzt hat, fand keine einhellige Meinung. Eine knappe Mehrheit votierte dafür, die Minderheit dagegen. Einige Behindertenverbände setzten sich für ein Verbot ein, ebenso die beiden großen Kirchen, wobei die Ablehnung der katholischen Kirche einhellig ausfällt, während es in der evangelischen auch abweichende Stimmen gibt.
Dieses Gesamtbild der Unentschiedenheit prägte auch den CDU-Parteitag 2010 in Karlsruhe, auf dem sich am Ende eine knappe Mehrheit von 51 Prozent der Delegierten für ein Verbot der PID ausgesprochen hat. Angela Merkel, Volker Kauder und Hermann Gröhe hatten sich für das Verbot ausgesprochen. Peter Hintze, Katherina Reiche und Ursula von der Leyen votierten – neben vielen anderen – dagegen. Keinem kann man vorwerfen, sich die Entscheidung leicht gemacht zu haben. Die Erfüllung des Kinderwunsches, die Unterstützung von Eltern in einer schwierigen Situation, die Verhinderung von Abtreibungen – das sind gewichtige Argumente. Und andererseits: Hier wird, wie Volker Kauder es formuliert hat, eine Tür geöffnet „und wir wissen nicht, was nach der Tür kommt“.
Ich habe in Karlsruhe für ein Moratorium plädiert, weil ich das Gefühl hatte, es werde noch mehr Zeit benötigt, um die Frage wirklich nach allen Seiten hin zu beleuchten. Scheinbar klare, einfache Antworten helfen oft eben nicht weiter. Der medizinische Fortschritt stellt uns vor Entscheidungen, denen wir moralisch noch nicht gewachsen sind.
Als die Entscheidung im Bundestag anstand, habe ich mich dem Entwurf von Karin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) und Johannes Singhammer (CSU) für ein striktes Verbot der PID angeschlossen. Er fand 228 Anhänger. Durchgesetzt hat sich mit knapper Mehrheit von 306 Stimmen der Gesetzentwurf von Ulrike Flach und Peter Hintze, der die PID in engen Grenzen erlaubt. Er bedeutet keinen Freifahrtschein. Es wird in Deutschland drei, höchstens vier PID-Zentren geben, an denen jeder Einzelfall von einer Ethik-Kommission geprüft wird.
„PID“ ist ein Musterfall für das Dilemma, in dem christlich orientierte Politiker stecken. Ich komme um die Mahnung von Papst Johannes XXIII. nicht herum, dass Leben von Anfang an heilig ist, weil „es von seinem ersten Aufkeimen an das schöpferische Eingreifen Gottes verlangt“ (Mater et Magistra Nr. 194). Der ungeborene Mensch ist auch im Anfangsstadium ein Wunder, das wir Menschen nicht ergründen können und gerade deshalb besonders schützen müssen. Ich komme auch nicht um die Sorge vor einer Art Dammbruch herum, die Frank Ulrich Montgomery umtreibt: „Denken Sie allein daran, dass heute 95 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Ich sehe auch bei Gentests an künstlich erzeugten Embryonen die große Gefahr, dass am Ende alles gemacht werden könnte, was medizinisch-technisch möglich ist. Wir leben in einer Welt der Salami-Taktik, wo Stückchen für Stückchen abgeschnitten wird“ (Das Parlament vom 11. Juli 2011).
Andererseits: Die Erfahrung anderer Länder, in denen die PID seit längerem erlaubt ist, deutet nicht darauf hin, dass Behinderungen weniger akzeptiert werden. Ohnehin wäre es illusorisch zu hoffen, auf diesem Wege ließen sie sich aus der Welt schaffen. Es gibt in Deutschland rund 1,5 Mio. Menschen mit einer schweren Behinderung. Nur zehn Prozent davon sind genetisch bedingt, die meisten entstehen bei der Geburt oder später im Leben durch einen Unfall. Und selbst von den genetisch bedingten lassen sich die meisten durch eine PID nicht diagnostizieren. Gewichtig ist auch das Argument von Ursula von der Leyen, man könne nicht Gen-Untersuchungen bei einer befruchteten Eizelle in der Glasschale verbieten, die dann später am Embryo im Mutterleib stattfinden dürfen. Die PID müsse – immer in den beschriebenen engen Grenzen – erlaubt sein, weil sie es einer kleinen schicksalsgeprüften Gruppe von erblich belasteten Paaren erlaube, ja zum Kind zu sagen.
Gesellschaft und Politik haben sich schwer mit der Entscheidung getan, Für und Wider hielten sich geradezu die Waage. Ähnliches haben wir schon in den 1970er Jahren bei der Reform des Paragraphen 218 StGB erlebt. Auch hier zog sich die Debatte über viele Jahre hin, von einer ursprünglichen Fristenregelung (1974), die das Bundesverfassungsgericht verwarf, bis zu einer Indikationenlösung mit verbindlich vorgeschriebener Beratung. Sie unterscheidet deutsches Recht von dem in den meisten Ländern der Erde. Ideal im Sinne einer fundamentalen Position ist sie nicht, aber ein guter Kompromiss, getragen von der Hoffnung, dass die Beratung vielen Frauen hilft, sich letztlich für das Kind zu entscheiden. Der wirksamste Schutz für das Kind kann eben nur gemeinsam mit der Mutter erreicht werden (vgl. Maier 2011).
Für den Rückzug der Katholischen Kirche aus der Schwangerschaftskonfliktberatung habe ich deshalb bis heute wenig Verständnis. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Beraterinnen, wie wertvoll und – im wahrsten Sinne des Wortes – lebensrettend ihre Arbeit gewesen ist. War es wirklich berechtigt, sich aus dieser höchst verantwortungsvollen Aufgabe zurückzuziehen, mit dem Argument, die reine kirchliche Lehre könne „verdunkelt“ werden? Kann die Kirche wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, dass ein Kind möglicherweise nur deshalb nicht zur Welt gekommen ist, weil es kein adäquates kirchliches Beratungsangebot gegeben hat? Annette Schavan hat diesen Rückzug ein beschämendes Beispiel für Dialogunfähigkeit genannt (Schavan 2010,57).
Ein letztes Beispiel aus dem Bereich der Lebensschutz-Politik: Ich war Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Kirchen und Religionsgemeinschaften (2000–2005), als es am 30. Januar 2002 um das Importverbot für embryonale Stammzellen ging. Diese Debatte ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Worum ging es? – Ein Hauptinteresse der biomedizinischen Forschung besteht darin zu verstehen, wie sich aus den pluripotenten Stammzellen differenzierte Körperzellen entwickeln, also z. B. Leber-, Haut- oder Hirnzellen. Abgesehen davon, dass dies eine faszinierende Forschungsfrage ist, verspricht sich die Medizin von ihrer Beantwortung auf die Dauer die Möglichkeit, Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer oder Diabetes besser verstehen und wirksam bekämpfen zu können. Ethisch unbedenklich ist die Forschung an sog. adulten Stammzellen, erfolgversprechender aus der Sicht der Biomedizin erschien die Forschung an embryonalen Stammzellen. Sie werden aus überzähligen Embryonen gewonnen, die bei der künstlichen Befruchtung keine Verwendung gefunden haben. Dies ist durch das deutsche Embryonenschutzgesetz verboten. In anderen Ländern wie England und Frankreich ist es erlaubt. Die Frage, die dem Deutschen Bundestag vorlag, war nun, ob so gewonnene Stammzelllinien nach Deutschland eingeführt und der Forschung zur Verfügung gestellt werden dürfen oder ob das Verbot der Embryonenforschung auch das der Einführung von bereits bestehenden Stammzellen einschließen muss.
Ich habe federführend und gemeinsam mit Wolfgang Wodarg, Wolfgang Thierse, Norbert Lammert, Christa Nickels und vielen anderen für ein totales Verbot des Imports embryonaler Stammzellen votiert. Eine andere Position wurde von Ulrike Flach, Katherina Reiche, Peter Hintze und anderen vertreten. Sie plädierten für eine „verantwortungsbewusste Forschung an embryonalen Stammzellen“. Einen vermittelnden Vorschlag, den Import unter Auflagen und mit einer Stichtagsregelung zu ermöglichen, machte eine Gruppe mit Maria Böhmer und Margot von Renesse. Sie hat sich schließlich durchgesetzt.
Alle, die sich damals zu Wort gemeldet haben, waren sich des Dilemmas bewusst. Tatsächlich kam, um es ein wenig despektierlich zu sagen, niemand völlig ungeschoren davon. Die Importgegner mussten sich fragen lassen, ob sie eines Tages auch auf die möglicherweise segensreichen Ergebnisse der Stammzellforschung verzichten würden, weil sie ja auf ethisch bedenklichem Wege zustande gekommen sind. Die Befürworter mussten erklären, warum sie den Import der Stammzellen erlauben, deren Gewinnung hierzulande aber weiterhin verbieten wollen.
Wer nicht genau hinschaut, mag in der mühsam gefundenen Lösung einen ‚faulen‘ Kompromiss sehen, zumal dann, wenn man in Rechnung stellt, dass die zur Verfügung stehenden Stammzelllinien nicht gut genug waren, um den Ansprüchen der Forschung zu genügen. 2008 wurde deshalb eine zweite Stichtagsregelung getroffen, das Gesetz musste also „nachgebessert“ werden. Forschungsministerin war damals Annette Schavan, zugleich Moraltheologin und Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Sie sah sich bei dieser zweiten Stichtagsregelung massiven Vorwürfen ausgesetzt, hat aber, wie ich finde, sehr plausibel dagegengehalten: Als sie sich in Brüssel für eine Stichtagsregelung auf europäischer Ebene einsetzte, um der verbrauchenden Embryonenforschung wenigstens einen Riegel vorzuschieben, unterlag sie gerade deshalb, weil einige Länder jede Stammzellforschung und deshalb auch jeden Stichtag ablehnten. Die Liberalisierung setzte sich durch, weil ihre Gegner kompromissunfähig waren. „Es lässt sich“, schreibt sie, „geradezu als ein Lehrstück für eine christliche Politik nehmen, wie verheerend eine stringente und konsequente, aber kompromisslose Haltung sich auswirken kann“ (Schavan 2010,68).