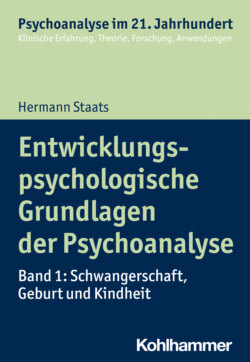Читать книгу Entwicklungspsychologische Grundlagen der Psychoanalyse - Hermann Staats - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Theorienpluralität innerhalb der Psychoanalyse: die »Psychologien« der Psychoanalyse
ОглавлениеDie verschiedenen psychologischen Modelle, die in der Psychoanalyse verwendet werden, haben jeweils eigene Vorzüge. Triebtheorie, Ich-Psychologie, Selbstpsychologie, Objektbeziehungstheorie, Bindungstheorie, relationale und strukturale Analyse beschreiben unterschiedliche Modelle des Psychischen, die auch entwicklungspsychologische Konzepte enthalten, aber noch keine im engeren Sinne geschlossenen entwicklungspsychologischen Theorien darstellen. Als Modelle klinischen Verstehens tragen sie zu unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsphasen unterschiedlich viel bei. Sie alle sind aus dem Versuch heraus entstanden, die Symptome und die Lebensgeschichte eines Menschen in einen Zusammenhang zu bringen. Diese Psychologien werden im folgenden Abschnitt kurz in ihren zentralen Annahmen dargestellt, um sie in ihrer Unterschiedlichkeit sehen und vergleichen zu können. Als Leser werden Sie in den folgenden Kapiteln die Beiträge dieser Modelle zur Entwicklung im Lebenslauf kennen lernen – und vor dem Hintergrund der hier beschriebenen Pluralität an Sichtweisen einordnen können (ausführlicher im Dialog der unterschiedlichen Schulen: Mertens, 2010, 2011).
Das älteste psychologische Modell der Psychoanalyse, das triebtheoretische Modell, zeichnet sich durch seine dichten Verbindungen zum Körperlichen aus. Es betrachtet Menschen unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedürfnisse und Wünsche. Diese werden in frühen körperlichen, familiären und kulturellen Erfahrungen geformt und in Handlungen sowie bewussten und unbewussten Phantasien verkörpert. Hier stehen zentrale Wünsche (als Abkömmlinge körperlicher Bedürfnisse oder »Triebe«) im Konflikt mit den Wünschen anderer, den Anforderungen der Gesellschaft oder dem eigenen Bedürfnis nach Sicherheit. Ein unausgewogenes Verhältnis von Anpassung und Verzicht auf Befriedigung (zu viel oder zu wenig) wird als symptomauslösend betrachtet. Die Fähigkeit, sich eigene Wünsche in einer von körperlicher Befriedigung weiter entfernten, gesellschaftlich akzeptierten Form zu erfüllen (»Sublimation«), ist für Gesundheit und gesellschaftliche Anerkennung wichtig. Das »Fressen« von Büchern ersetzt dann das Essen großer Mengen an Nahrungsmitteln. Als entwicklungsfördernde Botschaft dieser Sichtweise kann vereinfachend formuliert werden: »Kinder – und auch Erwachsene – sollte man, soweit das geht, gewähren lassen, wenn man ihnen Gutes tun will«. Allerdings sieht die Triebtheorie auch die Notwendigkeit von zeitgerechten an die Entwicklung angepassten Enttäuschungen (»Grenzen«) vor, an denen gelernt werden kann.
Die deutliche entwicklungspsychologische Ausrichtung innerhalb dieses Modells kann Therapeuten helfen, sich mit ihren Patientinnen und Patienten zu identifizieren und so emotionale Verbundenheit zu gestalten. Therapeut und Patient standen und stehen vor ähnlichen Entwicklungsaufgaben. Der Rückgriff auf diese Situation fördert Teilnahme und Empathie. Triebtheoretisch wird von abgrenzbaren Phasen der kindlichen Entwicklung ausgegangen. Mit der körperlichen Reifung stehen Kinder vor jeweils neuen Entwicklungsaufgaben mit charakteristischen interpersonellen Konflikten und Ängsten. Diese kindlichen Entwicklungsphasen werden in triebtheoretischen Konzepten beschrieben und dann zur kurzen Benennung von Verhaltensweisen Erwachsener verwendet. Manche dieser Begriffe sind in das alltagspsychologische Verständnis eingegangen. So beschreibt etwa »orale Phase« einen Zeitraum, in der Erfahrungen überwiegend über den Mund und das Saugen an der Brust gesammelt werden. Mit diesem Zeitraum werden Konflikte um das Annehmen von Versorgung und bestimmte depressive Verhaltensmuster in Verbindung gebracht. »Anale Phase« beschreibt die Zeit der »Sauberkeitserziehung« im 2. und 3. Lebensjahr mit Konflikten um Anpassung und Autonomie und mit einem Bezug zu zwanghaften Verhaltensmustern. Hier geht es um Konflikte im Bereich von Kontrolle und Unterwerfung, um Ordnung und Eigensinn. In ihrer alltagspsychologischen Kurzform wirken manche Begriffe der Triebtheorie »angestaubt«. Erst in Verbindung mit einem dynamischen Verständnis der für die Entwicklungsphasen charakteristischen Konflikte bleibt die enge Verbindung zum Körperlichen spannend und für die klinische Arbeit anregend (z. B. Müller-Pozzi, 2008). Aktuelle Modelle zum Verstehen somatoformer Störungen (z. B. Rupprecht-Schampera, 1997; Storck & Warsitz, 2016) beschreiben die Schicksale dieser Wünsche in Abhängigkeit von den Reaktionen der Umwelt.
Beispiel: Klinisch kann ein Auftreten körperlicher Beschwerden (als »Mikrosymptome« in der therapeutischen Arbeit) als ein Versuch verstanden werden, das Erleben starker Affekte in der dyadischen Beziehung (z. B. Nähe und Bezogenheit zum Therapeuten oder Enttäuschungswut) über die Beschäftigung mit etwas »Drittem« (dem Symptom) zu regulieren. So wird eine andere Form der Beziehung zum Therapeuten hergestellt (eine trianguläre Struktur, siehe unten). Das aufmerksame Beachten des Auftretens von somatischen Mikrosymptomen trägt dann zum Verstehen von (triebnahen) Wünschen bei und erschließt biografische Aspekte (Wurden z. B. in der Familie starke Affekte dadurch moderiert, dass körpernahe Versorgungshandlungen oder Pflegehandlungen einsetzten?).
Auch zum Verstehen und zur Differenzierung unterschiedlicher Formen depressiven Reagierens tragen triebtheoretische Konzepte bei.
Die Ich-Psychologie beschreibt, wie sich die Bewältigung von Aufgaben über die Lebensspanne und unterschiedliche soziale Kontexte entwickelt. Das »Ich« vermittelt dabei zwischen Es (und den mit ihm verbundenen, oben beschriebenen »triebhaften« Wünschen), den verinnerlichten Anforderungen des Über-Ich und der Umwelt. Eine möglichst funktionale Abwehr mit den Fähigkeiten, sofortige Befriedigung aufzuschieben und Ängste zu bewältigen, bekommt hier eine große Bedeutung. Sie muss die subjektive innere Welt eines Menschen, seine Anpassung an wechselnde Anforderungen der äußeren Welt und die Realitätsprüfung berücksichtigen (A. Freud, 1936). Es wird davon ausgegangen, dass die Fähigkeit zur Anpassung, Realitätsprüfung und Abwehr in der Entwicklung langsam erlangt wird und sich mit der Zeit entfaltet. Die Ich-Psychologie beachtet besonders die Fähigkeit, sich auf unterschiedliche soziale Situationen einstellen zu können. Schwierigkeiten, sich an gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen anzupassen, werden als bedeutsame Ursache von Störungen betrachtet. Zusammengefasst und etwas vereinfachend kann diese Auffassung zu einem an Normen orientierten Denken führen, in dem eine nach bestimmten Kriterien »optimale« Entwicklungsförderung angestrebt wird. Die Kriterien selbst, so beschreiben es Kritiker der Ich-Psychologie, werden dann nicht mehr oder zu wenig hinterfragt. Aufgabe von Therapeuten ist es in diesem Modell, für die Entwicklung von Funktionen des Ich möglichst gute Bedingungen zu schaffen. In der therapeutischen Arbeit gefördert (und aus entwicklungsorientierter Sicht »nachentwickelt«) werden z. B. Fähigkeiten, auf sofortige Befriedigung von Wünschen zu verzichten (Frustrationstoleranz), Gefühle differenziert wahrzunehmen und für die Steuerung des eigenen Verhaltens zu nutzen (Affektwahrnehmung und Affektdifferenzierung), die Fähigkeit, Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere zu antizipieren und die Toleranz gegenüber Unsicherheit und Uneindeutigkeit (Ambiguitätstoleranz). Auch Empathie mit anderen und mit sich selbst, die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und eigene Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen, kann als eine solche Ich-Funktion beschrieben werden. Dieses Modell der Psychoanalyse ist in moderner Form der akademischen Entwicklungspsychologie nah und mit ihr gut kompatibel.
Das objektbeziehungstheoretische Modell konzentriert sich auf die Geschichte unserer wichtigen Beziehungen in uns – auf die Bildung von Repräsentationen dieser Erfahrungen als innere »Repräsentanzen«. Kinder sind von Geburt an unterschiedlich und stoßen auf unterschiedliche familiäre und soziale Welten. Vorstellungen von anderen und damit einhergehenden Erwartungen werden vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen biologischen Voraussetzungen und sozialer Erfahrungen gebildet. Damit beeinflussen sie die Wahrnehmung und Bewertung zukünftig folgender Erfahrungen – und damit wiederum die Wahrnehmung von anderen und von sich selbst. Eine Einengung der Beziehungsmöglichkeiten auf wenige, sich wiederholende Muster wird als ein unglücklicher und pathogenetisch wichtiger Faktor betrachtet. Gut für Kinder und im späteren Leben für Erwachsene ist es daher, wenn Kinder feinfühlige und auch vielfältig unterschiedliche Erfahrungen in ihren Beziehungen machen.
Das objektbeziehungstheoretische Modell ist in Deutschland vor allem durch die Arbeiten zu schwereren Entwicklungsstörungen wie der Borderline-Persönlichkeitsstörung von Kernberg (z. B. 1975) und über die Arbeiten von Melanie Klein bekannt geworden. Hier wird die Bedeutung genetisch verankerter Vorannahmen zu Beziehungen betont und zugleich auf die Rolle der Phantasie eingegangen, die das kindliche (und erwachsene) Erleben prägt und auch zur nachträglichen Überarbeitung und Bewertung von Erfahrenem beiträgt. Entwicklung ist in diesem Modell mit einer Integration zunächst aktiv getrennt gehaltener Erfahrungen – guter und schlechter Bilder von anderen und von sich selbst – verbunden. Besonders Melanie Klein hat bereits bei kleinen Kindern (in ihrem ersten Lebensjahr) ein reiches inneres Erleben mit der Wahrnehmung von Konflikten und der Abwehr bedrohlicher Vorstellungen beschrieben. Aus dieser Perspektive kann formuliert werden, dass es weniger wichtig ist, wie eine Mutter »wirklich gewesen« ist, als wie sie von diesem – individuellen – Kind erlebt wurde.
Das selbstpsychologische Modell (Kohut, 1976, 14. Aufl. 2007) beschreibt die Entwicklung eines differenzierten und ganzheitlichen Gefühls für das eigene »Selbst« und die dabei zu bewältigenden Aufgaben. Ein anhaltendes Gefühl des eigenen Wertes entsteht bei der Selbstentwicklung innerhalb eines ausreichend guten Umfelds. Vor dem Hintergrund eines interindividuell unterschiedlichen subjektiven Erlebens werden die Entwicklung von Vorstellungen und Bildern von uns selbst und die damit einhergehenden Beziehungsmuster zu anderen Menschen dargestellt. Als Ursache von Störungen im Erwachsenenalter rücken überfordernde Enttäuschungen mit frühen Bindungspersonen, die sich nicht ausreichend empathisch auf das Kind einstellten, in den Vordergrund. Andere Menschen werden als das eigene Erleben stabilisierende Objekte – »Selbstobjekte« betrachtet. Dieser Aspekt menschlicher Beziehungen bleibt lebenslang wichtig. Lob und Anerkennungserfahrungen fördern eine gesunde Entwicklung. Enttäuschungen der kindlichen und für die Entwicklung notwendigen Größenvorstellungen sollten als gut verarbeitbare (»optimale«) Frustrationen erfolgen.
Selbstpsychologische Konzepte sind hilfreich, um Störungen des Selbsterlebens und ihre interpersonellen Auswirkungen zu verstehen.
• Je nach Umfeld differenzierte, zugleich stabile und flexible Grenzen gegenüber anderen Menschen,
• ein Gefühl der Kontinuität des eigenen Handelns und Erlebens und
• Fähigkeiten in der Regulation des Selbstwerts
werden auf gelingende Anerkennungserfahrungen zurückgeführt. Daher ist elterliche Feinfühligkeit in Hinsicht auf die Bestätigung des Erlebens eines Kindes in diesem Modell besonders wichtig. Größenvorstellungen und die Verachtung anderer Menschen werden als Versuche verstanden, Störungen im subjektiven Selbsterleben auszugleichen. Die entwicklungspsychologische Dimension bietet in diesem Modell wieder eine Möglichkeit, sich probeweise mit – sonst schwierig empathisch zu verstehenden – Patienten zu identifizieren und auf diese Weise zusätzlich zu einer objektivierenden Beschreibung einen emotionalen Zugang vor allem zu narzisstisch gestörten Menschen zu gewinnen.
Aktuelle Entwicklungen greifen selbstpsychologische und andere entwicklungspsychologische Aspekte auf. Sie untersuchen die vielfältigen Aspekte der Interaktion in der Beziehung zwischen Analysand und Analytiker mit ihren wechselseitigen Beeinflussungen. In der relationalen Psychoanalyse (Mitchell, 1988), die als eine weitere »Psychologie« der Psychoanalyse aufgefasst werden kann, sind Modelle aus der empirischen Säuglingsforschung für die Konzeptualisierung therapeutischer Interaktionen von Bedeutung. Soziale Beziehungen und Interaktionsprozesse sind in diesen Modellen grundlegend für die Entwicklung des mentalen Systems – nicht umgekehrt. Beebe und Lachmann (2004) beschreiben, wie interaktive Prozesse entstehen und zu Veränderungen führen. Forschung erfolgt hier überwiegend in dyadischen Beziehungen – Interaktionen in therapeutischen Beziehungen und dyadischen Situationen zwischen Mutter und Kind werden verglichen. In Deutschland sind mit der psychoanalytisch-interaktionellen Methode (Heigl-Evers & Heigl, 1973) zunächst in Gruppen Konzepte entwickelt worden, in denen die Gestaltung von Interaktionen im Vordergrund steht. Hier wird ein beziehungsorientierter intersubjektiver Ansatz im therapeutischen Arbeiten konzeptualisiert. Veränderungen des interpersonellen Verhaltens führen dann zu Veränderungen von inneren Mustern und Repräsentanzen.
Die Strukturale Analyse Lacans hat keine eigene Entwicklungspsychologie entwickelt. Dennoch trägt sie mit ihrem Fokus auf symbolische, vor allem sprachliche Prozesse etwas Spezifisches zum Verstehen von Entwicklungsvorgängen bei. Die Beschäftigung mit den Theorien Lacans in diesem Buch stellt eine gewisse Zumutung für Leser dar. Sie müssen sich nicht nur in eine ungewohnte Begrifflichkeit einlesen, sondern sich auch noch mit einer nur kursorischen Darstellung des Themas zufriedengeben. So ist das »Selbst« kein von Lacan verwendeter Begriff. Er zieht ihm die Bezeichnung »Subjekt« vor. Damit grenzt er sich klar von Theorien ab, die einer Entwicklungslogik folgen, in denen frühere Entwicklungsstadien spätere begründen. Im Prinzip sind die verschiedenen Strukturen des Subjekts Ausdruck diskontinuierlicher Zustände. Die Konstituierung des Subjekts erfolgt aus Lacans Sicht sprunghaft, ohne Übergang. Infantilität begreift er wörtlich als anfängliche Sprachunfähigkeit, da »infans« im Lateinischen »stumm« sein oder »lallend« bedeutet. »Subjekt« dagegen heißt übersetzt, der Sprache unterworfen (subjicere) zu sein. Um diesen Aspekt soll es im Folgenden gehen, nämlich zu skizzieren, wie Lacan das Subjekt primär als von der Ordnung der Sprache, der symbolischen Ordnung her verfasst betrachtet.
Ein fundamentaler Unterschied zu anderen Entwicklungstheorien liegt darin, dass Lacan das Subjekt aus der Alterität konzeptualisiert. Alterität meint hier eine »konstitutive Andersheit«. Diese konstitutive Andersheit geht dem Subjekt voraus. Die symbolische Welt existiert vor ihm, bevor das Subjekt sich seiner selbst bewusst wird, und konstituiert es. Das pointiert Lacan, wenn er sagt, das symbolisch verfasste Subjekt sei in erster Linie das Produkt einer diskursiven Erfahrung mit (einem) Anderen, bspw. zuerst repräsentiert durch den mütterlichen Anderen als Vertreter einer symbolischen Ordnung und damit von Sprache und Sprechen: Das Du geht dem Ich voraus.
Mit einem ganz anderen methodischen Ansatz trägt die Bindungstheorie zum Verstehen von Entwicklungen bei. Sie wurde stärker als die vorangegangenen Theorien von der akademischen Entwicklungspsychologie rezipiert und hat diese ihrerseits bedeutend beeinflusst. Die Bindungstheorie und ihre Weiterentwicklungen zählen zu den psychoanalytischen Theorien, auch wenn dies nicht in der gesamten psychoanalytischen Welt so gesehen wird (z. B. Fonagy & Campbell, 2015, dt. 2017). Sie geht von dem Bedürfnis kleiner Kinder nach Sicherheit in der Beziehung zu ihren Müttern aus. Die Sicherung dieser Beziehung, auf die Kinder existentiell angewiesen sind, hat Vorrang vor anderen Bedürfnissen. Die Fähigkeit, sich über Bindungen Sicherheit zu verschaffen, ist über das ganze Leben für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben bedeutsam. Hilfe von anderen Menschen zu gewinnen und anzunehmen, bleibt ein wichtiger Schutzfaktor. In der Bindungstheorie wird beschrieben, wie Kinder sich an das Verhalten ihrer Mütter anpassen. Dies ist ein wechselseitiger Prozess. Der Begriff der »mütterlichen Feinfühligkeit« beschreibt, wie gut oder schlecht eine Mutter die Signale ihres Kindes versteht, geeignete beruhigende Verhaltensweisen findet und die Reaktionen des Kindes angemessen bewertet. Auch die Bindungstheorie ist aus der klinischen Arbeit entstanden. Ihre Konzepte wurden dann aber rasch empirisch geprüft und weiterentwickelt. Beobachtungen an Kindern und Vergleiche mit Befunden der Verhaltensforschung an Tieren zeigten überzeugend ein eigenständiges Bedürfnis nach Bindung. Kinder versuchen, Bindung über unterschiedliche Strategien und in Anpassung an das Verhalten der Mutter zu sichern. Experimentell lassen sich unterschiedliche »Typen« von Bindungsverhalten beobachten. Eine »sichere Bindung« wird als gute Grundlage für die weitere Entwicklung eines Kindes angesehen. Sie bietet die Möglichkeit, vergleichsweise frei zwischen dem Erkunden der Umwelt (Exploration) und dem Erleben der Eltern als »sicherer Hafen« hin und her zu pendeln. Exploration kann daher relativ angst- und konfliktarm und mit einer Rückversicherung durch die Eltern geschehen. Wenn sich die Mutter oder der Vater nicht ausreichend an die Bedürfnisse ihres Kindes anpassen, entwickeln Kinder Strategien, mit denen sie »über Umwege« eine gewisse Sicherheit erreichen können. Diese Beziehungsmodi werden als »unsicher-ambivalent« oder »unsicher-vermeidend« beschrieben ( Kap. 4). Sie sind mit stärkeren Konflikten, erhöhter Angst und mehr Stress verbunden und gelten als Risikofaktoren für spätere Störungen. Dennoch gelingt es Kindern auch hier, sich an die Bedingungen ihrer Umwelt so anzupassen, dass sie sich ein Bild von den zu erwartenden Reaktionen ihrer Bindungspersonen machen können. Sie erleben diese daher in der Regel als verlässlich. Gelingt eine solche Anpassung nicht, wird dies als »Desorganisation« im Bindungsverhalten beschrieben.
Dieses Modell hat einen erheblichen Einfluss auf Entwicklungen in Kindergärten und Krippen. Mit einem besseren Verständnis für Übergänge vom Elternhaus in die Krippe, von dort in den Kindergarten und vom Kindergarten in die Schule entwickelten sich Eingewöhnungsmodelle, in denen darauf geachtet wird, eine angemessene Lösung von den Bindungspersonen zu schaffen. Eine solche zeitweise Trennung erfordert dann, dass Kinder eine andere Person in der Krippe oder im Kindergarten so kennenlernen, dass sie diese als Bindungsperson annehmen. Auf diese Weise kann Angst und Stress gemindert werden.
Die aufgeführten Modelle schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie eignen sich für unterschiedliche Entwicklungsphasen und zum Verstehen unterschiedlicher Menschen unterschiedlich gut und können sich in der Annäherung an ein Gesamtbild ergänzen. Zu Darstellungen wichtiger Vertreter psychoanalytischer Entwicklungstheorien und ihrer Beiträge siehe Streeck-Fischer (2018).