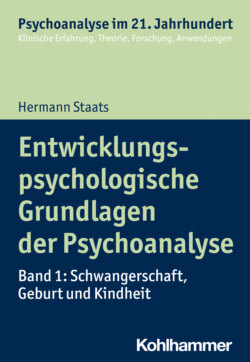Читать книгу Entwicklungspsychologische Grundlagen der Psychoanalyse - Hermann Staats - Страница 8
Оглавление1 Einleitung: Aufbau und Zielsetzung
»Was ist und zu welchem Zweck betreiben wir Entwicklungspsychologie?« Oerter und Montada (2008, S. 3) verweisen darauf, dass in der »etwa hundertjährigen Geschichte der empirischen Entwicklungspsychologie« auf diese Frage unterschiedliche Antworten gegeben wurden. »Verschiedene Forschungstraditionen gingen von unterschiedlichen Fragestellungen und Menschenbildern aus und bildeten unterschiedliche Konzepte und Theorien der Entwicklung«. Siegler et al. (2005, S. XI) beginnen ihr Lehrbuch mit dem Satz: »Es ist eine aufregende Zeit, um ein Lehrbuch über Kindesentwicklung zu schreiben«.
Für psychoanalytische Entwicklungstheorien gilt dies in einem vielleicht noch stärkeren Ausmaß als in der akademischen Entwicklungspsychologie. Tyson und Tyson (1990, dt. 2012) haben ihr klassisches »Lehrbuch der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie« für Studierende geschrieben, die immer wieder durch die »Vielzahl widersprüchlicher und sich ausschließender Theorien« in Verwirrung geraten seien.
Tyson und Tyson zielten auf eine »Synthese psychoanalytischer Entwicklungstheorien« (S. 15). Es ist offen, ob dies heute noch gelingen kann. Es gibt nicht eine einheitliche psychoanalytische Entwicklungspsychologie. Widersprüche und Konflikte tragen zur Faszination des Feldes bei. Beobachtungen an Säuglingen, psychologische, neurobiologische und sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben zu einer Explosion unseres Wissens geführt. Zur Bedeutung dieser Wissensexplosion haben sich psychoanalytische Autorinnen und Autoren sehr unterschiedlich positioniert:
• Die Ergebnisse empirischer Studien zur Entwicklung von Menschen und neue Konzepte der Entwicklungspsychologie werden als wenig wichtig für psychoanalytische Theorien angesehen und ignoriert.
• Einzelne entwicklungspsychologische Konzepte (wie etwa »Bindung« oder »Mentalisieren«) werden Grundlage neuer klinischer Modelle und Behandlungsstrategien. Mit ihnen gelingt es, die Komplexität menschlicher Entwicklung – wieder – auf ein vergleichsweise einfach überschaubares und für die klinische Praxis als Leitschnur nutzbares Modell zu reduzieren. So kann der Anschluss der Psychoanalyse an empirisch arbeitende Wissenschaften leichter gehalten und weiterentwickelt werden.
• Viele primär klinische Beiträge nutzen ausgewählte entwicklungspsychologische Befunde, um das eigene therapeutische Vorgehen zu begründen.
Ein Ziel dieses Buches ist es, die wichtigsten Entwicklungsmodelle innerhalb der Psychoanalyse darzustellen. Wo dies möglich ist, werden die unterschiedlichen Beiträge und Sichtweisen dieser Modelle aufeinander bezogen. Gegensätzliche Auffassungen sind herausgearbeitet, auch ohne dass eine Synthese gelingt. Aktuelle psychoanalytische Fragen und Ergebnisse der empirischen Entwicklungspsychologie werden miteinander verbunden. Historisch wichtige Konzepte sind – in einem besonderen Format erkennbar – kurz dargestellt. Folgerungen für die therapeutische oder pädagogische Praxis werden ebenfalls hervorgehoben präsentiert. Am Ende jedes Kapitels sollen offene Fragen ein Weiterdenken zu den Inhalten fördern.
In diesem Buch wird die Entwicklung des Kindes von der vorgeburtlichen Zeit bis zur Latenzzeit dargestellt. Das Erleben in Beziehungen steht im Mittelpunkt – von der Schwangerschaft bis zum Lernen in Beziehungen zu Lehrerinnen und Lehrern. Die Aufteilung der Kapitel folgt den klassischen Entwicklungsphasen, die durch das Lösen bestimmter Aufgabe gekennzeichnet sind. Der Fokus liegt auf den Übergängen zwischen den Phasen. Die sich hier entfaltenden Konflikte und Entwicklungsaufgaben werden herausgearbeitet und dann wird beschrieben, was die verschiedenen psychoanalytischen Konzepte zu einem Verständnis des Erlebens des Subjekts beitragen.
Übereinstimmungen mit den Ergebnissen anderer Wissenschaften und nicht übereinstimmende Befunde werden dargestellt, so dass sich ein Einblick in aktuelle Forschungen und interdisziplinäre Diskurse ergibt. Wenn Ergebnisse aus anderen Wissenschaften psychoanalytische Theorien ergänzen, in Frage stellen oder bestätigen, wird versucht, Ungewissheiten zu erhalten und zwischen Hypothesen und empirischen Belegen zu unterscheiden.
Entwicklungsstörungen werden in diesem Buch nur beispielhaft betrachtet. Die relativ neue Disziplin der Entwicklungspsychopathologie stellt eine Verbindung aus Klinischer Psychologie und Entwicklungspsychologie dar. Der Komplexität dieser interdisziplinär ausgerichteten Forschungsrichtung gerecht zu werden, würde das Ausmaß dieses Buches sprengen. Beiträge zu Krippen, Kindergärten und Schulen aus psychoanalytischer Sicht werden als Teil der allgemeinen Entwicklung dagegen einbezogen. Viele entwicklungspsychologische Konzepte lassen sich in einer Lebensphase besonders plastisch darstellen; sie bleiben aber über lange Zeiträume der Lebensspanne wichtig. Ein chronologischer Aufbau – wie in diesem Buch angestrebt – kann daher nur unvollkommen gelingen. Ergänzend wird daher versucht, Methoden und Konzepte auch in ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte darzustellen und dabei den (auch historischen) Diskurs aufzuzeigen, in dem sie entstanden sind.
Beispiel:
Mit der objektbeziehungstheoretischen Ausrichtung psychoanalytischer Theorien hat sich das Interesses an der Entwicklungspsychologie auf die ersten beiden Lebensjahre verlagert. Psychische Struktur wird als Resultat verinnerlichter Objektbeziehungen verstanden, für die diese Zeit von besonderer Bedeutung ist. Dies hat konkrete behandlungstheoretische Auswirkungen – Analytiker verstehen sich (wiederum durchaus unterschiedlich) in einer dyadisch strukturierten Behandlungssituation, in der im »Hier und Jetzt« der Beziehung gearbeitet wird. Beziehen sich Analytiker stärker auf andere Modelle (z. B. das Mentalisieren oder auf ödipale Konflikte und trianguläre Strukturen), ergeben sich andere Beziehungs- und Übertragungsmuster. Analytiker könnten vor dem Hintergrund anderer Entwicklungstheorien dann die Rollen und Funktionen eines fördernden Trainers, eines präsenten feedbackgebenden Gegenübers oder eines neidischen, fördernden, bewundernden oder kritisch missbilligenden Dritten einnehmen.
Entwicklungspsychologie, Sozialisationsforschung, Neurobiologie, Genetik und Entwicklungspsychopathologie wachsen teilweise zu einer neuen Disziplin zusammen, die als »Entwicklungswissenschaft« bezeichnet wird. Es liegt in der Tradition des neugierigen Denkens Freuds, Ergebnisse aus Nachbarwissenschaften aufzugreifen und für ein Verstehen subjektiver seelischer Prozesse zu nutzen. Die Konzepte, auf die sich Therapeutinnen und Therapeuten dabei beziehen, haben Auswirkungen auf ihre jeweilige Behandlungspraxis. Die Vielfalt psychoanalytischer Theorien wird in diesem Buch als eine Bereicherung angesehen – und zugleich mit dem Wissen um die Beschränkung eines einzelnen Ansatzes (und mit Kenntnissen zu seiner Entstehung) verbunden. Vor diesem Hintergrund wird auch auf »Klassiker« der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie zum Weiterlesen hingewiesen. Ziel ist es, dem Leser und der Leserin einen Überblick zu verschaffen, der es ermöglicht, das Gelesene einzuordnen und zu relativieren. Es soll neugierig machen und zum Weiterlesen anregen.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Oerter. R. & Montada, L. (Hrsg.) (2008). Entwicklungspsychologie (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
Siegler, R., DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2005). Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. München: Spektrum.
Tyson, P. & Tyson, R.-L. (1990, dt. 2012). Lehrbuch der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.