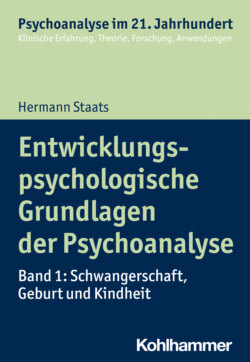Читать книгу Entwicklungspsychologische Grundlagen der Psychoanalyse - Hermann Staats - Страница 14
2.3 Ordnungsversuche und »Bilder vom Kind«
ОглавлениеIn der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie bleibt bis heute die Bezugnahme auf eine vertikale Perspektive dominierend: Die Eltern, in der weiteren Entwicklung der psychoanalytischen Theorien überwiegend die Mutter, und die Beziehung des Kindes zur Mutter bzw. den Eltern werden betrachtet. Beziehungen zu Geschwistern, Freunden, Liebespartnern spielten für die Konzeptualisierung und Konstruktion von Entwicklungen eine vergleichsweise geringere Rolle. Ein solcher Fokus auf einer »dyadischen« Zwei-Personen-Beziehung dient zunächst der Verringerung von Komplexität. Dies ist für Forschung an Grundlagen ein sinnvoller Weg. Klinisches Denken und Verstehen kann durch die Übernahme von solchen »empirisch gesicherten« Modellen aber auch eingeschränkt werden. Schon das Denken in triadischen Perspektiven, mit »ödipalen« Konflikten und unterschiedlichen Perspektiven von Kind, Mutter und Vater, erschwert es, Gewissheiten zu finden. Auch kulturelle Einflüsse erhalten oft wenig Aufmerksamkeit. Ziel ist es häufig, kulturell übergreifende Muster (z. B. Bindungstypen oder den Ödipuskomplex) zu finden und zu untersuchen. Erst mit Erreichen der Adoleszenz wird die Bedeutung der Kultur deutlicher thematisiert – etwa in dem Modell, Kinder würden zunächst in die Familie, dann (in der Adoleszenz) in die Gesellschaft sozialisiert.
Die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Mutter-Kind-Dyade hat praktische Auswirkungen – etwa zur Frage der Bedeutung von Mehrpersonenbeziehungen in den ersten Lebensjahren, zur Frage des Umgangsrechts der Väter oder der Krippenerziehung. Die Psychoanalytiker und empirischen Entwicklungsforscher von Klitzing und Stadelmann (2011) fragen, ob Psychoanalytiker mit ihren Vorstellungen und Idealisierungen einer frühen Mutter–Kind-Beziehung nicht »weit hinter unserer Zeit herlaufen«. Die konzeptuelle Beschränkung auf dyadische Muster wird auch mit Verweis auf empirische Befunde kritisiert. Schachter (2005, dt. 2006, S. 466) schreibt,
»entwicklungspsychologische Studien zum Bindungsverhalten zeigen einen vergleichsweise schwach ausgeprägten Zusammenhang mit Störungsmustern bei Erwachsenen. Dass sich solche Studien in erster Linie auf die Mutter-Kind-Beziehung konzentrieren, ohne das Gewicht von Bindungen an andere Bezugspersonen wie Geschwister oder Spielkameraden zu berücksichtigen, und dass sie das Kind nicht wie ein Wesen behandeln, das sich weiterentwickelt, wird kritisiert«.
So ergibt sich erneut ein mehrdeutiges Bild des Kindes und der Kinder: Auf der einen Seite wird die hohe Bedeutung der ersten Lebensjahre für die weitere Entwicklung in unserer Kultur inzwischen mit hoher Übereinstimmung geteilt, auch in der akademischen Psychologie (etwa Oerter & Montada, 2008, S. 94 f.). Auch die psychoanalytische Sicht auf das Kind als aktives Subjekt, das die Beziehung zu den Eltern und der Welt früh mitgestaltet, wird Teil des akzeptierten Allgemeinwissens. Frühe Beobachtungen von Sigmund Freud, Anna Freud, Melanie Klein und anderen trugen dazu bei, Kinder als handelnde Subjekte in Beziehungen zu betrachten. Das Buch von Martin Dornes »Der kompetente Säugling« (1993) hat in Deutschland eine wichtige Funktion zur Popularisierung dieser Auffassungen und zur Aufklärung über frühe kindliche Kompetenzen übernommen.
Wir haben oben gesehen, dass psychoanalytische Theorien unterschiedliche Aspekte von Entwicklung in den Blick nehmen – selbst wenn sie alle einem subjektiven, verstehenden Ansatz verpflichtet sind. Die Vielfalt möglicher Perspektiven auf Entwicklung muss durch einen Überblick über Entwicklungsmodelle aus anderen Wissenschaften ergänzt werden. Subjektivität und ihre Entwicklung kann nicht gut ohne einen Bezug auf somatische, kognitive, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen verstanden werden. Dabei können vier Sichtweisen unterschieden werden:
• Die normativ beschreibende der in einem bestimmten Lebensalter zu erwartenden Fähigkeiten,
• die Reihenfolge der interpersonell wirksamen »Organisatoren« (Verhaltensweisen wie soziales Lächeln oder Fremdeln, siehe unten) von Entwicklungsschritten,
• neurobiologische Aspekte von Entwicklung und
• Veränderungen des Selbstbilds.
Eine erste Möglichkeit der Darstellung von Entwicklung ist die Orientierung an der Entwicklung durchschnittlich zu erwartender Fähigkeiten. Sie spielt vor allem in den frühen Lebensjahren eine große Rolle – beim Lernen von Schlafen, Sprechen, Essen, dem Erwerb von Kontrolle über den Stuhlgang, dem Lesen usw. Für Kinder lassen sich hier normative Erwartungen von Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen formulieren. Im jungen Erwachsenenalter, im Erwachsenenalter und höheren Alter gelingt dies schwerer. Hier wird immer deutlicher, wie sich Entwicklungsaufgaben differenzieren. In Abhängigkeit vom Lebensalter und von sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen wird es schwieriger, für bestimmte Lebensphasen Listen der zu erwartenden Fertigkeiten zu erstellen.
Einfacher – und in den Kapiteln 4, 5 und 6 dargestellt ( Kap. 4, Kap. 5, Kap. 6) – ist es, Veränderungen der affektiven Regulation von Beziehungen zu beschreiben, die an die kognitive und somatische Reifung gebunden sind. Hier hat René Spitz (1965) anhand sorgfältiger Beobachtungen vier »Organisatoren« von Entwicklungsvorgängen entwickelt. Sie sind auf die interpersonelle Regulation von Verhalten bezogen:
• Das noch nicht an die Wahrnehmung einer Person gebundene Lächeln des Neugeborenen, das »Engelslächeln« der ersten zwei Lebensmonate wird ersetzt durch das »Dreimonatslächeln«, das ein Erkennen eines zugewandten menschlichen Gesichts beschreibt und eine Interaktion einleitet.
• Die etwa im achten Lebensmonat beginnende Fremdenangst, die deutlich macht, dass das Kind unterscheiden kann zwischen vertraut und unvertraut und dass es aktiv auf Erinnerungsspuren zur Interpretation einer Situation zurückgreift.
• Das »Nein« des Kindes und der Beginn des sich »Selbst«-Behauptens im Trotz im zweiten und dritten Lebensjahr.
• Und das Erreichen von Objektkonstanz (und, so wäre heute zu ergänzen: Mentalisierungsfähigkeit in triadischen Beziehungen) im Alter von etwa vier Jahren.
Für zahlreiche psychoanalytische Konzepte finden sich inzwischen neurobiologische Korrelate. Kapitel 3 geht auf die Entwicklung von Individualität ein ( Kap. 3). Sie ist auch mit einem Verlust von möglichen Kompetenzen durch den Abbau von Nervenzellen verbunden, die in den ersten Lebensmonaten nicht »benutzt« werden. Dieser Entwicklungsprozess wird als ein »Ausjäten«, »Priming« beschrieben. An vielen Stellen des Buches wird auf die mit diesen Einschränkungen weiter bestehende hohe Flexibilität des menschlichen Gehirns Bezug genommen. Lebenslanges Lernen ist mit einem Erleben und Bewältigen von Konflikten verknüpft. Es zeigt sich auch in Umbauten an der »Hardware« unseres Gehirns, seiner »Struktur« (siehe unten).
Mit den Veränderungen des Erlebens anderer Menschen verändert sich auch das Selbstbild eines Menschen. Aus einer subjektiven Sicht kann für die verschiedenen Entwicklungsphasen formuliert werden:
• »Ich bin, was Du mir zeigst« charakterisiert die Erfahrungen des Kindes mit der frühen Affektregulation in dyadischen Beziehungen. Vor allem die Mutter benennt und »spiegelt« in unserer Kultur das Erleben ihres Kindes ( Kap. 4).
• »Ich bin ›der‹ oder ›die‹ für Dich« drückt die Erfahrungen des aktiven Erprobens der Geschlechtsrolle und des Findens des eigenen Platzes in der Familie in der ödipalen Entwicklungsphase aus ( Kap. 7).
• »Ich bin, was ich kann« kennzeichnet das Erleben eines Kindes in der Latenzphase (»Ich kann schon lesen«, »Ich gehe schon in die Schule«, »Ich kann schon Radfahren«; Kap. 9).
Die in diesem Abschnitt kurz dargestellten somatischen, kognitiven und das Selbstbild betreffenden Entwicklungsschritte verändern dauerhaft das Erleben eines Menschen. Solche dauerhaften Veränderungen – auch wenn sie in einem nicht unerheblichen Maße flexibel bleiben – werden als »Struktur« bezeichnet. Seelische Strukturen bilden den stabileren Hintergrund des subjektiven Erlebens eines Menschen, das aus psychoanalytischer Perspektive meist unter dem Modell äußerer und innerer Konflikte betrachtet wird. Der folgende Abschnitt beschreibt die Bildung solcher Strukturen.