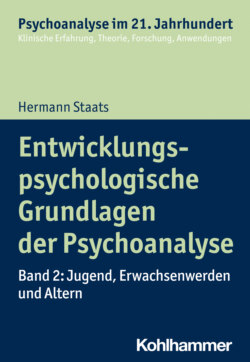Читать книгу Entwicklungspsychologische Grundlagen der Psychoanalyse - Hermann Staats - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 »Ich bin, was ich kann« – Latenzzeit, Lernen und das Selbstbild
ОглавлениеDie Zeit der Grundschule, die »Latenzzeit«, kann als prägend für das Bild von »Kindheit« gesehen werden, das wir in unserer westlichen Kultur haben. Kinder lernen und werden mit dem Erwerben neuer Kompetenzen zunehmend selbständiger. Die Sprache und das symbolische Denken entwickeln sich, die Motorik wird differenziert und geübt. Radfahren, Schwimmen, Klettern, Lesen, Schreiben und Rechnen werden erlernt. Neue Aufgaben werden mit zunehmend höherer Autonomie übernommen. Diese zunehmende Selbständigkeit entfaltet sich vor dem Hintergrund und im Schutz der Familie. Sorge der Eltern wird oft schon als einengend erlebt. Kinder denken – wie »Hänschen klein« das tut – bereits an das Hinausgehen in die Welt und erleben sich als dazu fähig. Die scheinbare Rücksichtnahme auf die Eltern (»Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr! Da besinnt sich das Kind, kehrt nach Haus geschwind.«) ist auch ein Schutz vor der Kränkung, noch auf die elterliche Sorge angewiesen zu sein. Eltern kreditieren hier Kompetenzen – sie schreiben ihren Kindern wachsende Fähigkeiten zu und fördern damit eine Verselbständigung. Aus Sicht des Selbsterlebens von Kindern kann die Latenzzeit beschrieben werden mit einem – »Ich bin, was ich kann«. Ich kann jetzt schwimmen, lesen Rad fahren, in die Schule gehen – die Veränderungen sind mit Übergängen in neue Gruppen verbunden und verändern so das Selbsterleben (»Schwimmer« sein und »Schulkind«). Konflikte ranken sich um das lustvolle Erleben der eigenen Kompetenz und das »Noch-nicht-Können« mit Gefühlen von Versagen und Minderwertigkeit. Als Lösung entwickelt sich idealtypisch ein Vertrauen des Kindes auf seine grundlegenden sozialen und intellektuellen Fähigkeiten. Dieses Vertrauen in sich schlägt sich als verinnerlichte Struktur in den Erwartungen an Beziehungen zu anderen Menschen nieder – das Kind trägt etwas zum gemeinsamen Leben bei. Es traut sich zu, mehr und mehr zu lernen und zu sein. In Verbindung damit wird die Phantasiewelt deutlicher von der realen Welt getrennt. Egozentrische Sichtweisen nehmen ab, unterschiedliche Perspektiven werden selbstverständlicher berücksichtigt. Kinder können jetzt über sich selbst nachdenken und sich in andere Menschen einfühlen. Dennoch bleiben diese Entwicklungen instabil. Magisches Denken und egozentrische Sichtweisen haben weiterhin Bestand, die Desillusionierung der Eltern bleibt noch reversibel – in Krisensituationen wird auf Idealisierungen regressiv zurückgegriffen. Soziale und intrapsychische Konflikte können immer wieder schnell zu regressiven Zuständen führen.
Beispiel:
Ein 10-jähriger Junge ist tief unglücklich über einen verwandelten Elfmeter gegen seine Lieblingsmannschaft. Er bedrängt tränenüberströmt seine Mutter: »Das war ungerecht! Ruf da an!«
Das eigene subjektive Erleben und die Positionierung in Beziehungen wechseln rasch. Zur Regulation von Affekten und Größenvorstellungen werden die Eltern daher noch selbstverständlich in Anspruch genommen. Regeln und Normen der Familie und auch anderer Gruppen sind wenig hinterfragt. Konflikte zwischen Über-Ich und Ich spielen noch eine geringe Rolle. Treten sie auf, werden sie manchmal mit einem als »altklug« beschriebenen Verhalten moderiert – Kinder beobachten das »merkwürdige« Verhalten Erwachsener in dieser Zeit auch mit einem Gefühl unreflektierter Überlegenheit, die noch nicht von der Erfahrung einer Beschränktheit der eigenen Möglichkeiten moderiert ist. In solchen Interaktionen nimmt die Autonomie von Ich und Über-Ich zu. Es entwickelt sich ein individuelles Identitätsgefühl, mit dem die verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten und Identitätsaspekte zusammengehalten werden.