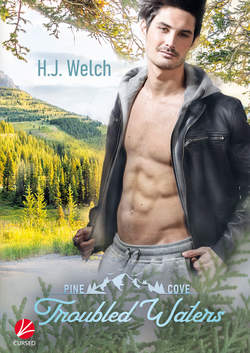Читать книгу Troubled Waters - H.J. Welch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 6
ОглавлениеEmery
»Verdammte Scheiße«, krächzte Duffy, als Emery ihn am nächsten Tag in seine Wohnung mitnahm. »Der hat wirklich alles demoliert.«
Emery biss die Zähne zusammen. Er wollte sich nicht ärgern über diesen Idioten. Er war brav gewesen, hatte mitgespielt und die Nacht in dem Motel verbracht. Es war bei Weitem nicht die Katastrophe gewesen, die er befürchtet hatte, aber das hätte er niemals laut zugegeben. Besonders nicht nach diesem Kommentar.
»Das meiste Durcheinander stammt von mir. Er hat nur einige Regale abgeräumt, aber nichts kaputt geschlagen.«
Er betrachtete traurig das Pulver, das die Spurensicherung an den Türrahmen und Griffen hinterlassen hatte. Am Safe sah es wahrscheinlich nicht viel besser aus. Es würde noch eine Weile dauern, bis sie erfuhren, ob fremde Fingerabdrücke gefunden wurden. Emery war sich allerdings ziemlich sicher, dass der Eindringling Handschuhe getragen haben musste, als er ihn durchs Treppenhaus jagte.
»Oh«, sagte Duffy.
Er meinte zweifelsohne die Krümel, die Wäsche – sauber und schmutzig –, die Stapel alter Fotorahmen, Speisekarten, Stromrechnungen und Theaterprogramme. Um ehrlich zu sein, trugen die paar ausgeräumten Schubladen kaum zu dem Chaos bei, das im Wohnzimmer herrschte. Überall lag irgendwelcher Mist auf dem Boden verstreut – aufgerissene Verpackungen von Batterien, alte Geburtstagskarten und Magazine mit Sushi-Rezepten, für die ihm seine Mom zu Weihnachten ein Abonnement geschenkt hatte, obwohl er nie selbst kochte.
»Ja, ich wohne in einem Schweinestall«, sagte Emery müde. Er brachte nicht die Energie auf, um zu erklären, dass Aufräumen ihn psychisch belastete. Die meisten Menschen hielten ihn einfach nur für faul. Manchmal rechtfertigte er sich mit seinem Job und sagte, vierundzwanzig Stunden Kreativität am Tag wären zu anstrengend, um auch noch über Staubsaugen nachzudenken. Heute war das nicht der Fall. »Normalerweise kommt donnerstags eine Putzfrau. Sie ist wunderbar, aber ich habe ihr für diese Woche abgesagt. Ich will ihr nicht zumuten, sich mit einem gottverdammten Tatort abzuplagen. Ich will das gröbste Chaos erst selbst beseitigen.«
Emery seufzte. Er wusste nicht, wann er dazu die Zeit finden sollte, weil er morgen schon seine Reise antreten musste. Aber er wollte Lola nicht im Stich lassen. Sie machte seine Wohnung zu einem Zuhause und ohne sie würde er durchdrehen.
Duffy sah sich im Wohnzimmer und in der Küche um. »Dann habe ich ja Beschäftigung, bis du gepackt hast.«
Emery blinzelte. »Hä? Nein. Du musst hier nicht aufräumen. Das wäre mir peinlich.«
»Warum?« In Duffys Worten lag keine Feindseligkeit, im Gegenteil. Emery hätte schwören können, sogar einen freundlichen Unterton zu hören. »Bei dir ist eingebrochen worden. Die meisten Menschen verstehen nicht, wie schrecklich sich das anfühlt. Es ist eine schwere Verletzung der Privatsphäre. Außerdem würde mir meine Ma nie verzeihen, wenn ich hier einfach nur untätig rumsitze, obwohl so viel zu tun ist.« Er stieß sich mit dem Daumen an die Brust. »Katholisch«, erklärte er. »Ich rolle gerne die Ärmel hoch und packe mit an. Mit den Händen bin ich gut.«
Verdammt, das nehme ich dir ungeprüft ab. In Emerys Kopf überschlugen sich die Fantasien. Was hätte er nicht darum gegeben, dieses Chaos zu vergessen und sich direkt ins Schlafzimmer zu begeben, damit Duffys Hände etwas zu tun hatten. Aber solche Gedanken waren gefährlich, weil der Mann nicht nur heterosexuell war, sondern Emery außerdem auch noch sein Auftraggeber.
Er hätte gerne geglaubt, dass Duffy ihm seine Hilfe beim Aufräumen anbot, weil er Emerys Probleme mit der Hausarbeit verstand. Aber warum sollte Duffy sich von den anderen unterscheiden, die Emerys mangelnde Fähigkeiten bei der Hausarbeit einfach nur als Faulheit verurteilten? Sie waren der Grund, warum Emery lieber seine Freunde besuchte und nie jemanden mit in seine Wohnung brachte, auch die Männer nicht, mit denen er sich einließ. Wenn es irgendwo saubere öffentliche Toiletten gab, war ihm das lieber, als einem Mann zuzumuten, sich den Weg durch schmutzige Socken und Federboas bahnen zu müssen.
Sonics Käfig war die einzige Ausnahme. Den hielt Emery immer makellos sauber. Die Wohnung kam ihm ohne den kleinen Igel so leer vor. Er hoffte, dass Sonic sich bei seiner Tante Ava wohlfühlte und dass der neue Käfig schon geliefert worden war.
Emery war in der Nacht schreiend und schweißgebadet aufgewacht. Er hatte geträumt, er wäre nicht rechtzeitig zurückgekommen, um Sonic zu retten. Duffy, der im Nebenzimmer schlief, kam sofort angerannt, als er Emery schreien hörte. Er hatte an die Tür getrommelt und gefragt, ob alles in Ordnung wäre. Nachdem sich Emerys rasendes Herz wieder etwas beruhigt hatte, musste er sich eingestehen, dass er das verdammt sexy fand.
Er biss sich auf die Lippen und führte Duffy in die Küche, damit er sich dort ums Geschirr kümmern konnte. Es war eine einfache Aufgabe und Emery musste ihm nicht erst erklären, wo was aufbewahrt wurde. Duffy musste nur das Geschirr abspülen und in die Spülmaschine stellen. Emery wollte das Pulver abwischen, mit dem die Spurensicherung die halbe Wohnung eingepudert hatte.
Er hatte damit gerechnet, sich in Duffys Gegenwart unbeholfen und wertlos zu fühlen. Die meisten Menschen konnten nicht verstehen, warum ihm seine Arbeit so wichtig war. Sie sahen in ihm nur ein Möchtegern-Model, das dafür bezahlt wurde, Urlaub zu machen. Aber so war das nicht. Emery hatte nur meistens nicht die Kraft, um diese Fehleinschätzung richtigzustellen und den Menschen zu erklären, worum es bei seiner Arbeit wirklich ging. Schon gar nicht bei weißen, heterosexuellen Männern.
Doch obwohl ihm Duffy höllisch auf die Nerven fiel, weil er aus jeder Mücke einen Elefanten machte, hatte sich Emery in seiner Gegenwart nie wie ein Versager gefühlt. Sie waren so unterschiedlich, dass sie nie etwas gemeinsam haben würden, doch Duffy hatte ihm nie das Gefühl gegeben, als müsste er Verständnis für diese Arschlöcher haben, die ihn ständig zu lynchen drohten oder ihm Aids anhängen wollten.
Lag das nur an Duffys Professionalität? Wahrscheinlich musste er in seinem Job zu jedem Auftraggeber höflich sein. Emery hasste solche Menschen und wollte nicht, dass Duffy ihm etwas vorspielte. Sosehr er sich auch wünschte, dass der Mann, mit dem er unerwartet so viel Zeit verbringen musste, ihn vielleicht nett fand. Ehrlichkeit war ihm lieber. Wenn Duffy sich insgeheim durch Emery und das, wofür er stand, beleidigt fühlte, wollte er das wissen.
»So«, sagte er und riss eine Packung Desinfektionstücher auf, um die Küchentür abzuwischen.
Duffy sah ihn über die Schulter an. Er hatte seinen Anzug gegen bequeme Jeans und einen Hoodie ausgetauscht, an dem er tatsächlich die Ärmel hochgerollt hatte, um das Geschirr zu spülen. Hm. Und er war tätowiert. Emery versuchte sich einzureden, dass Tattoos nicht attraktiv wären, aber das war gelogen. Die Farben glänzten auf Duffys Haut und erweckten die Tiere und Fabelwesen zum Leben.
Was hatte er eben noch sagen wollen? Oh, richtig. Er wollte mehr über Scouts Hintergrund herausfinden.
»Bin ich die erste Queen, mit der du dich rumärgern musst? Das war bestimmt ein Schock.« Er ließ die Hand provokativ über den Türrahmen gleiten, als wäre es ein Stripper-Pole oder – noch besser – ein riesiger Schwanz.
Duffy zog unbeeindruckt eine Augenbraue hoch und drehte sich wieder zum Spülbecken um. »Nein.«
»Nein?«, wiederholte Emery, doch Duffy ging nicht näher darauf ein. War Emery nicht sein erster schwuler Klient oder wollte Duffy ihm damit sagen, dass er nicht über andere Klienten mit ihm reden wollte? Er versuchte es mit einem anderen Ansatz. »Weißt du, womit ich mein Geld verdiene? Warum dieser Kerl und die anderen hinter mir her sind?«
Duffy nickte, drehte sich aber nicht zu ihm um. Er konzentrierte sich ganz darauf, die Teller abzuspülen. »Du hast einen YouTube-Kanal und produzierst seit einigen Jahren Videos. Dein Markenzeichen ist aber der Instagram-Account. Du hast angefangen, LGBT-Kommentare mit betrunkenen Synchrontexten zu überblenden und erscheinst seitdem in offiziellen Musikvideos und Realityshows im Fernsehen. Deine größte Leistung ist eine Stiftung, die Over The Rainbow Foundation, die schon Tausende von Dollars für LGBT-Jugendliche gesammelt hat. Sie unterstützt vor allem Bildungsprojekte, Heime für obdachlose Jugendliche und Rechtshilfeorganisationen.«
Emery hatte mittlerweile mit dem Putzen aufgehört und starrte Duffy mit offenem Mund an.
Okay, in Ordnung. Er hatte sich also den Lebenslauf seines Klienten eingeprägt. So beeindruckend war das auch wieder nicht. Und nur, weil man ihm nicht anhörte, dass er bei seinem Vortrag mit den Augen rollte, musste das noch lange nicht stimmen. Schließlich konnte Emery sein Gesicht nicht sehen.
»Äh, ja«, sagte er und versuchte, sich wieder zusammenzureißen. »Das bin ich.«
Duffy nickte. »Deine Arbeit ist wichtig und gut. Mein Alter und ich haben uns nie sehr gut verstanden, aber er hat mir beigebracht, einen Mann zu schätzen, der etwas aus sich macht. Du hast deine ersten Videos mit deinem Handy im Schlafzimmer gedreht. Jetzt gibst du gefährdeten Jugendlichen ein Dach überm Kopf und finanzierst ihre Ausbildung.«
Emery biss sich auf die Lippen. Er hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Nein, nein, nein. Er brauchte keine Zustimmung – von niemandem. Schon gar nicht von einem Mann wie Duffy. Duffys Meinung sollte für ihn sowieso keine Rolle spielen. Emerys emotionale Reaktion war nicht mehr als die Erleichterung darüber, dass er nicht schon wieder niedergemacht wurde. Das war alles.
»Ja, gut. Die meisten Leute denken, ich mache nur Tamtam und eine Unmenge an Drama und die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es mich nicht gäbe.«
Duffy zog eine Augenbraue hoch und sah ihn über die Schulter an. Emery putzte schnell weiter. »Diese paar Idioten sind nicht die meisten Leute. Vergiss sie. Auf jedes von diesen Arschlöchern kommen Hunderte von Kindern und Jugendlichen, denen du geholfen hast. Selbst wenn sie nur deine Videos ansehen und wissen, dass sie nicht allein sind.«
Dem konnte Emery nicht widersprechen. »Ja«, sagte er abwesend. »Ich wette, du hattest als Jugendlicher mehr Vorbilder. Ich hatte niemanden. Null.«
Duffy schnaubte und stellte mit einem lauten Knall einen Teller in die Spülmaschine. Oh, das hatte ihm nicht gefallen. Emery kniff die Augen zusammen. Vielleicht hörte er nicht gerne, dass er mit einem Privileg auf die Welt gekommen war? Wie viele heterosexuelle, weiße und attraktive Mittelklassemänner hatte Emery schon erlebt, die ihm mit knirschenden Zähnen vorgeworfen hatten, dass er von ihnen eine Entschuldigung verlangte für etwas, wofür sie nicht verantwortlich wären? Dass sie sich alles verdient hätten, was sie erreicht hatten?
Emery würde nie jemandem vorwerfen, dass er nicht hart gearbeitet hätte, um im Leben etwas zu erreichen. Aber es machte ihn wütend, wie viele von ihnen einfach ignorierten, dass es auch Menschen gab, die weniger glücklich waren. Menschen, die Widerstände überwinden mussten, die sich die Mehrheit dieser Privilegierten im Traum nicht vorstellen konnte.
Und genau deshalb hatte er seine Internet-Karriere als Influencer eingeschlagen. Er hatte vor etlichen Jahren niemanden gefunden, der für ihn sprach und Geschichten aus einem Leben erzählte, mit dem Emery sich identifizieren konnte. Er hatte sich gewünscht, einmal – nur einmal – den Fernseher einschalten oder ins Internet gehen und sagen zu können: Oh mein Gott, ja… Das bin ich.
Sollte dieser verdammte ekleinhater doch seine Morddrohungen schicken. Sollten er und die anderen Trolle seine Posts doch mit ihren gehässigen Kommentaren überschwemmen. Sollten sie sich doch gegenseitig einreden, dass Emery das Schlimmste war, was sie jemals erlebt hatten.
Emery würde nicht aufhören. Niemals.
Weil Duffy recht hatte. Diese Kommentare hatten nichts zu bedeuten. Natürlich wusste Duffy nichts von dem Schuhkarton unter Emerys Bett, in dem die Ausdrucke von E-Mails, persönlichen Nachrichten und sogar einige echte Briefe lagen, die er von Jugendlichen bekommen hatte und in denen sie sich bei ihm bedankten. Weil er ihnen das Leben gerettet hätte. Weil er ihnen Kraft gegeben hätte, nicht aufzugeben in einer Welt, in der niemand auf ihrer Seite stand. Jugendliche, die von ihrer Familie aus dem Haus geworfen worden waren. Die in der Schule jeden Tag verprügelt wurden, die angespuckt wurden und erbarmungslos gehänselt.
Emery Klein war ein Vorbild für die vielen Jungs, die sich schämten, weil sie in der Schule Theater spielten oder Cheerleader werden wollten. Für die vielen schwulen Jungs, die nicht wussten, wo sie hingehörten. Für die vielen, die genderfluid waren und sich wieder und wieder anhören mussten, dass sie nicht normal wären und sich gefälligst für eine der gesellschaftlich akzeptierten Schubladen entscheiden sollten. Emery wusste verdammt gut, dass er etwas Größeres repräsentierte als nur sich selbst.
Es war nicht so, dass er gerne Angst hatte. Und er wollte definitiv nicht sterben. Aber wenn er starb, würde er ein Vermächtnis hinterlassen, das ihn überlebte. Dessen war er sich sicher.
Jemand wie Scout Duffy – ein blauäugiger, typischer amerikanischer Mann – mochte über die Idee spotten, dass die Welt auch Vorbilder wie Emery brauchte. Das war kein Problem. Emery musste ihm nichts beweisen. Er musste sich nur weiter den Arsch aufreißen und seinen Namen, sein Gesicht und seine Botschaft verbreiten, so weit und so lang er nur konnte.
Und im Moment bestand seine Arbeit darin, dieses gottverdammte Pulver loszuwerden, das die Spurensicherung in seiner Wohnung hinterlassen hatte. Es sah hier aus, als hätte jemand einen Sack Mehl ausgeschüttet.
»Weißt du was? Ich schaffe das schon«, sagte er und wischte weiter an seinem Türrahmen, ohne Duffy anzusehen. »Wenn du im Auto warten oder noch irgendwas anderes unternehmen willst, ist das in Ordnung.«
Wie aufs Stichwort schloss Duffy die Spülmaschine und drückte auf den Startknopf. »Schon gut«, sagte er. »Viele Hände machen die Arbeit leichter. Und das habe ich von meiner Ma gelernt. Ich kann die restlichen Türrahmen übernehmen, falls dir das recht ist. Dann kannst du schon mit dem Packen anfangen.«
Gottverdammt aber auch. Warum musste der Kerl alles so ruhig und unkompliziert angehen? Emery brauchte etwas Abstand und wollte allein sein, um diesen Mist zu verdauen. Ohne dass irgendwelche wohlmeinenden Freunde ihn umsorgten oder gar ein bezahlter Leibwächter ihn auf Schritt und Tritt beobachtete.
»Wenn du mich schon rumkommandierst, sollten wir vorher wenigstens ein Safeword vereinbaren.« Emery grinste und hoffte, Duffy mit dieser Anspielung auf schwule Kinks aus der Ruhe zu bringen. »Wusstest du schon, dass ich ein Sub bin? Ich stehe auf große, harte Männer, die das Kommando übernehmen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass du darin viel Erfahrung hast, oder? Du bist ein so guter Junge.«
Damit hatte er Erfolg. Duffy sah in definitiv stürmisch an, als er sich wütend die Hände abtrocknete. »Ich wische jetzt die Wohnungstür ab«, sagte er barsch. »Von außen. Lass mich wieder rein, wenn ich klopfe, ja?«
Gewonnen! Emery grinste, als Duffy an ihm vorbeimarschierte und sich einige Wischtücher aus der Packung nahm. »Selbstverständlich«, sagte er und konnte seine Schadenfreude kaum verhehlen. »Und wenn ich geputzt und gepackt habe, muss ich in der Stadt noch einige Dinge erledigen. Es macht dir doch nichts aus, mich zu chauffieren, oder?«
»Wie du meinst«, knurrte Duffy und schlug hinter sich die Tür zu.
Und wieder grinste Emery und redete sich ein, dass er gewonnen hätte.
Er merkte erst sehr viel später, dass er gar nicht recht wusste, was er eigentlich gewonnen hatte oder warum ihm das so wichtig war.