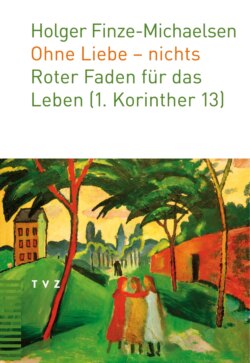Читать книгу Ohne Liebe - nichts - Holger Finze-Michaelsen - Страница 8
Die Hebräische Bibel wird griechisch
ОглавлениеWas heute in der Christenheit gewöhnlich als das «Alte Testament» bezeichnet wird (oder auch als das «Erste Testament» oder die «Hebräische Bibel»), ist hauptsächlich |17| in der hebräischen Sprache überliefert. Neben Jüdinnen und Juden können heute nur wenige in dieser Originalsprache einen biblischen Text lesen; diese wenigen sind meist die, die beruflich mit der Auslegung der heiligen Schrift beschäftigt sind. Für den persönlichen Gebrauch und auch im Gottesdienst stehen Bibelübersetzungen in der jeweiligen Alltagssprache zur Verfügung. Hinter diesem selbstverständlich gewordenen Sachverhalt steht die Überzeugung, dass es nicht allein um die wort- und sprachengetreue Wiedergabe und Aneignung einer Botschaft geht, sondern um das Verstehen dieser Botschaft. Der Islam hat ein anderes Verständnis der Sprache; der Koran wird weltweit in seiner Originalsprache, auf Arabisch, rezitiert. Im Judentum erfolgen die Lesungen in der Synagoge und im Haus wie auch die täglichen Gebete auf Hebräisch.
Was uns hier interessiert, ist ein folgenreiches Grossereignis in der Geistesgeschichte. Etwa um die Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus begann die Arbeit, die Hebräische Bibel in die sich auf dem Vormarsch befindende griechische Sprache zu übersetzen. Weil einer Legende zufolge etwa 70 Gelehrte daran mitwirkten, bürgerte sich für diese Übersetzung der Begriff «Septuaginta» (meist mit der römischen Zahl LXX abgekürzt) ein. Es waren zunächst die griechischsprachigen Juden in Ägypten, die ihre ursprüngliche Muttersprache nicht mehr verstanden und denen auf diese Weise entgegengekommen werden sollte; später waren es geschätzte sechs bis sieben Millionen Juden in der Diaspora, die auf diese Weise ihre «neue» Bibel bekamen.
Wird ein Text übersetzt, werden nicht nur Wörter der einen in Wörter der anderen Sprache transportiert; ebenso wichtig ist es, dass der ganz spezifische Sinn eines Wortes – ein Nebensinn, ein Unterton, eine besondere Tradition – oder |18| Assoziationen, die ausgelöst werden bei denen, die die Sprache kennen, nicht verlorengehen. Aber ein Pendant zum Begriff in der einen Sprache ist in der anderen womöglich gar nicht vorhanden, oder es findet bei der Übersetzung eine Sinnverschiebung statt, die sich durch einen anderen Kulturhintergrund erklären lässt.
Beim Übersetzen der Hebräischen Bibel ins Griechische wurde somit hebräisches Denken in eine griechische Form gegeben, und das hatte weitreichende Konsequenzen, so dass der Ausdruck «Grossereignis» für dieses Unternehmen keineswegs übertrieben ist.
Berühmt ist das Beispiel nefesch, das im Hebräischen ursprünglich «Kehle» meint, den Sitz der Lebenskraft, die «Gurgel», durch die Luft, Wasser, Nahrung, Töne und Sprache gehen – alles elementare Dimensionen des menschlichen Lebens. Das ist typisch für das Hebräische, diese «leibhaftige» Art, vom Menschen zu reden. «Lobe den HERRN, meine Kehle!», wäre demnach der Beginn von Psalm 103. In der LXX wurde nun für nefesch das Wort psychē eingesetzt, das in eine völlig andere Richtung weist: hin zum Geistigen. Der nächste Schritt führte dann auf diesem Weg weiter zum deutschen Wort «Seele».
Die LXX verhalf zwar den griechischsprachigen Juden zum Verstehen der Tora, füllte aber gleichzeitig alte Worte mit neuen Inhalten. Die Übersetzung bewirkte jedenfalls, dass die Glaubensgrundlage des Judentums in der damaligen Welt kommunizierbar und somit bekannter wurde. Das alles hatte natürlich seinen Einfluss wiederum auf das Neue Testament, dessen Schriften in der griechischen Sprache verfasst wurden: Was die LXX vorgespurt hatte, dessen konnte man sich nun bedienen. So tat es auch Paulus, als er agapē zu einem Schlüsselwort des christlichen Glaubens machte.