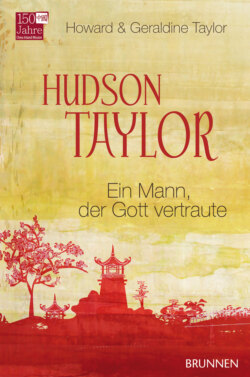Читать книгу Hudson Taylor - Howard Taylor - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Endlich China
ОглавлениеDie nach China bestimmte „Dumfries“ lag am Landungsplatz im Liverpooldock vor Anker. Es war ein kleines Segelschiff von 470 Tonnen, und weil nur ein einziger Passagier mitreiste, hatten sich nur wenige Menschen zur Abfahrt eingefunden. Reparaturen, die bisher die Ausfahrt verhindert hatten, waren in aller Eile zu Ende geführt worden und die Schiffsmannschaft beeilte sich mit dem Verladen der Waren. Inmitten all dieses geschäftigen Treibens verbrachte Hudson Taylor die letzten Augenblicke allein mit seiner Mutter. Sollte dies wirklich die endgültige Trennung sein? Sie konnten es einfach nicht fassen. Seit der Entscheidung des Komitees hatten die Vorbereitungen sie so in Beschlag genommen, dass sie sich kaum der Tragweite dieses Schrittes bewusst geworden waren. Nach einem kurzen Besuch in Barnsley, wo Hudson sich von seinen Schwestern verabschiedet hatte, war er von den gläubigen Freunden in Tottenham und London in Abschiedsversammlungen Gott anbefohlen worden und daraufhin nach Liverpool gereist, wo ihn seine Mutter erwartete. Sein Vater und Mr Pearse als Vertreter der Missionsgesellschaft waren ebenfalls gekommen; doch weil sich die Abfahrt hinauszögerte, hatten sie nicht länger warten können. So waren Mutter und Sohn in den letzten Augenblicken allein. Und nun stand die endgültige Trennung vor ihnen. Der Bericht der Mutter lautet:
„… dann betete der liebe Hudson. Nur einmal bebte seine Stimme, als er seine Lieben zum letzten Mal dem himmlischen Vater anbefahl – ein momentaner Kampf, und er war wieder ruhig. Er vergaß aber nicht, dass er vor einem Leben voller Prüfungen und Gefahren stand. Doch im Gedanken daran betete er: ‚Ich achte deren keines, halte mein Leben auch nicht selbst für teuer, dass ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe vom Herrn Jesus Christus, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes.‘ Es war eine unvergessliche Stunde.
Mein schwerster Augenblick war damit gekommen. Noch ein Abschiedssegen, eine letzte Umarmung. Vom Ufer her streckte sich mir eine gütige Hand entgegen. Ich verließ den Landungssteg, war mir aber kaum bewusst, was ich tat. Jemand geleitete mich zu einem Baumstumpf und ich war froh, mich hinsetzen zu können; denn ich bebte am ganzen Körper.
Als die ‚Dumfries’ sich vom Ufer löste, verlor ich Hudson einen Augenblick aus den Augen. Er war in seine Kabine geeilt und hatte hastig auf die leere Seite einer Taschenbibel geschrieben: ‚Die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übertrifft. H. T.‘
Dann kehrte er zurück und warf mir das Blatt zu.
Noch ein letztes Lebewohl und die tiefen Wasser des Mersey trennten uns endgültig. Während wir noch mit unsern Taschentüchern winkten und der sich entfernenden ‚Dumfries’ nachblickten, stellte sich Hudson in den vordersten Teil, stieg auf das Verdeck und schwenkte seinen Hut. Seine Gestalt wurde kleiner und undeutlicher. In wenigen Minuten entschwanden Passagier und Schiff unsern Blicken.“
Seine eigenen Aufzeichnungen, die viel später geschrieben wurden, zeigen, was die Trennung den Sohn gekostet hatte:
„Meine geliebte Mutter war von Barnsley nach Liverpool gekommen, um von mir Abschied zu nehmen. Nie werde ich jenen Tag vergessen. Sie kam mit mir in meine Kabine, die während der nächsten sechs Monate mein Heim bilden sollte. Leise strich sie mit ihrer Hand über das schmale Bett. Dann setzte sie sich neben mich und zusammen sangen wir unser letztes Lied vor der Trennung. Wir knieten dann nieder und Mutter betete – ihr letztes Gebet vor der Reise. Das Abfahrtszeichen mahnte uns, dass wir uns trennen sollten.
Wir taten es in dem Bewusstsein, wir würden uns wohl auf dieser Erde nie mehr wiedersehen.
Um meinetwillen hielt sie ihren Schmerz, so gut sie konnte, zurück. Sie ging an Land und ich stand auf Deck. Während die ‚Dumfries‘ sich langsam auf die Schleusen zubewegte, folgte sie dem Schiff. Als wir hindurch waren und damit die Trennung endgültig vollzogen war, entfuhr der Mutter ein Angstschrei, der mich wie ein Schwertstich durchfuhr. Niemals bis zu jenem Augenblick hatte ich begriffen, was es bedeutet: ‚Also hat Gott die Welt geliebt.‘ Ich bin gewiss, dass meine Mutter in jener Stunde mehr von Gottes Liebe zu einer verlorenen Welt verstehen lernte als je zuvor.
Wie sehr muss es Gottes Herz betrüben, wenn Er mitansehen muss, wie gleichgültig Seine Kinder einer weiten Welt gegenüberstehen, für die Sein geliebter, eingeborener Sohn litt und starb!“
Es wurde eine lange, langweilige Reise für den einsamen Passagier. Fünfeinhalb Monate lief die „Dumfries“ keinen einzigen Hafen an, und so vernahm Hudson nichts von der übrigen Welt. Doch war es eine gesunde, beglückende Meerfahrt, nachdem die ersten schrecklichen Tage hinter ihm lagen.
Wohl selten sind über ein kleines Segelschiff solche Gefahren hereingebrochen wie über die „Dumfries“, ehe sie die offene See erreichte. Es schien beinahe, als ob der große Feind der Seelen, der Fürst, der in der Luft herrscht und der um die Möglichkeiten wusste, die in dem jungen Leben eingeschlossen lagen, sein Äußerstes unternahm, um es in die Tiefe des Meeres zu versenken. Zwölf Tage kreuzten sie im Kanal. Bald kam Irland und dann wieder die gefährliche Küste von Wales in Sicht. Während der ersten Woche waren sie fast beständig in den Klauen eines Wirbelsturms, bis sie in die Bucht von Carnarvon gerieten, wo sie bis auf zwei Schiffslängen gegen die Felsen getrieben wurden und beinahe daran zerschellten. Jener mitternächtliche Kampf mit der tosenden Brandung und die erfahrene Rettung, nachdem bereits alle Hoffnung geschwunden war, gruben sich so tief in Hudson Taylors Herz ein, dass er darüber berichtete:
„Es waren furchterregende Stunden. Der Wind blies entsetzlich und wir wurden erbarmungslos hin- und hergeworfen, einen Augenblick hoch in die Luft und im nächsten tief hinab in den Abgrund, als müssten wir im Meeresgrund versinken. Die Windseite der ‚Dumfries’ schnellte furchterregend in die Höhe, während die entgegengesetzte tief hinabgedrückt wurde, sodass die Wellenberge unser Schiff überschwemmten.
Als die Sonne unterging, erfüllten mich tiefe Einsamkeit und Trostlosigkeit.“
Eine Zeit lang blieb er „angefochten und sehr besorgt“. Er dachte an den Kummer, der über seine Angehörigen käme, wenn die „Dumfries“ unterginge. Er sorgte sich auch um die Missionsgesellschaft, die so viel Geld für seine Ausstattung und Reise ausgegeben hatte, aber auch um den Zustand der Schiffsmannschaft und dachte auch an „die kalten Wasser und den Todeskampf“. An seiner ewigen Errettung zweifelte er keinen Augenblick. Den Tod als solchen fürchtete er nicht, doch ein Sterben unter solchen Umständen. Der Bericht lautet weiter:
„Ich stieg in meine Kabine hinunter, las einige Lieder und Psalme sowie Joh. 13-15 und wurde dadurch so gestärkt, dass ich fest einschlief und erst nach einer Stunde wieder erwachte. Das Barometer war gestiegen. Ich fragte den Kapitän, ob wir wohl Holyhead umfahren könnten.
‚Wenn wir nicht landwärts getrieben werden, kann es gelingen. Gott helfe uns!‘
Doch wir trieben landwärts. Unsere Lage war schrecklich. Es war eine klare Nacht, der Mond unverdeckt von Wolken, sodass wir die Küste sehen konnten. Ich begab mich wieder nach unten. Wohl stieg das Barometer, doch blies der Wind noch sehr heftig. Ich schrieb meinen Namen und die Adresse meiner Eltern in Barnsley in mein Taschenbuch für den Fall, dass mein Leichnam gefunden würde. Dann packte ich einige leichte Sachen in meinen Weidenkorb, denn ich überlegte mir, er würde mir oder einem andern helfen, das Ufer zu erreichen. Ich befahl meine Seele noch einmal meinem himmlischen Vater an und auch alle meine Angehörigen und Freunde und betete: ‚Vater, es ist Dir alles möglich; nimm diesen Kelch von mir!‘ Daraufhin ging ich an Deck.
Ich fragte den Kapitän, ob die Schiffe einem solchen Sturm gewachsen seien, was er verneinte. ‚Könnten wir nicht lose Bretter zusammenbinden und eine Art Floß bauen?‘
Er meinte, dazu würden wir keine Zeit haben, und sagte: ‚Wir müssen versuchen, das Schiff zu drehen, und dazu alle Segel raffen, oder es ist alles vorbei. Die See wird wohl alles vom Deck wegfegen, doch wir müssen den Versuch noch wagen.‘
Dies war ein Augenblick, der das stärkste Herz erbeben ließ. Der Kapitän gab Befehl, nach außen zu wenden, doch vergebens strengten wir uns an. Dann versuchte er es nach der andern Richtung und dies gelang mit Gottes Hilfe. Wir fuhren jedoch nur zwei Schiffslängen an den Felsen vorbei. Während dieser Zeit schlug der Wind um zwei Punkte zu unsern Gunsten um und wir kamen aus der Bucht heraus.
Alle unsere Anstrengungen wären umsonst gewesen, wenn der Herr uns nicht geholfen hätte. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Dass doch die Menschen den Herrn für Seine Güte preisen und Seine Wundertaten rühmen möchten!“
Als Gerettete sahen sie am Montagmorgen mit unaussprechlicher Freude die Sonne über dem Horizont aufsteigen. Allmählich legte sich der Sturm.
Nach vielen Jahren beleuchtete Hudson Taylor dieses Erlebnis von einer andern Seite:
„Etwas verursachte mir in jener Nacht viel Kampf. Ich war noch ein junger Christ und besaß nicht genügend Glauben, um Gott in dieser Lage zu erkennen. Ich hatte es als meine Pflicht erachtet, auf ausdrücklichen Wunsch meiner Mutter und um ihretwillen einen Schwimmgürtel mitzunehmen. Doch ich selbst fühlte, dass ich Gott nicht völlig vertraute, so lange ich den Gürtel bei mir trug, und fand innerlich keine Ruhe, bis ich ihn, nachdem alle Hoffnung auf Rettung geschwunden war, verschenkt hatte. Daraufhin war ich ganz ruhig, band aber doch einige Sachen zusammen, die bei unserer Strandung wahrscheinlich obenauf schwimmen würden, und erkannte nicht, dass darin ein Widerspruch lag.
Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, fand ich durch das Schriftstudium die Antwort auf diese Frage. Gott zeigte mir meinen Fehler, wohl um mich für alle Zeiten von ähnlichen Überlegungen zu befreien. Es wird in diesen Tagen, in denen falsche Lehre über Glaubensheilung so viel Unheil anrichtet, sehr häufig der Fehler gemacht, dass einige Absichten Gottes missverstanden werden. Dadurch wird der Glaube vieler Menschen erschüttert, und sie werden in Verwirrung gebracht. In medizinischen oder chirurgischen Fällen habe ich es nie versäumt, um Gottes Führung und Segen bei der Anwendung geeigneter Mittel zu beten, habe auch nie das Danken für erhörte Gebete und Wiederherstellung der Gesundheit unterlassen. Heute scheint es mir verwegen und falsch zu sein, den Gebrauch von Mitteln, die Er uns gibt, geringzuachten und abzulehnen. Es wäre das Gleiche, wie wenn jemand das tägliche Brot verweigerte und glaubte, Leben und Gesundheit könnten allein durch das Gebet erhalten bleiben.“
In der Bucht von Biskaya entdeckte Hudson Taylor, dass sich noch ein Christ, ein schwedischer Schreiner, auf dem Schiff befand. Nachdem er mit ihm verabredet hatte, dass sie von nun an regelmäßige Versammlungen für die Mannschaft durchführen wollten, bat er den Kapitän um die Erlaubnis dazu.
Es wurden dann während der Reise sechzig Versammlungen gehalten. Hudson Taylor bereitete sich jedes Mal gründlich darauf vor und betete auch viel dafür. Dies bedeutete für ihn selbst eine große Hilfe und bewahrte ihn vor der Niedergeschlagenheit, die eine lange Meerreise leicht zur Folge hat. Es bekümmerte ihn sehr, dass im Leben dieser Seeleute nur wenig durchgreifende Wirkungen erlebt wurden. Sie zeigten wohl Interesse und suchten ihn zuweilen zu einer Aussprache auf, doch, obgleich einige nicht weit vom Königreich Gottes entfernt waren, entschied sich keiner klar für Jesus Christus. Dies bedeutete für ihn eine schmerzliche Enttäuschung. Aber diese Erfahrung war notwendig, denn sie lehrte ihn, „neben allen Wassern zu säen“, auch wenn lange keine Frucht reift.
Zuweilen schien die Heimat in seiner Einsamkeit unendlich fern zu sein. Dann wurde die Sehnsucht nach seinen Angehörigen beinahe unerträglich.
„Wie weit sind wir doch voneinander entfernt, die wir uns im vergangenen Jahr so nahe waren! Wie gut ist es, dass Gott sich nicht verändert und Seine Gnade kein Ende hat! In einem Buch, das der Kapitän mir lieh, fand ich das Lied ‚Die hebräische Mutter‘. Nie kann ich vergessen, wie meine geliebte … es zum letzten Mal spielte. Du warst auch dabei, Mutter, als wir die Worte zusammen sangen:
Ich gebe dich meinem Gott,
dem Gott, der dich mir gab …
Damals hast Du mich im Gedanken an die Trennung weinend an Dich gedrückt. Möge Gott dich trösten!
Jesus ist wunderbar. Der Dienst für Ihn bedeutet vollkommene Freiheit. Sein Joch ist leicht und Seine Last nicht schwer. Seine Freunde erleben den wahren Frieden und wirkliche Freude. Jesus ist jetzt bei mir, da ich von meinem Heim, meinen Freunden und von der Heimat getrennt bin. Er ist alles in allem und mehr als das. So sehr ich mich nach Euch sehne, ist doch Gottes Liebe stärker, zwingender.“
Seine Liebe zu Menschen wankte nicht in der Prüfung von Schmerz und Verlust. Sie vertiefte sich, als er Auge in Auge mit den Tatsachen stand, die er nur vom Hörensagen kannte. Die Bewohner mancher Insel der Philippinen erweckten sein warmes Mitleid.
Die Reisenden hatten schon bei der Umschiffung des Kaps der Guten Hoffnung Land gesichtet, dann aber sahen sie erst wieder Küsten, als sie sich der Inselregion zwischen dem Indischen und Stillen Ozean näherten. Es war eine wundervolle, nicht ganz gefahrlose Durchfahrt. Nachdem sie zuerst freudig die grünen Hügel und Täler der Pelewgruppe gesichtet hatten, fuhren sie fast einen Monat lang an schönen, fruchtbaren, bewohnten Inseln vorbei, auf denen noch kein Botschafter Jesu Christi je das Evangelium gepredigt hatte.
„Welch ein Arbeitsfeld für einen Missionar! Insel um Insel, viele fast unbekannt, manche bevölkert, doch kein Licht, kein Wissen um Jesus, keine Hoffnung! Mein Herz sehnt sich nach ihnen. Ist es möglich, dass christliche Männer und Frauen bequem daheim bleiben können und diese Seelen verderben lassen?“
Wenn auch die Reise viel Interessantes bot, wurde sie doch langweilig, vor allem in Zeiten der Windstille in der östlichen Inselwelt. Nur einen einzigen Monat hindurch hatten sie günstigen Wind. Mehr als einmal aber wies das Schiffstagebuch nicht mehr als sieben Meilen in vierundzwanzig Stunden auf. Solche Erfahrungen waren eine Prüfung, die auch ernste Gefahren in sich barg.
„Nirgends ist man hilfloser als auf einem Segelschiff ohne Wind“, schrieb Hudson Taylor darüber, „wenn eine Strömung es erfasst und unaufhaltsam einer Küste entgegentreibt. In einem Sturm kann man es bis zu einem gewissen Grad beherrschen, doch bei Windstille muss der Herr alles tun.“
In solcher Lage bedeutete ihm folgende Gebetserhörung eine große Ermutigung. Sie hatten eben die Dampierstraße verlassen, doch immer noch waren die Inseln in Sicht. Gewöhnlich wehte nach Sonnenuntergang eine Brise, die bis zur Morgendämmerung anhielt und dann auch bis zum Äußersten ausgenutzt wurde. Tagsüber lagen sie mit hängenden Segeln still und trieben nicht selten zurück. Dabei verloren sie einen guten Teil der in der Nacht gewonnenen Strecke.
„Das geschah, als wir uns in gefährlicher Nähe von Neuguinea befanden. Am Samstagabend lagen wir noch etwa dreißig Meilen vom Land entfernt. Während des Sonntagnachmittaggottesdienstes, zu dem wir uns auf Deck zusammenfanden, fiel mir auf, wie besorgt der Kapitän aussah und dass er oft an die Reling ging. Später erkundigte ich mich nach seinen Beobachtungen und erfuhr, dass wir durch eine ziemlich starke Strömung auf uns verborgene Riffe zugetrieben würden. Wir befänden uns bereits ganz in ihrer Nähe. Nach dem Essen wurde das große Boot herabgelassen, und die ganze Mannschaft versuchte mit allen Kräften, den Bug des Schiffes von der Küste abzudrehen. Doch sie mühten sich umsonst.
Nachdem wir einige Zeit schweigend auf Deck gestanden hatten, sagte der Kapitän zu mir: ‚Nun haben wir alles in unserer Macht Stehende versucht. Jetzt können wir nur noch den Dingen ihren Lauf lassen.‘
Da kam mir ein Gedanke. Ich antwortete: ‚Nein, etwas haben wir noch nicht getan.‘
‚Was meinen Sie damit?‘
‚An Bord befinden sich vier Christen. Lassen Sie die in ihre Kabinen gehen und vom Herrn eine Brise erbitten! Er kann sie uns ebenso gut jetzt und nicht erst nach Sonnenuntergang senden.‘
Der Kapitän willigte ein. Ich sprach noch mit den beiden andern Männern, und nachdem ich mit dem Schreiner zusammen gebetet hatte, suchten wir jeder unsere Kabinen auf und breiteten unser Anliegen vor Gott aus. Ich verbrachte nur ganz kurze Zeit im Gebet, denn ich fühlte, dass Gott antworten würde. Deshalb konnte ich nicht weiter bitten, sondern begab mich an Deck. Der erste Offizier, ein gottloser Mann, hatte Dienst. Ich ging zu ihm und bat ihn, das Hauptsegel zu lösen.
‚Was soll das nützen?‘, fragte er grob.
‚Wir haben von Gott einen günstigen Wind erbeten‘, antwortete ich, ‚er wird sogleich kommen, und weil wir uns schon so nahe dem Riff befinden, darf keine Minute verlorengehen.‘
Mit einem Fluch und verächtlichen Blicken meinte er, man könne lange von Wind reden, er aber möchte Wind sehen. Doch während er noch redete, blickte er zum Segel hinauf. Und wirklich, der äußere Zipfel des obersten Segels begann sich im Winde zu kräuseln.
‚Sehen Sie nicht, wie der Wind kommt?‘, rief ich.
‚Nein, das ist nur ein leiser Windhauch.‘
‚Windhauch oder nicht‘, schrie ich, ‚bitte, lassen Sie das Hauptsegel herunter, damit wir den Wind ausnutzen!‘
Das tat er dann auch eilig, und die schweren Schritte der Matrosen brachten sogar den Kapitän aus seiner Kabine heraus. Die erbetene Brise war wirklich da. In wenigen Minuten durchfurchten wir die See mit einer Geschwindigkeit von sechs bis sieben Knoten in der Stunde. Obgleich die Windstärke wechselte, wurde es nie ganz windstill, bis die Pelewinseln hinter uns lagen.
So ermutigte mich Gott, noch ehe ich Chinas Boden betrat, jede Not vor Ihn zu bringen und von Ihm zu erwarten, dass Er um Jesu willen in jeder Not die erbetene Hilfe senden werde.“
Ende Februar lag die „Dumfries“ an einem nebligen Sonntag vor Anker und wartete auf den Lotsen, der sie sicher nach Schanghai hineingeleiten sollte. Durch stürmische Wetter in der chinesischen See war sie vom Kurs abgetrieben worden. Doch nun zeigte das trübe, gelbe Wasser ringsum, dass sie sich bereits in der Mündung eines großen Flusses befanden. In seine wärmsten Kleider gehüllt, schritt Hudson Taylor auf Deck auf und ab. Er tat sein Bestes, sich warm zu halten und geduldig zu warten. Es war ein seltsamer Sonntag, dieser letzte auf der „Dumfries“. Schon seit Tagen standen seine Koffer fertig gepackt zum Verlassen des Schiffes bereit. Weil Kälte und Sturm jede Arbeit unmöglich machten, blieb ihm Zeit zum Beten und Nachdenken.
Er schrieb: „Welch eigenartige Gefühle nehmen von einem Besitz beim Landen an einer unbekannten Küste, die nun bald Arbeitsfeld und Heimat sein soll! Sein Wort sagt: ‚Siehe, ich bin bei euch alle Tage!‘ ‚Ich will dich nicht verlassen noch versäumen.‘ Ich habe also nichts zu fürchten, denn Jesus ist mir zur Seite. Herrliche Verheißungen!
Vielleicht sind große Dinge geschehen, seitdem ich zuletzt von China hörte. Und wie werden die Nachrichten aus England lauten? Wohin soll ich mich hier wenden? Wo soll ich zuerst wohnen? Diese und viele andere Fragen beschäftigten mich, am meisten aber die Frage: Lebe ich Gott so nahe, wie es möglich ist?“
Im Laufe des Nachmittags sahen sie Boote näher kommen. Doch der Nebel ließ keine klare Sicht zu. Eins kam ganz nahe heran und wurde dann auch von der „Dumfries“ aus sehr aufmerksam beobachtet. Ja, weder das malerische Segel und der eigentümlich bemalte Schiffsrumpf noch die Gesichter ließen einen Zweifel zu. Dort waren sie: zwölf oder vierzehn blau gekleidete, dunkelhäutige, in einer unbekannten Sprache schreiende Menschen – die ersten Chinesen, die Hudson Taylor zu sehen bekam. Wie flog sein Herz ihnen entgegen! Hinter dem fremdartigen Äußeren sah er den Schatz, den zu suchen er so weit hergereist kam – die Seelen, für die Jesus Sein Leben gab.
„Ich sehnte mich, ihnen die Frohe Botschaft zu sagen“, schrieb er.
Etwas später kam der englische Lotse an Bord und wurde herzlich willkommen geheißen. Es bestand allerdings keine Hoffnung, noch an diesem Tag Woosung, noch weniger das fünfzehn Meilen entfernte Schanghai zu erreichen. Doch konnte der Lotse, während sie darauf warteten, dass der Nebel sich auflöste, manches erzählen, was sich seit ihrer Abfahrt von England während der Wintermonate zugetragen hatte.
Sie hörten zum Beispiel von den Feindseligkeiten zwischen Russland und der Türkei, die in wenigen Wochen zum Krieg führen sollten. Die verbündeten Flotten von England und Frankreich hatten bereits den Kriegsschauplatz erreicht; nun befürchtete man, dass ein Kriegsausbruch durch nichts verhindert werden könnte. Wenn es auch schrecklich war, von Kriegswolken über Europa zu hören, so erschreckte es sie noch viel mehr, was sie von China und vor allem über den Hafen, wo sie vor Anker lagen und landen wollten, zu hören bekamen. Nicht nur wurde Provinz um Provinz von den Taipingrebellen bei ihrem Vormarsch nach Peking durchtobt, sondern auch Schanghai, die Chinesenstadt, ebenso wie die Fremdenkolonie durchlebten die Schrecken des Krieges. Eine Bande von Rebellen, als „Rote Turbane“ bekannt, hatte die Stadt besetzt, die wiederum von einer kaiserlichen Armee belagert wurde. Dies bedeutete für die europäische Siedlung eine noch größere Gefahr als die Rebellen.
Obgleich ihre Überfahrt schlimm gewesen war, hatten sie doch ihr Ziel vor einer Reihe anderer Schiffe erreicht, die die Februarpost bringen sollten. Wahrscheinlich mussten sie sich auf erhöhte Preise gefasst machen, da der Dollar beinahe auf das Doppelte gestiegen war und bald noch weiter steigen würde. Wahrlich eine entmutigende Nachricht für einen, der nur mit einem geringen Einkommen in englischer Währung rechnen konnte!
Das alles und noch mehr dazu erzählte ihnen der Lotse. Sie fanden genügend Zeit zu Überlegungen. Auch am Montag lag noch so dichter Nebel, dass sie sich nicht von der Stelle wagen konnten. Als sie am Dienstag früh den Anker lichteten, hatten sie gegen den Wind zu kämpfen und erreichten Woosung nur mit Mühe. In der folgenden Nacht aber hob sich der Nebel, und der junge Missionar erblickte vom Deck aus ein flaches Ufer, das sich von Norden nach Süden hinzog. Das war nun keine Insel mehr. Wie zog es ihn an Land! Seine Gebete waren erhört, der jahrelange Traum Wirklichkeit geworden. Endlich erblickte er unter dem Abendhimmel das Land seiner Bestimmung – China.
Doch erst um fünf Uhr am nächsten Tag, es war der 1. März, landete er in Schanghai, und zwar ganz allein. Die „Dumfries“ wurde noch immer durch widrige Winde aufgehalten.
„Meine Gefühle kann ich nicht beschreiben, die mich beim Betreten des Ufers bewegten“, berichtete er nach Hause. „Ich meinte, das Herz müsse bersten, während Tränen der Dankbarkeit aus meinen Augen strömten.“
Dennoch muss ein Gefühl tiefer Verlassenheit ihn erfüllt haben. Nirgends ein Freund oder Bekannter! Keine einzige Hand streckte sich ihm zum Willkomm entgegen. Niemand kannte auch nur seinen Namen.
„Trotz Dankbarkeit und Freude überfiel mich das Bewusstsein der ungeheuren Entfernung zwischen mir und meinen Angehörigen. Ich war ein Fremdling im fremden Land.
Drei Empfehlungsschreiben trug ich bei mir und baute besonders auf eins davon, durch das ich Rat und Hilfe zu finden hoffte. Ich wurde darin dem Empfänger durch Freunde, die auch ihm bekannt waren, empfohlen. Natürlich erkundigte ich mich sogleich nach ihm, vernahm jedoch, dass er vor ungefähr einem Monat begraben worden war.
Betrübt über diese Nachricht, erkundigte ich mich nach dem Missionar, dem mein zweiter Empfehlungsbrief galt. Doch ich erlebte eine weitere Enttäuschung. Es hieß, er sei vor Kurzem nach Amerika abgereist. Es blieb nun noch der dritte Brief, der mir allerdings von einem verhältnismäßig Unbekannten mitgegeben worden war. Von diesem erwartete ich weniger als von den andern. Doch ausgerechnet er sollte mir durch Gottes Güte zur Hilfe werden.“
Mit diesem Schreiben verließ Hudson Taylor das britische Konsulat und begab sich auf den Weg zum Gebäude der Londoner Missionsgesellschaft, das innerhalb der Fremdenkolonie lag. Von allen Seiten grüßten ihn seltsame Bilder, Töne und Gerüche, vor allem, als die großen Häuser der Reichen hinter ihm lagen und er an kleineren Geschäften und Wohnungen vorbeikam. Hier wurde nur noch Chinesisch gesprochen. Er begegnete auch nur noch Chinesen. Die Straßen wurden enger und waren dichter bevölkert. Überhängende Balkone, von denen lange Schilder herunterhingen, verdunkelten beinahe die Aussicht nach dem Himmel. Wie er seinen Weg zum Missionshaus fand, bleibt ein Rätsel. Endlich kam die Missionskapelle in Sicht. Mit einem Seufzer der Erleichterung und tiefer Dankbarkeit trat Hudson Taylor durch das offen stehende Tor. Dieses trug drei chinesische Schriftzeichen, die, wie er später vernahm, „Medhurst-Familienanwesen“ bedeuteten. Dr. Medhurst war der Verfasser des Buches „China“, das er als Junge in Barnsley in der Bibliothek seines Predigers gefunden hatte und das den Wert der ärztlichen Missionsarbeit betonte. Durch dieses Buch war er dazu geführt worden, eine medizinische Ausbildung zu suchen.
Es lagen vor ihm verschiedene Gebäude. Im Ersten fragte er nach Dr. Medhurst, an den sein Schreiben gerichtet war. Schüchtern und zurückhaltend von Natur, bedeutete es für Hudson Taylor keine Kleinigkeit, sich einem so berühmten Mann vorzustellen, dem Pionier und Begründer der protestantischen Mission in diesem Teil Chinas. Er war beinahe erleichtert, als er vernahm, Dr. Medhurst wohne nicht mehr hier. Es schien, als sei auch dieser für ihn unerreichbar.
Mehr konnte Hudson Taylor nicht erfahren, weil die chinesischen Diener die englische Sprache nicht beherrschten und er selbst kein Wort ihres Dialekts verstand. Es war eine sehr ungemütliche Lage. Doch endlich trat ein Europäer hinzu. Er heiße Edkins und sei Missionar, erklärte er, während er den Ankömmling willkommen hieß. Durch ihn vernahm Hudson Taylor, dass Medhursts nun im britischen Konsulat wohnten, doch lebe Dr. Lockhart hier. Dann entfernte er sich, um diesen zu holen.
Damals war es ein besonderes Ereignis, wenn ein Engländer und vor allem ein Missionar unangemeldet in Schanghai eintraf. Meistens kamen sie mit den Postdampfern, deren Ankunft jedes Mal eine allgemeine Aufregung hervorrief. Doch jetzt wurde niemand erwartet, weil auch die „Dumfries“ den Hafen noch nicht erreicht hatte. So war das Erstaunen bei den übrigen Missionaren der Londoner Missionsgesellschaft (LMS) groß, als sie den Fremden sahen. Hudson Taylor musste immer von Neuem erklären, wer und was er sei. Alexander Wylie jedoch machte es dem schüchternen jungen Mann bald gemütlich und unterhielt ihn, bis Edkins mit Dr. Lockhart zurückkehrte.
Die Missionare verstanden bald die Lage des Neuangekommenen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als den jungen Mann in eins ihrer eigenen Häuser aufzunehmen. Sie konnten ihn nicht ohne Obdach lassen, obwohl damals die Fremdenkolonie so übervölkert war, dass weder ein Haus noch eine Wohnung frei stand. Dr. Lockhart wohnte allein, weil seine Frau nach England hatte zurückkehren müssen. Mit aufrichtiger Freundlichkeit lud er Hudson Taylor ein, als Gast bei ihm Wohnung zu nehmen gegen einen kleinen Beitrag zur Deckung der Mehrauslagen.
Nachdem dies geordnet war, begleitete ihn Edkins zu Mr und Mrs Muirhead, die ebenfalls zur LMS gehörten. Er machte ihn auch bekannt mit Mr und Mrs Burdon von der Church Missionary Society, die auf demselben Grundstück ein Haus bewohnten. Diese luden den Fremdling zum Abendessen ein. Das Ehepaar lebte erst seit einem Jahr in China und war jungvermählt. Beide fühlten sich sofort zu Hudson hingezogen und dieser erwiderte ihre Freundschaft von Herzen.
„Das Kaminfeuer erinnerte mich an zu Hause“, schrieb er, „und das Zusammensein mit den neuen Freunden war so gemütlich und alles, was sie mir erzählten, sehr interessant und erfrischend.“
So hatte Gott die vielen Gebete erhört und Antwort auf manche Fragen geschenkt.
Am nächsten Morgen wurde Hudson Taylor durch Vogelgesang geweckt – eine willkommene Abwechslung nach dem eintönigen Geplätscher des Wassers an den Planken der „Dumfries“. Mit großer Freude betrachtete er die knospenden Pflanzen im Garten und atmete begierig ihren Duft ein.
Nach dem Frühstück ging er zum Konsulat. Er war zuerst sehr enttäuscht, nur einen einzigen Brief vorzufinden, für den er auch noch zwei Shilling bezahlen musste. Dann sah er aber, dass er von Mutter und Schwester kam.
„Nie in meinem Leben habe ich williger zwei Shilling bezahlt als für diesen Brief“, versicherte er ihnen später.
Endlich wurde auch die Ankunft der „Dumfries“ gemeldet. Mithilfe einiger chinesischer Träger ließ er seine Sachen zu Dr. Lockharts Haus tragen. Es war ein eigenartiges Gefühl, an der Spitze einer Schar Kulis durch die vollen Straßen der Stadt zu marschieren, alle seine Habseligkeiten von Bambusstangen, die über ihre Schultern gelegt waren, baumeln zu sehen, und das „Pu ah“ der Träger, das eher nach Stöhnen als Singen klang, mit anzuhören. Doch es waren keine Schmerzenslaute, obgleich sie sich so anhörten. Als er später einige Kupfermünzen, die er für einen mexikanischen Dollar eingewechselt hatte, unter sie verteilte, war seine erste geschäftliche Erfahrung in China gemacht.
Er nahm dann an der Krankenhausandacht teil, die Dr. Medhurst an diesem Tage hielt. So hörte Hudson Taylor das Evangelium zum ersten Mal in der Sprache, mit der er bald vertraut werden sollte. Dr. Medhurst riet ihm, mit dem Studium des Mandarin zu beginnen, und suchte auch einen Sprachlehrer für ihn. Abends fanden sich die Missionare zur üblichen Gebetsgemeinschaft zusammen, bei der er allen übrigen Missionaren vorgestellt wurde. So endete sein erster Tag in China voll Ermutigung und Freude mit gemeinsamem Lobpreis.
Doch noch vor dem Ende der Woche sollte er eine andere Seite des Lebens in Schanghai kennenlernen. Sein Tagebuch berichtet von nächtlichem Gewehrfeuer, von Wachen auf der nahe gelegenen Stadtmauer und von Gefechten, die er von seinem Zimmerfenster aus beobachten konnte, wobei viele Männer getötet oder verwundet wurden. Es berichtet weiter von der Suche nach einer eigenen Behausung im Chinesenviertel der Kolonie, die allerdings erfolglos verlief. Es erwähnt auch etwas über seinen ersten Kontakt mit dem Heidentum – den Leidensszenen in der Chinesenstadt, die sich ihm als unauslöschliche Schreckensbilder einprägten.
Von einigen dieser Erlebnisse schrieb er zehn Tage nach seiner Ankunft an seine Schwester:
„Am Samstag, dem 4. März, wanderte ich über den Markt. Nie habe ich solch eine schmutzige Stadt gesehen. Der Boden ist lehmig. Bei trockenem Wetter mag das ja ganz angenehm sein, doch eine Stunde Regen verwandelt die Straße in einen derartigen Brei, dass man unmöglich gehen, sondern nur noch darin waten kann. Eine Wohnung fand ich nirgends und war ganz niedergeschlagen.
Am Sonntag besuchte ich morgens eine Versammlung der LMS und ging nachmittags mit Mr Wylie zu einer zweiten in die Stadt. Sei froh, wenn Du noch nie eine Stadt im Belagerungszustand gesehen hast und auch noch nie auf einem Kriegsschauplatz gewesen bist! Gott behüte Dich davor! Wir gingen ein Stück an der Stadtmauer entlang und sahen ganze Reihen zerstörter Häuser. Es war ein trauriger Anblick, ein einziger Schutt- und Trümmerhaufen. Dazu das Elend derer, die in dieser kalten Jahreszeit kein Obdach haben. Man darf kaum daran denken.
Endlich kamen wir an eine Leiter, die von der Mauer herabgelassen war. Über sie wurden Vorräte in die Stadt befördert. Die Soldaten erlaubten uns, die Leiter zu benutzen. Wir durchwanderten viele Straßen der Chinesenstadt. Mr Wylie sprach ab und zu mit Leuten und schenkte ihnen Traktate. In den Tempeln verteilten wir sie auch an die Priester. Überall schienen wir willkommen zu sein.
Als wir zum Nordtor kamen, sahen wir Hunderte von Soldaten der Rebellenarmee versammelt und stießen im Weitergehen noch auf viele andere. Sie bereiteten einen Ausfall aus der Stadt vor. Anscheinend erwarten die kaiserlichen Belagerungstruppen von dieser Seite her keine Gefahr.
Endlich kamen wir zur Kapelle der LMS und fanden bereits viele Menschen versammelt. Dr. Medhurst predigte und anschließend wurden sechs Säcke Reis unter die Armen verteilt, die ohne diese Hilfe verhungern müssten, denn sie können in diesen Tagen nichts verdienen. Zertrümmerte Fensterscheiben und zerbrochene Lampen sind Zeugen des Zerstörungswerks.
Als wir das Nordtor wieder erreichten, wurde dort außerhalb der Stadtmauer heftig gekämpft. Ein toter Mann wurde eben hereingetragen. Ein anderer war durch einen Schuss in die Brust getroffen, und ein dritter, den ich untersuchte, litt entsetzliche Schmerzen, denn eine Kugel hatte ihm verschiedene Knochen zersplittert.
Ein wenig weiter entfernt trafen wir einige Männer, die eine kleine, soeben erbeutete Kanone mit sich führten, und nach ihnen kamen andere, die fünf Gefangene an ihren Zöpfen nachschleppten. Die armen Burschen riefen uns kläglich um Hilfe an, als sie an uns vorbeigezerrt wurden. Doch wir konnten nichts für sie tun. Wahrscheinlich standen sie unmittelbar vor ihrer Enthauptung. Der Gedanke daran ist einfach entsetzlich.“
All dies musste Hudson Taylor sehr schmerzlich mitempfunden haben, war er doch gar nicht darauf vorbereitet. Prüfungen und Leiden, die mit dem Missionarsleben verbunden sind, hatte er erwartet. Hier aber war alles so ganz anders, als er es sich vorgestellt hatte. Außer der Kälte, die er als sehr unangenehm empfand, gab es für ihn persönlich keine besonderen Leiden. Doch was er an Elend mitansehen musste, wenn er einen Blick durch sein Fenster tat, ging ihm sehr zu Herzen. Die Qualen, die den Gefangenen von den Soldaten beider Armeen auferlegt wurden, weil sie von ihnen Geld erpressen wollten, und die Plünderungen nach Lebensmitteln bedrückten ihn sehr.
Weil er fast seine ganze Zeit auf das Sprachstudium verwandte, vernachlässigte er das Gebet und das tägliche Schriftstudium, sodass sein geistliches Leben verkümmerte. Die Kanäle des Segens für andere waren verstopft und es dauerte eine Weile, bis er erkannte, wie notwendig es ist, dass diese geöffnet bleiben. Der alte Feind zog daraus seinen Vorteil, wie aus seinen ersten Briefen ersichtlich ist. Er schrieb an Mr Pearse:
„Ich war nicht wenig enttäuscht, keinen Brief von Ihnen vorzufinden. Ich hoffe aber sehr, er kommt mit der nächsten Post. Schanghai befindet sich in einem schlimmen Zustand. Die Rebellen und Kaiserlichen kämpfen ununterbrochen. Heute wurden wir schon vor Tagesanbruch durch Kanonendonner geweckt. Das Haus erzitterte darunter und die Fenster klirrten bedenklich.
Es lässt sich hier kein einziges Haus und auch keine Wohnung finden. Was nicht von Europäern bewohnt ist, haben Kaufleute übernommen, die die Stadt wegen der Unruhen verließen. Man sagte mir, sie bezahlten für drei Räume dreißig Dollar im Monat und mehr. Die in der Stadt wohnenden Missionare mussten diese ebenfalls verlassen und sind in die Kolonie umgezogen. Hätte sich Dr. Lockhart meiner nicht so freundlich angenommen, wüsste ich nicht, was aus mir geworden wäre. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich unternehmen soll. Es ist schwer, vorauszusagen, wie lange die gegenwärtige Lage andauert. Dr. Lockhart meint, wenn ich längere Zeit in der Kolonie bleiben müsste, sollte ich ein Stück Land erwerben und ein Haus bauen.
Entschuldigen Sie bitte diesen in Hast geschriebenen Brief mit allen Fehlern! Es ist so kalt, dass ich kaum Feder und Papier fühle.
Hier ist jetzt alles sehr teuer, vor allem die Feuerung. Noch einmal bitte ich Sie, den Brief entschuldigen zu wollen, und bitte – antworten Sie so bald wie möglich, damit ich weiß, was ich tun soll!
Möge der Herr Sie segnen und Ihnen beistehen! Beten Sie bitte weiter für mich! Wir sollten uns alle, die wir die Liebe Jesu kennen, auch wenn alles um uns herum zerfällt, freudig Ihm ähnlicher gestalten lassen. Bald werden wir uns dort sehen, wo kein Leid und kein Kummer mehr sein werden. Wären wir doch bis dahin willig, unser Kreuz zu tragen und Seinen Willen nicht nur zu tun, sondern ihn auch wirklich gern anzunehmen.“
Eine Woche später schrieb er an seine Eltern:
„Die Kälte war so groß und anderes so bedrückend, dass ich zuerst gar nicht wusste, was ich tat oder sagte. Man muss es selbst erlebt haben, was solch eine Entfernung von zu Hause bedeutet. Ebenso wenig kann man sich vorstellen, wie es ist, wenn man die Leute nicht versteht noch von ihnen verstanden wird. Ihre ganze Erbärmlichkeit und ihr Elend sowie meine Unfähigkeit, ihnen zu helfen oder sie auf Jesus hinzuweisen, haben mir außerordentlich zugesetzt.“
In einem andern Brief berichtet er:
„Ich gäbe viel darum, wenn ich mit einem befreundeten Menschen über alles reden könnte. Meine Lage ist so verworren, dass ich, wenn ich nicht Gottes Verheißungen hätte, auf die ich mich verlassen kann, nicht aus noch ein wüsste. Ich fürchte, mit meinem Gehalt unter den gegenwärtigen Umständen nicht auszukommen. Könnte ich allein wohnen, würde mir Reis (Brot ist zu teuer) genügen, und dazu könnte ich den Tee ohne Milch und Zucker trinken. Doch hier geht das nicht. Nicht nur die Preise steigen, sondern auch der Dollar. Nun, Er wird sorgen.“
Es mag übertrieben scheinen, so lange bei Hudsons äußeren Umständen stehenzubleiben. Er lebte zwar im Kriegsgebiet, doch umgaben ihn Sicherheit und Behaglichkeit. Dennoch schwingt ein Unterton des Leidens in seinen Briefen mit. Das ergibt sich aus einer andern Seite seines Erlebens. Die willkommene Hilfe, die er durch Dr. Lockhart und andere Missionare der LMS erfuhr, schuf für ihn eine peinliche Lage. Hätte er dieser Mission angehört und sich für eine Zusammenarbeit mit ihren Gliedern vorbereitet, hätte er sich nichts Besseres wünschen können. Doch in seiner Lage kam er sich wie ein Vogel in einem fremden Nest vor. Es konnte ihm nicht entgehen, dass seine Anwesenheit bei jeder Mahlzeit von seinem großmütigen Gastgeber als Belastung empfunden wurde. Dr. Lockhart und seine Mitarbeiter erwiesen ihm nichts als Freundlichkeiten, aber er wurde sich immer klarer bewusst, dass sie besser ausgebildet waren und er einer unbedeutenderen Mission angehörte als sie. Außerdem unterschieden sich seine religiösen Auffassungen und seine Haltung als Missionar von denen der andern. Deshalb war er ihrer Kritik ausgesetzt.
Seine Missionsgesellschaft hatte ihn nach China entsandt, ehe er sein Medizinstudium beendet hatte. Dadurch bestand damals die Hoffnung, er könnte in Nanking mit den Rebellen zusammentreffen. Die allzu optimistischen Berichte aus China über das Taipingunternehmen hatten die Sekretäre irregeführt. Sie hatten eine Stellung eingenommen, die von den Praktikern auf dem Missionsfeld als absurd gewertet werden musste. Hudson Taylor erkannte denn auch bald, dass seine Missionsgesellschaft mit ihren Zielen und Methoden Zielscheibe des Spotts unter den Missionaren in Schanghai war. Es war überaus demütigend, wenn „The Gleaner“ (Die Ährenlese) Monat um Monat kritisiert und belächelt wurde, musste er doch selbst zugeben, wie sehr die Zeitschrift in vielem tatsächlich Spott verdiente.
Hudson erkannte die Schwächen der Chinesischen Missionsgesellschaft ebenso deutlich wie die anderen Missionare, doch er respektierte viele ihrer Glieder in der Heimat, und mit einigen – ihre Sekretäre eingeschlossen – fühlte er sich in dankbarer Liebe verbunden.
Die Gemeinschaft in geistlichen Dingen mit seinen Freunden in Tottenham und andernorts konnte er nicht vergessen. Wenn er auch ihre Fehler schmerzlich empfand, sehnte er sich doch sehr nach der Atmosphäre des Gebets, ihrer Liebe zu Gottes Wort und ihrem ernsten Ringen um Seelen zurück. In Schanghai machte sich der Einfluss der Welt sogar in christlichen Kreisen stark bemerkbar. Durch den regen Verkehr mit Regierungsbeamten und Offizieren der Kanonenboote, die in Schanghai zum Schutz der Ausländersiedlung stationiert waren, stiegen die Ausgaben der Missionare, sodass ihre Gehälter erhöht werden mussten. Hudson Taylor hatte sich das Missionarsleben so ganz anders vorgestellt.
Natürlich passte er selbst auch nicht zu der allgemeinen Ansicht über einen Missionar. Dass er gut und ernst gesinnt war, konnte jeder sehen. Doch gehörte er weder einer besonderen Denomination an, noch war er von einer besonderen Kirche ausgesandt worden. Obwohl er das Medizinstudium nicht beendet hatte, arbeitete er auf medizinischem Gebiet. Er hatte zwar offensichtlich Übung im Predigen und in der Seelsorge, doch war er nirgends ordiniert worden. Und das Eigenartigste: Er gehörte einer Missionsgesellschaft an, die mit Mitteln wohl versehen war. Er schien aber ungenügend versorgt zu werden, da seine äußere Erscheinung im Vergleich zu den andern Missionaren ärmlich war.
Dass Hudson Taylor dies alles immer tiefer empfand, ist nicht verwunderlich. Er selbst sah sich in seinen Erwartungen enttäuscht und sehnte sich danach, im Inland unter dem Volke zu leben. Gern hätte er seine Ausgaben eingeschränkt und ein einfacheres Leben gewählt, wie er es von daheim gewöhnt war. Eifrig betrieb er sein Sprachstudium und machte sich nichts aus weltlicher Anerkennung und Vergnügen, sondern hätte gern geistliche Gemeinschaft mit anderen gepflegt. Mit seinem zugesagten Gehalt konnte er in Schanghai nicht auskommen, selbst mit dem doppelten Betrag nicht. Er war wirklich arm und kam bald in echte Verlegenheit. Niemand hätte dem Heimatkomitee diese Tatsache so erklären können, dass es seine Lage verstanden hätte.
Er war viel allein. Die Missionare, mit denen er zusammenlebte, waren alle älter als er mit Ausnahme des jungen Ehepaares, das aber ganz in seiner Arbeit aufging. Er durfte ihre Güte nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Deshalb konnte er mit niemandem über seine Missionsgesellschaft oder über zukünftige Pläne sprechen, die ihn doch so sehr beschäftigten. Er lernte bald, darüber so wenig wie möglich zu reden. Er litt zwar sehr unter diesen Umständen, aber es war gut, dass er nicht versuchen konnte, nur von Reis und Tee zu leben oder gar auf und davon zu gehen. Wenn er sein eigener Herr und Meister gewesen wäre, hätte er es bestimmt getan. Doch während der heißen Jahreszeit und in einem ungewohnten Klima fortzugehen, wäre ein gefährliches Unterfangen gewesen. Und mehr als dies – Gott verfolgte durch die ihm auferlegte Geldknappheit höhere Absichten. Er selbst sehnte sich nach Unabhängigkeit. Gott aber gefiel es, ihn in diesen Umständen zu lassen, damit er lernen sollte, was es bedeutet, arm, schwach und von andern Menschen ganz abhängig zu sein. Gottes Sohn wurde denselben Weg geführt. Es gibt eben Lektionen, die nur auf diesem Wege gelernt werden können.
Ohne solche Erfahrungen in seiner ersten Zeit in China hätte er später nie mit andern so mitfühlen können. Er war von Natur aus sehr unabhängig und wollte frei sein, damit nichts der Führung Gottes in seinem Leben hindernd im Wege stände. Und nun fand er sich gleich am Anfang seines neuen Lebens in China auf die Großherzigkeit Fremder angewiesen.
Im Lauf des Frühlings ließ sein Tagebuch mehr Zeichen von Niedergeschlagenheit erkennen, als dem Klima zugeschrieben werden konnte. Seine ohnehin schwachen Augen entzündeten sich, und er litt viel an Kopfschmerzen. Trotzdem saß er täglich durchschnittlich fünf Stunden hinter seinen chinesischen Büchern und widmete der Korrespondenz viel Zeit. An Mr Pearse schrieb er so ausführlich wie möglich und versuchte Nachrichten zu übermitteln, die die Leser der „Ährenlese“ interessieren mussten.
Aus diesen Briefen ist ersichtlich, wie sehr er die Eintönigkeit seines Lebens zu fühlen begann. Es gab auch wenig Interessantes zu berichten. Er musste diesen Zustand der Ermüdung und Enttäuschung durchleben, durch den so leicht die geistliche Brauchbarkeit und Kraft verloren geht.
Es war Hudson Taylors gesundem Urteilsvermögen und seiner guten Erziehung zu verdanken, dass er während dieser Monate des Sprachelernens den erwähnten Gefahren leichter entging als mancher junge Missionar.
Von frühester Kindheit an war er angeleitet worden, sich für die Natur zu interessieren. Seine Schmetterlinge und Insekten hatte er trotz des beschränkten Raumes in seinem Elternhaus sorgfältig untergebracht und gepflegt. So fing er auch hier an, sich eine Insektensammlung anzulegen. Im April schrieb er in sein Tagebuch:
„25. April. Bestellte einen Kasten für die Insekten. Brachte den Tag mit Lernen und Fotografieren zu.
28. April. Wieder sehr warm. Studierte fünf Stunden Chinesisch. Litt heftig an Kopfschmerzen. Fing einige Insekten, die ersten meiner Sammlung.
29. April. Sechs Stunden Chinesisch. Nach dem Abendessen suchte ich nach Insekten. Hatte Mühe, wieder in die Kolonie hineinzukommen, weil die Tore bereits geschlossen waren.“
Im Mai schrieb er an seine Mutter:
„Heute fand ich den größten Schmetterling, den ich je gesehen habe, ein schwarzes Exemplar. Zuerst dachte ich, es sei ein Vogel, obgleich die Art seines Fliegens mir eigentümlich vorkam. Als er sich auf einen Baum setzte und ich das wundervolle Geschöpf näher betrachtete, nahm mir seine Schönheit beinahe den Atem.
Ich beabsichtige, besondere botanische Exemplare zu sammeln. Es wachsen hier eigenartige Bäume. Sie stehen voller Blüten, ehe ein einziges Blatt zu sehen ist. Unter den wildwachsenden Pflanzen finde ich viele alte Freunde wie Veilchen, Vergissmeinnicht, Butterblumen, Klee, Löwenzahn und andere gewöhnliche Kräuter. Es gibt auch viele mir unbekannte Sorten. Sie sind alle sehr schön.“
Auch andere Studien nahm er mit großem Eifer auf, vor allem Medizin und Chemie. Er wollte das in der Heimat erworbene Wissen nicht verlieren. An chinesische Klassiker verwandte er viel Zeit. Er scheint überhaupt jederzeit mit Büchern über Geschichte und andere Wissenschaften, auch mit Biografien beschäftigt gewesen zu sein.
„Vor dem Frühstück medizinische Lektüre, dann beinahe sieben Stunden Chinesisch. Nach dem Abendessen je eine Stunde Griechisch und Latein. Es ist gut, zum Abschluss des Tages eine großgedruckte Bibel lesen zu können. Deshalb ist mir Tante Hardys Geschenk eine große Hilfe. Die genannten Studien sind aber notwendig. Einige klassische Sprachen Europas hätte ich besser früher richtig gelernt. Wenn ich sie jetzt nicht lerne, werde ich dazu nie mehr Gelegenheit finden. Die schönsten Tagespflichten sind jedoch die, die zu Jesus führen – Gebet, Lesen und Nachdenken über Gottes Wort.“
Trotz quälender Hitze wurde das Programm durchgeführt. Nur ein- oder zweimal unterbrach er die Studien und reiste mit seinem Freund Burdon in die Dörfer hinaus. Die Besuche lohnten sich, denn die Leute schienen sich über das Wiedersehen mit den Missionaren zu freuen.
„Ich glaube sagen zu dürfen, dass ich hier jetzt einen Freund besitze“, fügte er einem Brief bei, in dem er nach einem solchen Ausflug über einen glücklich verbrachten Abend bei diesem Ehepaar berichtete. „Ich werde ihn aber nicht oft besuchen, weil ich nur einer seiner vielen Freunde bin und er doch seine Frau als Gefährtin hat. Ich selbst sehne mich sehr nach einem Gefährten. Tagsüber bin ich mit meinem Lehrer zusammen, aber die Abende verbringe ich meistens allein.“
Während seines ersten Chinajahres schrieb er viele Briefe und wartete dann natürlich sehnsüchtig auf Antworten von daheim. Wenn kein Brief kam, war seine Enttäuschung immer groß.
Er schrieb Mitte Juni an seine Mutter:
„Als die letzte Post kam und ich an jenem glühend heißen Tag eineinhalb Meilen nach dem Konsulat gewandert war und beinahe zwei Stunden wartete, wodurch ich das Mittagessen verpasste, erlebte ich die Freude, Briefe und Zeitschriften für alle Missionare vorzufinden, jedoch keinen einzigen für mich selbst. Als ich sehen musste, dass wirklich nichts für mich dabei war, fühlte ich mich sehr elend und vermochte kaum nach Hause zurückzuwandern. Dabei vernahm ich, dass wir vor sechs oder acht Wochen keine weitere Post erwarten könnten.“
Besonders tief empfand er eine weitere Prüfung während dieser Sommermonate. Seine Finanzlage hatte sich nicht gebessert. Anscheinend hatte die CEG eine falsche Vorstellung davon. Das erste Vierteljahr seit seiner Ankunft ging dem Ende entgegen, und er besaß nur noch geringe Mittel. Bald würde er Geld von der Bank abheben müssen, weil er bereits zu viel ausgegeben hatte. Wenn es so weiterging, musste sein Jahresgehalt aufgebraucht sein, ehe das erste Halbjahr vergangen war. Was aber würde das Komitee dazu sagen?
Mit ängstlicher Sorgfalt erklärte er Mr Pearse jede Einzelheit seiner Ausgaben. Es war die erste Abrechnung. Aus ihr war klar zu ersehen, wie sehr er darauf bedacht war, sorgfältig mit dem ihm anvertrauten Geld umzugehen.
„Ich bin ganz niedergeschlagen“, schrieb er, „wenn ich denke, wie viel die Gesellschaft für mich ausgibt, und wie wenig Brauchbares ich dafür leiste.“
Ausgerechnet in dieser Zeit kam auf Umwegen eine wichtige Nachricht zu ihm, die seine Verlegenheit auf den Höhepunkt trieb. Die Gesellschaft hatte einen weiteren Missionar nach Schanghai abgeordnet, einen Familienvater. Dr. Parker, ein schottischer Arzt, war bereits unterwegs und würde bald eintreffen. Unter andern Umständen wäre er über diese Nachricht überaus glücklich gewesen, in der gegenwärtigen Lage entmutigte sie ihn. Selbst von der Freigebigkeit anderer abhängig, sollte er nun noch für ein Ehepaar mit drei Kindern eine Unterkunft vorbereiten. Kaum wagte er den Missionaren davon zu sagen. Doch ob er schwieg oder nicht, bald schon musste die Neuigkeit das Gesprächsthema der Niederlassung sein.
Besorgt wartete er auf Briefe von seiner Mission, die seine Lage klären würden. Nachdem er über seine Verhältnisse so genau nach London berichtet hatte, konnte er bestimmt mit einer Nachricht rechnen, wie er sich diesem Zuwachs gegenüber verhalten sollte. Eine Post nach der andern kam, ohne dass etwas von Dr. Parkers Kommen erwähnt wurde. Auch wiederholte Bitten und Anweisungen blieben unbeantwortet. Weil der Sommer aber schon bald zu Ende ging, sah sich Hudson Taylor gezwungen, nach eigenem Ermessen zu handeln.
Unterdessen fehlte es nicht an Bemerkungen und Fragen, die die Lage noch erschwerten.
„Stimmt es, dass ein Arzt mit Familie nach Schanghai kommt? Wann haben Sie davon gehört? Warum haben Sie uns nichts davon gesagt? Haben Sie schon Land gekauft? Warum haben Sie noch nicht zu bauen begonnen?“ Und so weiter. Auf keine dieser Fragen konnte er befriedigende Antworten geben.
Je länger er über die Lage nachsann, desto deutlicher erkannte er, dass für den Augenblick nichts anderes zu tun übrig blieb, als im Chinesenviertel der Niederlassung ein chinesisches Haus zu suchten, in dem er die bald eintreffenden Missionare unterbringen konnte. Trotz der herrschenden Hitze begab er sich ohne die übliche Sänfte auf die ermüdende Suche. Seit seiner Ankunft in China vor vier oder fünf Monaten hatte er sich um eine Unterkunft bemüht, ohne einen einzigen Raum zu finden. Er wäre sicher verzweifelt, hätte er nicht aus dieser persönlichen Hilflosigkeit kostbare Lektionen gelernt und die Kraft des Allmächtigen erfahren.
„Wie du weißt“, schrieb er im Juli, „wurde ich seit meiner Ankunft über alle Maßen bedrängt. Doch Gottes Güte kennt kein Ende. In den letzten Tagen habe ich Seine Liebe so köstlich erlebt. Einige Verheißungen schienen persönlich für mich geschrieben zu sein und haben auch unmissverständlich zu mir geredet. Ich glaube bestimmt, dass liebe Freunde meiner besonders im Gebet gedacht haben. Dafür bin ich wirklich von Herzen dankbar.“