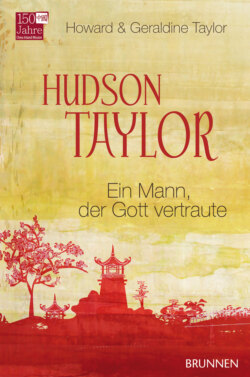Читать книгу Hudson Taylor - Howard Taylor - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Von Glauben zu Glauben
Оглавление1851–1852
Dr. Robert Hardy war als tüchtiger Mediziner und bewährter Christ stadtbekannt. Groß und kräftig gewachsen, besaß er ein ungewöhnlich sanftes Gemüt und viel Humor. Seine stets gute Laune war unwiderstehlich, und alle, die mit ihm zu tun hatten, mussten, ob sie es wollten oder nicht, den Dingen die beste Seite abgewinnen. Seine chirurgische Klinik befand sich am äußersten Ende des schmalen Gartenstreifens, auf der Hinterseite seines Hauses. Hier fühlte sich Hudson bald heimisch. Er lernte leicht und eifrig. Seine Kenntnisse in der Buchführung waren dem viel beschäftigten Arzt willkommen und gern überließ er solche Arbeiten seinem Assistenten. Dieser wohnte zuerst eine kurze Zeit im Hause Dr. Hardys, siedelte aber, als der Raum von dessen Familie benötigt wurde, zu seiner Tante über.
Obgleich glücklich in allem, was seine äußeren Umstände betraf, war Hudson durchaus nicht frei von innerer Sorge und Unruhe. Er war nach Hull gekommen, um sich für die ärztliche Mission vorzubereiten, doch ließen die ausgefüllten Tage mit Dr. Hardy zusammen wenig Zeit zum Studium übrig. Er dachte beständig darüber nach, wie er sich ausrüsten und sein Lebenswerk beginnen sollte, und fand es hart, geduldig auf Gottes Zeit warten zu müssen. Die stillen Räume der Klinik waren Zeugen mancher sorgenvoller Gedanken, die sich zu Gebeten formten. Den ganzen Sommer und Herbst hindurch ließen ihn diese Sorgen nicht zur Ruhe kommen. Es brannte in seinem Herzen noch jenes andere Feuer, das nicht wenig von seiner inneren Kraft verzehrte.
Seine Gefühle waren eben nicht in Harmonie mit Gott. Diese innere Zitadelle wird so oft als letzte Festung der Kontrolle Gottes ausgeliefert. Hudson hielt das Beste für sich zurück und erkannte nicht, dass jedes Lebensgebiet unter den Gehorsam Christi gebracht werden muss. Wahrscheinlich ihm selbst unbewusst, schenkte er jener einen, die als leuchtender Stern in sein Leben hineingekommen war, zu viel von sich selbst. Seine Liebe zu ihr vertiefte sich durch hoffnungsvolle Zeichen, dass auch er ihr nicht gleichgültig sei. Dabei begann er aber instinktiv zu fühlen, dass ihr Leben nicht völlig Gott ausgeliefert war. Er erkannte, dass sie sich gegen eine Zukunft sträubte, wie er selbst sie sich vorstellte.
„Müssen Sie denn nach China ziehen?“, fragte sie ihn verschiedentlich. „Wie viel schöner wäre es doch, wenn Sie in der Heimat blieben und dem Herrn hier dienten!“
Er bat Gott, Er möge es dazu kommen lassen, dass sie ihn verstände und sich geführt wüsste wie er. Es stand für ihn fest, dass ihn nichts, selbst nicht der Verlust ihrer Liebe, von seiner Berufung abbringen könnte. Woher aber sollte er die Kraft zum Durchhalten nehmen? Wie könnte er den Verlust jetzt ertragen, da es schien, als liebe sie ihn wirklich? Er kämpfte in jenen Herbsttagen einen harten Kampf, als er es sich nicht länger verhehlen konnte, dass ihre Wege sich trennen mussten. Doch um ihn kümmerte sich ein Herz, das bis ins Verborgenste zu blicken vermag. Hudson Taylor war nicht allein in seiner Not.
Gott brachte ihn in Hull mit Christen zusammen, die ihm helfen konnten. Hudson wusste sich nicht bloß mit den Wesleyanern eins, sondern fühlte sich mit allen verbunden, die den Herrn Jesus Christus liebten. Bereits in Barnsley hatte er an den Versammlungen der Plymouthbrüder Gefallen gefunden. Und nun war er froh, in Hull Gleichgesinnte zu finden.
Gottes Wort bedeutete ihm viel. Die Predigt dieser Männer bestand vor allem in der Auslegung der Heiligen Schrift. Das war es, was er brauchte: eine neue Schau ewiger Dinge – denn vor ihm lag ein schwerer Weg. Hier fand er Gläubige, die ihm in zeitlichen und ewigen Belangen ein Beispiel gaben, das seine Gedanken weit übertraf. Diese Leute standen in enger Verbindung mit Georg Müller in Bristol, dessen Werk sich damals in erstaunlicher Weise ausbreitete. Dieser sorgte für Hunderte von Waisenkindern und erwartete die Mittel zu deren Unterhalt allein von Gott. Diese eine Aufgabe genügte aber diesem Manne nicht. In seiner tiefen Überzeugung, dass jetzt die Tage zur Ausbreitung des Evangeliums genützt werden sollten „zu einem Zeugnis über alle Völker“, unterstützte er Missionare ganz oder teilweise und beteiligte sich an der Verbreitung der Heiligen Schrift in katholischen wie in heidnischen Ländern. Das ganze weitverzweigte Werk, das allein durch den Glauben an Gott – nicht durch Aufrufe zur Unterstützung – die Garantie eines festen Einkommens hatte, war ein Zeugnis der Macht ernsten, anhaltenden Gebets. Als solches beeindruckte es Hudson Taylor tief und ermunterte ihn mehr als alles andere auf dem Wege, den er selbst einschlagen wollte.
„Es ist sehr schwer, unsere Neigungen ganz auf göttliche Dinge zu richten“, schrieb er. „Ich versuche, ‚ein lebendiger Brief Christi‘ zu sein. Doch wenn ich in mich hineinblicke, muss ich mich wundern, dass Er mich nicht aufgibt. Ich versuche, meinen Willen unter Gottes Willen zu stellen, meinen mit Seinem in Einklang zu bringen, und bete: ‚Dein Wille geschehe!‘ Doch während ich mich darin versuche, kann ich mich kaum der Tränen erwehren; denn ich fühle, dass ich meine Geliebte verlieren werde. Gott allein weiß, wie schwer der Kampf ist, und was es bedeutet, mit Überzeugung zu sagen: ‚Doch nicht mein Wille geschehe!‘
Meinst Du, es sei recht, wenn ich schon bald nach London umsiedle? Ginge ich bloß um der Freude willen, so wäre ich schnell dazu bereit, doch dürfen mich nicht meine Freuden von dem Wege der Pflicht abhalten. Vielleicht könnte Lobscheid mir aber doch wichtige Auskünfte vermitteln. Damit wäre die Reise gerechtfertigt. Gern werde ich Deinen Rat hören.“
Der deutsche Missionar Lobscheid, den er hier erwähnt, war erst vor Kurzem aus China zurückgekehrt. Er war einer der wenigen, die aus Erfahrung wussten, ob ein Missionswerk außerhalb der Vertragshäfen aufgebaut werden könnte. Seine medizinischen Kenntnisse hatten ihm verschiedentlich den Weg ins Innere Chinas gebahnt. Nun weilte er kurze Zeit in England und Hudson Taylor war begierig, seine Ratschläge zu hören.
Die Eltern stimmten dem Plane bei, und Dr. Hardy beurlaubte ihn für eine Woche. So entschloss er sich, einen Sonderzug nach London zu benutzen. Seine Schwester Amalie durfte ihn begleiten. Beide hatten die Hauptstadt noch nie besucht.
Amalie freute sich ebenso sehr wie er auf die Besprechung mit Mr Pearse und dem Missionar aus China, aber auch auf den Besuch der ersten internationalen Ausstellung im Kristallpalast.
Amalies sechzehnten Geburtstag feierten sie mit einem Besuch der Ausstellung und bewunderten die unter Farnsträuchern ausgestellten märchenhaften Edelsteine. Sie erlaubten sich auch eine Mahlzeit in einem vornehmen Hotel. Später durchwanderten sie die belebte Stadt bis zur Bank von England, wo sie Mr Pearse treffen wollten.
Als viel beschäftigtes Mitglied der Börse und als Sekretär der Chinesischen Evangelisationsgesellschaft hatte Mr Pearse während der Bürostunden wenig Zeit für Besucher. Doch freute er sich, seinen Briefschreiber aus Barnsley kennenzulernen. Während er sich mit dem ernsten jungen Mann und seiner einfachen, sympathischen Schwester unterhielt, vertiefte sich sein Interesse für Hudson.
Natürlich mussten die Geschwister seine gläubigen Freunde in Tottenham kennenlernen! Dort würden sie bestimmt warmes Interesse für China finden, meinte Mr Pearse. Er brachte sie denn auch am darauffolgenden Sonntag in diesen Kreis.
In einer Umgebung, so vollkommen wie Reichtum und Eleganz sie nur gestalten können, versammelten sich an jenem Sonntag einige gläubige Familien in dieser Vorstadt Londons. Durch schön ausgestattete, gemütliche Räume ging man auf Rasenplätze mit weit ausladenden Zedern, die angenehmen Schatten verbreiteten. Hier gab es stille Gespräche über die tiefsten Fragen des Königreichs Gottes. Doch das Beste von allem – die Liebe Christi – erfüllte sie alle. In jenen Tagen begann die Freundschaft zwischen diesen Gläubigen und den Geschwistern, die ein ganzes Leben anhielt.
„Ich liebe Tottenham“, schrieb Hudson Taylor einige Jahre später aus China. „Und ich liebe die Menschen, die dort wohnen. Von keinem andern Ort könnte ich sagen, dass jede Erinnerung freundlich und wertvoll und nicht durch schmerzliche Gedanken oder Umstände getrübt wäre. Nur sehe ich sie leider nicht mehr.“
Und die Freunde in Tottenham, was dachten sie an jenem Sonntag von ihm? Sie sahen einen einfachen jungen Menschen, still und unaufdringlich im Wesen. Weil er durch Mr Pearse als angehender Missionar eingeführt worden war, wurde er vielleicht mehr beachtet, als es sonst der Fall gewesen wäre. Er entsprach allerdings nicht ihren Vorstellungen über einen Missionar, war er doch so jung und voll Humor. Sie liebten ihn deswegen nicht weniger, denn sie fühlten sein tiefes Interesse für China. Er gewann ihr Vertrauen und seine kleine Schwester ihre Herzen.
Doch der Missionar, den die Geschwister kennenlernen wollten, schien sie wenig ermutigt zu haben.
„Niemals würden Sie nach China passen“, rief dieser nach ihrer Unterredung mit ihm aus. Er wies dabei auf Hudsons blondes Haar und seine blauen Augen. „Sie heißen mich sogar ‚roter Teufel‘! Gewiss würden die Chinesen bei Ihrem Anblick davonlaufen und nie vermöchten Sie, diese zum Zuhören zu bringen.“
„Es ist aber Gott, der mich nach China gerufen hat“, antwortete Hudson Taylor. „Er kennt die Farbe meines Haares und meiner Augen.“
Kurz nach seiner Rückkehr nach Hull begann es sich um Hudson Taylor zu regen. Er wohnte wieder bei seinen Verwandten, wo für alles gesorgt war und er sich nichts Besseres wünschen konnte. Aber es war nicht der Ort, den Gott zur Formung dieses jungen Lebens im Blick auf China geplant hatte. Hudson hatte bereits gelernt, seine Gefühle zu beherrschen und sich in den Willen Gottes zu fügen. Es sollten ihn aber auch noch äußere Härten für sein künftiges Lebenswerk zubereiten. Dazu war ein kleines Heim, ein einziger Raum in einer abgelegenen Vorstadt, ausersehen. Hier sollte er lernen, allein zu sein, allein mit seinem Gott.
Die Schritte, die ihn dahin führten, waren ganz natürlich. Es begann, wie er selbst berichtet, mit einem Gewissenskonflikt.
„Ehe ich Barnsley verließ“, schrieb er, „beschäftigte mich die Frage des Aussonderns der Erstlingsfrucht und eines bestimmten Teils meiner Habe für den Dienst in China. Es schien mir nötig, das anhand der Bibel zu studieren. Dadurch wurde ich dann auch zu dem Entschluss geführt, mindestens den zehnten Teil allen Geldes, das ich verdienen oder bekommen würde, für den Herrn auszusondern.
Das Gehalt, das ich als Assistent in Hull erhielt, erlaubte mir dies ohne Schwierigkeiten. Die Übersiedlung aus dem Hause Dr. Hardys in das Heim meiner Verwandten brachte auch hierin eine Änderung. Ich erhielt zu meinem bisherigen Gehalt noch den Betrag für Kost und Unterkunft. Musste dies nicht auch verzehntet werden? Den Zehnten vom Ganzen zu geben, wäre mir unter den gegebenen Umständen unmöglich gewesen. Ich war ratlos. Nach viel Gebet und Nachdenken wurde ich dazu geführt, das gemütliche Heim und den angenehmen Kreis meiner Verwandten aufzugeben, ein kleines Zimmer in der Vorstadt zu mieten und selbst für mein Essen zu sorgen. Nun war es mir möglich, den Zehnten von meinem ganzen Einkommen zu geben. Wenn ich den Wechsel auch schmerzlich empfand, so lag doch viel Segen darin. In dieser Einsamkeit hatte ich mehr Zeit zum Bibellesen und zu Hausbesuchen. Dabei kam ich mit vielen im Elend lebenden Menschen zusammen und erkannte bald, dass ich noch mehr sparen und geben könnte.“
Dies liest sich so einfach und scheint so selbstverständlich. Man kommt kaum auf den Gedanken, es habe Hudson ein besonderes Opfer gekostet. Wie sah aber die Wirklichkeit aus, in die er hinüberwechselte?
Drainside, wie dieser Stadtteil hieß, bestand aus einer doppelten Reihe von Arbeiterhäusern, die einander über den Kanal hinüber grüßten. Der Kanal selbst war nichts als ein tiefer Graben, in den die Leute ihre Abfälle warfen, damit diese gelegentlich bei Hochwasser fortgeschwemmt würden. Drainside war durch einen einsamen, unbebauten Landstrich von der Stadt getrennt. Eine schlecht beleuchtete Straße verband Vorort und Stadt. Die Häuschen unterschieden sich in nichts voneinander. Jedes hatte eine Tür und zwei übereinanderliegende Fenster. Die Tür führte direkt in die Küche hinein, und über eine schmale Treppe gelangte man in ein Dachzimmer. Nur ganz wenige Häuser besaßen rechts und links von der Tür je ein Fenster und im Dachzimmer zwei.
An der Stadtseite des Kanals stand ein Eckhaus gegenüber einem ländlichen Gasthof, dessen Lichter in dunklen Nächten als Wegweiser dienten, beleuchteten sie doch den Morast und das Wasser des Draine. Hier wohnte die Familie eines Seemanns, der nur selten in seiner Heimat weilte. Mrs Finch und ihre Kinder bewohnten die Küche und den oberen Stock, während das untere Zimmer links zum Preis von drei Franken wöchentlich vermietet wurde. Der Preis war entschieden zu hoch, denn das ganze Haus kostete nicht viel mehr Miete, aber Hudson war nicht böse darüber, besonders als er merkte, wie viel sein Beitrag für die arme Frau bedeutete. Die Unterstützung von dem fernen Ehemann erreichte sie selten zur erwarteten Zeit.
Mrs Finch, eine aufrichtige Christin, schätzte sich glücklich, den „jungen Herrn Doktor“, wie sie ihn nannte, als Mieter zu haben. Sie tat ohne Zweifel ihr Bestes, um den kleinen Raum sauber und gemütlich zu halten. Ein Tisch aus Tannenholz, zwei Stühle und ein Bett bildeten die ganze Ausstattung. Vom Fenster aus konnte man auf einen schmalen Streifen Garten und den Draine sehen, dessen morastige Ufer den Kindern als Spielplatz dienten. Mag es auch im Sommer anders ausgesehen haben, im Herbst jedenfalls, als Hudson dort sein Heim aufschlug, wirkte Drainside trübselig genug. Sein einfaches Essen besorgte er sich auf dem Rückweg von der Klinik. Es war ein einsamer Weg durch die leere, dunkle Gegend am äußersten Stadtrand. Einsam verbrachte er auch seine Abende neben dem spärlichen Kaminfeuer. Auch sonntags war er allein. Nur die Vormittagsversammlung besuchte er in seinem Bezirk, oder er war unter der Menge, die die Docks des Humber aufsuchte.
Doch hier wohnte er mitten unter den Armen und Elenden. Hatte er in seiner früheren Umgebung Hausbesuche gemacht und dabei nur wenige Familien besuchen können, so gehörten diese Armen nun zu ihm und er wenigstens äußerlich zu ihnen. Sein Leben hatte damit einen neuen Zweck, und er lernte dabei manch köstliche Lektion. Er schrieb:
„Ich verfolgte in jener Zeit zwei Ziele. Einmal wollte ich mich an mancherlei Entbehrung gewöhnen und zum andern die Menschen besser unterstützen, die ich mit dem Evangelium erreichen wollte. Bald erkannte ich, dass ich mit viel weniger auskommen konnte, als ich früher geglaubt hatte. Alle entbehrlichen Speisen und Getränke schaffte ich ab. Es zeigte sich, dass ich nur eine ganz geringe Summe für meine persönlichen Bedürfnisse benötigte. Ich machte die Erfahrung, dass ich umso größeren Gewinn und mehr Freude für mein Inneres empfing, je weniger ich für mich ausgab und je mehr ich andern schenkte.“
Gott aber bleibt niemandes Schuldner. In seiner Einsamkeit erfuhr Hudson Taylor, was Gott einem Menschen schenkt, der alles für Ihn hingibt. Wohl hieß es für ihn, Opfer zu bringen. Man kann nicht ohne Entsagung und Selbstverleugnung wesenhaft in das Bild Jesu umgestaltet werden und einen fruchtbaren Dienst tun. Es ist leicht, ein wenig zu beten, ein wenig zu helfen, ein wenig Liebe zu üben. Aber der Heidenapostel meint mehr, wenn er sagt: „Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Schaden geachtet, ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um deswillen ich alles habe für Schaden gerechnet, und achte es für Kot, auf dass ich Christus gewinne und in Ihm erfunden werde“ (Phil. 3,7-9).
Auch nach der Enttäuschung über Dr. Gützlaffs vermeintliche Mitarbeiter gab es in der Erziehungsschule des Herrn Menschen, auf die er sich verlassen konnte. Doch hatte die große Mehrzahl der Gläubigen in der Heimat das Interesse an Chinas Evangelisation verloren und aufgehört, dafür zu beten. Es waren nur wenige und schwache, unbekannte, unbedeutende, aber willige Menschen, die bereit waren, jeden Weg zu gehen, damit Gottes Plan ausgeführt werde.
Hier in seiner einsamen Stube wohnte ein solcher Mann. Als immer neue Prüfungen über ihn kamen, denen er hätte ausweichen können, wählte er den Weg der Entäußerung und des Kreuzes. Er wollte damit nicht ein Verdienst erwerben, sondern wusste sich einfach durch Gottes Geist so geführt. Deshalb konnte der Segen ungehindert fließen.
Ganz gewiss gab es viele Widerstände, die Hudson Taylors Pläne verhindern wollten. Für ihn aber kam eine der fruchtbarsten Zeiten seines Lebens, reich an Segen für sich und andere. Ist es da zu verwundern, dass der Feind auf dem Plane war? Einsam, hungernd nach Liebe und Verständnis, führte er ein Leben der Selbstverleugnung. Wahrlich hart für einen jungen Menschen. Ihm sollte es jedoch zum Besten dienen.
Der gefürchtete Schlag fiel, als er bereits einige Wochen in Drainside gewohnt und seine Lage schmerzlich genug empfunden hatte. Die geliebte Freundin erkannte, dass sie Hudson nicht von seinem Missionsplan abbringen konnte, und gab ihm ihren Entschluss klar zu erkennen. Sie war nicht bereit zu einem Leben in China. Ihr Vater wollte nichts davon hören, und sie selbst fühlte, dass sie dazu nicht geeignet wäre. Dies konnte für Hudson nur eins bedeuten: das Erwachen aus einem Traum, der ihn zwei Jahre lang gefangen genommen hatte.
Dieses Erlebnis war nicht nur ein tiefer Kummer, sondern eine ungeheure Glaubensprobe. Der Versucher unternahm alles, um Gottes Liebe und Treue infrage zu stellen. Wäre es ihm jetzt gelungen, Hudsons Vertrauen auf Gott zu zerstören und ihn zum Aufgeben des Kampfes zu bewegen, so wäre es nie zur Fruchtbarkeit seines späteren Lebens gekommen.
Die Krise stellte sich am Sonntagmorgen, dem 14. Dezember, im kalten, unfreundlichen Zimmer in Drainside ein. Anstatt sich in seinem unsagbaren Jammer an den Herrn zu wenden, behielt er diesen für sich. Beten wollte er nicht. Das Leid stellte sich zwischen ihn und Gott. Er konnte und wollte nicht wie gewöhnlich den Morgengottesdienst besuchen. Allzu bittere Fragen und Trauer erfüllten sein Herz. Es kam der heimtückische Vorschlag: „Lohnt es sich überhaupt? Warum sollst du eigentlich nach China ziehen? Warum dich mühen und quälen dein Leben lang – für ein Ideal, eine Pflicht? Gib es jetzt auf, solange du die Geliebte noch zurückgewinnen kannst! Verdiene dir deinen Lebensunterhalt wie alle andern Menschen und diene dem Herrn in der Heimat! Noch ist sie für dich erreichbar.“ Er schrieb darüber an seine Schwester:
„Satan schien hereinzubrechen wie eine Flut, bis ich innerlich zu Gott schrie: ‚Errette mich, Herr, ich verderbe!‘ Doch Satan flüsterte mir weiter zu: ‚Du warst früher nie so sehr angefochten wie in der letzten Zeit. Du bist bestimmt nicht auf dem rechten Weg, sonst würde dir Gott helfen und dich tiefer segnen‘ und so fort, bis ich nahe daran war, alles aufzugeben. Zum Besuch der Versammlung hatte ich keine Lust.
Doch Gott sei dafür gedankt – ich erkannte, dass der Weg der Pflicht der sicherste ist. Ich besuchte trotzdem die Versammlung, so elend mir auch zumute war, und … kehrte als ein anderer zurück. Ein Lied schnitt mir tief ins Herz. Ich war froh, als gleich nach dem Singen gebetet wurde, weil ich meine Tränen nicht länger zurückzuhalten vermochte. Dadurch wurde die Last schon leichter.
Als ich dann am Nachmittag allein in der Klinik saß, begann ich über die Liebe Gottes, Seine Güte und meine Antwort darauf, sowie über die vielen Segnungen und wenigen Schwierigkeiten nachzusinnen. Gott machte mein Herz weich und demütig. Seine Liebe schmolz meine erstarrte Seele, und ich betete ernstlich um Vergebung für mein undankbares Verhalten.
Gott hat mich wirklich gedemütigt, mir gezeigt, was ich bin, und sich mir als gegenwärtige Hilfe zur Zeit der Not erwiesen. Obgleich Er mir das Gefühl meines Elends nicht wegnimmt, hilft Er mir doch einstimmen in das Lied: ‚Ich will mich des Herrn und Gottes, meines Erlösers, freuen.‘ Nun kann ich Ihm für alles danken, sogar für die schmerzlichsten Erfahrungen der Vergangenheit, und Ihm ohne Furcht in allem vertrauen, was die Zukunft für mich bereithält.“
Von diesem Tage an findet sich ein neuer Ton in seinen Briefen. Sie sind nicht mehr voller Selbstbetrachtungen, sondern voller Gedanken über Missionsziele. China rückt wieder in den Vordergrund seines Denkens.
„Ich kann es weder in Worte fassen noch umschreiben, wie sehr ich mich nach der Zeit sehne, da ich die Frohe Botschaft armen, verlorenen Sündern in China bringen kann“, schrieb er an seine Mutter. „Dafür könnte ich alles drangeben, jeden Götzen, so lieb er mir auch sein mag. Es ist mir, als könne ich nicht leben, wenn nicht etwas für China getan wird.“
Die Ursache dazu war nicht Gefühl oder Begeisterung, auch kein oberflächliches Interesse, das durch Aussicht auf persönliche Vorteile wieder verwischt werden konnte. Ihm bedeutete die Missionsarbeit nicht einen begehrenswerten Zweig christlicher Tätigkeit. Nein, ihn hatte das Verlangen Jesu erfasst: „Dieselben muss ich herzuführen.“ Er glaubte, dass die Heiden ohne Kenntnis des einzigen und alleinigen Erlösers ewig verloren wären. Er glaubte, Gott habe Seinen eingeborenen Sohn dahingegeben, „auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“. Diese Überzeugung verpflichtete ihn zu einem Leben, das völlig der Verkündigung der großen Erlösung geweiht war, besonders denen gegenüber, die nie davon gehört hatten.
Während er gern sofort nach China ausgereist wäre, gab es Bedenken, die ihn zurückhielten.
„Für mich war der Gedanke, dass ich in China in Bezug auf Schutz, Unterhalt und Hilfe allein auf Gott angewiesen sein würde, eine tiefernste Sache“, schrieb er in jenem Winter. „Es war mir klar, dass ein solches Unternehmen besonderer Kraft bedurfte. Ich wusste, Gott würde zu Seinen Verheißungen stehen, wenn mein Glaube durchhielte. Doch was dann, wenn der eigene Glaube sich als unzureichend erweisen sollte? Damals hatte ich noch nicht gelernt, dass ‚Er sich selbst nicht verleugnen kann und treu bleibt‘, auch wenn wir nicht glauben. Deshalb beschäftigte mich die Frage, ob ich selbst genügend Glauben hätte, der dem vor mir liegenden Unternehmen entspräche. An Seiner Treue konnte ich nicht zweifeln. Ich überlegte, dass ich mich auf keinen Menschen und nichts Menschliches werde verlassen können, wenn ich nach China ausziehe. Außer Gott würde ich niemanden haben. Wie wichtig, dass ich vor dem Verlassen Englands lerne, Menschen ausschließlich durch Gott über das Gebet zu bewegen!“
Hudson Taylor wusste, dass allein der Glaube Berge versetzen, Schwierigkeiten überwinden und das Unmögliche vollbringen kann. Hatte er aber einen solchen Glauben? Würde er es einst in China allein aushalten können?
Er wusste auch, dass der Glaube, nach dem er sich ausstreckte, „eine Gabe Gottes“ ist und wachsen kann. Zu seinem Wachstum gehört Übung. Und diese Übung im Glauben ist ohne Prüfungen offenbar unmöglich. So musste also alles willkommen sein, was diese kostbare Gabe mehren und stärken konnte, um ihm selbst zu beweisen, dass er tatsächlich den Glauben habe, der durchhalten und zunehmen würde.
Hudson Taylor brachte diese Haltung in vollem Ernst und ganzer Aufrichtigkeit vor Gott. Er brachte auch in dieser Beziehung „den Zehnten ganz in das Kornhaus“. Welch eine wichtige Blickrichtung, die erst ermöglichte, den Glauben auszuleben! Darauf kann Gott mit Segen antworten. Mit einem Wort: Für eine Antwort Gottes auf seine Gebete lag kein Hindernis in ihm selbst. So folgten denn auch Erfahrungen, die Tausende in der ganzen Welt ermutigten.
Die folgende Geschichte – obgleich bereits bekannt – muss trotzdem hier wiederholt werden, illustriert sie doch den einzigen Grundsatz des Wachstums in geistlichen Dingen: „von Glauben zu Glauben“. Unser Herr selbst drückt es auch so aus: „Wer hat, dem wird gegeben.“
Es war Hudson Taylor wichtig, unbedingt noch vor seiner Abreise aus England zu lernen, „wie Menschen durch Gott allein über das Gebet bewegt werden“. Es dauerte auch gar nicht lange, bis sich eine einfache, natürliche Angelegenheit zur Erprobung dieser Lektion ergab. Lassen wir ihn selbst erzählen:
„Da mein freundlicher Prinzipal stets sehr beschäftigt war, wünschte er, dass ich ihn jedes Mal an mein Gehalt erinnern sollte, wenn dieses fällig wurde. Ich beschloss, ihn nicht zu erinnern, sondern Gott zu bitten, es zu tun und mich durch Erhörung meines Gebetes zu stärken. Als wieder einmal der Tag der Auszahlung des vierteljährlichen Gehalts näher rückte, befahl ich wie gewöhnlich die Sache dem Herrn an. Der Tag kam, doch Dr. Hardy sagte nichts. Ich betete weiter. Die Tage vergingen und er dachte nicht daran, bis mir zuletzt nur noch eine halbe Krone übrigblieb. Bis jetzt hatte ich keinen Mangel gehabt. Ich betete weiter.
Der folgende Sonntag war ein glücklicher Tag. Mein Herz war voll Freude. Nachdem ich morgens Gottes Wort gehört hatte, verbrachte ich den Abend mit Evangelisationsarbeit in den Mietshäusern des elendesten Stadtteils. In solchen Stunden schien es mir fast, als habe der Himmel auf Erden begonnen, als sei alles, was ich noch ersehnen könnte, bloß die Fähigkeit, ein größeres Maß an Freude fassen zu können. Nachdem ich meine letzte Versammlung etwa um zehn Uhr beendet hatte, bat mich ein armer Mann, ihn zu seiner sterbenden Frau zu begleiten, um mit ihr zu beten. Ich willigte ein und fragte ihn unterwegs, warum er nicht zum Priester geschickt habe, denn seine Aussprache verriet, dass er ein Ire war. Er habe es getan, antwortete er, aber der Priester habe nicht ohne Bezahlung kommen wollen. Bezahlen könne er aber nichts, weil seine Familie am Verhungern sei. Sofort fiel mir ein, dass ich selbst nur noch eine halbe Krone besaß. Ich überlegte, was ich zum Abendbrot essen könnte – die übliche Wassersuppe. Zum Frühstück bliebe auch noch etwas übrig. Gäbe ich aber die halbe Krone weg, so hätte ich nichts mehr für den kommenden Mittag. Bei diesen Erwägungen fühlte ich ein Nachlassen des Freudenstroms in meinem Herzen. Statt mich selbst zu tadeln, schalt ich den armen Mann. Er hätte sich doch an die Behörden wenden sollen. Das habe er bereits getan, antwortete er, und die Weisung erhalten, am nächsten Morgen wieder zu erscheinen, doch er befürchte, seine Frau werde die Nacht nicht überleben.
Ich überlegte: Hätte ich doch bloß kleinere Geldstücke statt dieser halben Krone bei mir, wie gern würde ich den Leuten einen Schilling geben! Mich von dem ganzen Geld zu trennen, kam mir nicht in den Sinn. Ich dachte nicht daran, dass Gott mich eine andere Wahrheit lehren wollte. Bis jetzt hatte ich Gott mit etwas Geld in der Tasche vertraut; nun sollte ich lernen, das auch ohne Geld zu tun.
Mein Führer geleitete mich in einen Hof. Ich folgte ihm etwas ängstlich, denn schon früher war ich einmal hier gewesen und grob behandelt worden. Man hatte meine Traktate zerrissen und mich hart bedroht. Aber es war der Weg der Pflicht. So folgte ich dem Mann. Über eine baufällige Treppe gelangten wir in einen elenden Raum. Vier oder fünf Kinder standen umher. Ihre eingesunkenen Wangen und Schläfen redeten eine deutliche Sprache. Sie waren dem Verhungern nahe. Auf einem dürftigen Lager erblickte ich eine erschöpfte Mutter mit einem winzigen Kindlein, das an ihrer Seite mehr wimmerte als weinte.
Ach, hätte ich doch jetzt ein Zweischillingstück und einen halben Schilling anstatt der halben Krone besessen! Noch immer ließ mich ein jämmerlicher Kleinglaube die innere Stimme überhören. Ich vermochte nicht die Not zu lindern, weil es mich zu viel kostete.
Es wird niemanden verwundern, dass ich diesen Leuten nicht viel Trost geben konnte. Ich sagte ihnen, sie sollten nicht mutlos sein, wenn ihre Verhältnisse auch sehr traurig seien, lebe doch im Himmel ein guter, liebender Vater. Während ich das sagte, tönte es in meinem Herzen: ‚Du Heuchler! Du sprichst zu diesen unbekehrten Menschen von einem gütigen, liebenden Vater im Himmel und du selbst vertraust Ihm nicht, wenn du dich von deiner halben Krone trennen solltest!‘
Mir war, als müsse ich ersticken. Wie gern hätte ich mit meinem Gewissen einen Vergleich abgeschlossen! Ich konnte unmöglich weiterreden. Merkwürdigerweise meinte ich aber, mit Leichtigkeit beten zu können. In jenen Tagen war mir das Gebet eine Freude. Niemals schien mir die Zeit zu lang, die ich dabei verbrachte. So war es mir auch jetzt, als brauchten wir nur niederzuknien und zu beten, damit wir gemeinsam getröstet würden.
‚Sie haben mich gebeten, mit Ihrer Frau zu beten‘, sagte ich zu dem Mann, ‚das wollen wir jetzt tun.‘ Dabei kniete ich nieder. Doch kaum hatte ich meine Lippen zu einem Vaterunser geöffnet, als das Gewissen mahnte: ‚Du wagst es, deines Gottes zu spotten? Du wagst es, niederzuknien und Ihn Vater zu nennen mit deiner halben Krone in der Tasche?‘ Es tobte ein solch schrecklicher Kampf in mir, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Wie ich durch das Vaterunser hindurchkam, weiß ich nicht. In einem unaussprechlichen Gemütszustand erhob ich mich von meinen Knien.
Der arme Vater wandte sich daraufhin zu mir und sagte: ‚Sie sehen, wie schrecklich es um uns steht. Wenn Sie uns helfen können, dann tun Sie es um Gottes willen!‘
Dabei fuhr mir das Wort durch den Sinn: ‚Gib dem, der dich bittet!‘ In des Königs Wort liegt Gewalt. Ich steckte meine Hand in die Tasche, zog das Geldstück langsam heraus und gab es dem Mann. Dabei sagte ich ihm: ‚Sie denken wohl, es fällt mir leicht, Ihnen zu helfen, weil ich gut gekleidet bin. Dies ist aber mein letztes Geldstück. Vertrauen Sie Gott wie einem Vater!‘
Nun strömte die Freude in mein Herz zurück wie eine Flut. Jetzt konnte ich den Leuten alles sagen und es auch selbst glauben. Das Hindernis, das den Segen aufhielt, war weg – wie ich hoffte, für immer.
Nicht bloß das Leben der Frau wurde gerettet, sondern eine neue Kraft erfüllte mein Glaubensleben, das armselig geworden wäre, hätte ich der Weisung Gottes in diesem Augenblick nicht Folge geleistet.
Ich kann mich gut erinnern, in welchem Gemütszustand ich an jenem Abend in mein Zimmer zurückkehrte. Mein Herz war so leicht wie meine Tasche. Die dunklen, einsamen Straßen hallten wider von meinem Freudengesang, den ich nicht unterdrücken konnte. Die Schüssel Grütze, die ich vor dem Schlafengehen zu mir nahm, hätte ich nicht mit einem fürstlichen Mahl vertauschen wollen. Als ich dann an meinem Bett niederkniete, erinnerte ich den Herrn an Sein Wort: ‚Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn.‘ Ich bat Ihn, nicht zu lange von mir zu leihen. Daraufhin verbrachte ich eine glückliche, ruhige Nacht in Seinem Frieden.
Am nächsten Morgen hatte ich zum Frühstück noch einen Teller Grütze. Ehe ich diesen geleert hatte, hörte ich den Briefträger an meine Tür klopfen. Gewöhn lich erhielt ich montags keine Briefe, da meine Eltern und die meisten meiner Freunde nicht gern sonnabends Briefe abschickten. So war ich erstaunt, als Mrs Finch mit einem Brief hereintrat. Die Handschrift kannte ich nicht und der Poststempel war verwischt, sodass der Name des Absenders unleserlich war. Als ich den Umschlag öffnete, fand sich nichts Geschriebenes darin. Er enthielt ein Paar in weißes Papier gewickelte lederne Handschuhe. Als ich sie erstaunt in die Hand nahm, rollte ein Zehnschillingstück aus ihnen heraus.
‚Dem Herrn sei Dank!‘, rief ich laut. ‚Vierhundert Prozent für zwölf Stunden Anleihe, das nenne ich ein gutes Geschäft. Wie froh wären die Kaufleute in Hull, wenn sie unter solchen Bedingungen Geld ausleihen könnten!‘ In dieser Stunde gelobte ich mir, dieser Bank, die solche Zinsen zahlte und nie Bankrott macht, von jetzt ab alle meine Ersparnisse zu geben – ein Entschluss, den ich nie zu bereuen hatte.
Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich mich später an dieses Ereignis erinnerte, und wie viel es mir in schwierigen Verhältnissen bedeutete. Wenn wir in kleinen Dingen gegen Gott treu sind, gewinnen wir Erfahrung und Kraft zu ernsteren Proben. Diese wunderbare Durchhilfe war für mich eine große Freude und eine Glaubensstärkung. Aber natürlich reichen zehn Schilling selbst bei größter Sparsamkeit nicht weit. Ehe vierzehn Tage verflossen waren, befand ich mich wieder in derselben Lage wie an jenem bedeutungsvollen Sonntagabend. Unterdessen bat ich Gott, doch Mr Hardy an mein fälliges Gehalt zu erinnern.
Am Wochenende fühlte ich mich äußerst unwohl, war ich es doch gewohnt, an den Samstagabenden meine Miete zu bezahlen. Ich wusste, wie sehr Mrs Finch darauf angewiesen war. Musste ich nicht um ihretwillen über die Gehaltsangelegenheit mit Dr. Hardy reden? Täte ich es aber, dann wäre dies für mich die Bestätigung meiner Unfähigkeit zur Gründung eines Missionswerks. Den ganzen Donnerstag und Freitag verbrachte ich alle Zeit, die ich erübrigen konnte, in ernstem Ringen mit Gott. Aber am Samstagabend befand ich mich in derselben Lage wie zuvor. Flehentlich bat ich Gott, mir zu zeigen, ob ich noch länger auf Seine Zeit warten sollte. Soviel ich beurteilen konnte, gab Er mir innerlich die Gewissheit, dass diesmal Warten das Beste sei und Er mir in irgendeiner Weise aushelfen werde. So wartete ich ruhig und die Last war weg.
Am Samstag warf sich Dr. Hardy ungefähr um fünf Uhr abends, nachdem er seine Rezepte geschrieben und den letzten Rundgang für den Tag beendigt hatte, in seinen Armstuhl und begann nach seiner Gewohnheit mit mir über göttliche Dinge zu reden. Er war ein echter Christ und wir verbrachten zusammen manche Stunde in glücklicher Gemeinschaft. Während unseres Gesprächs achtete ich auf die Uhr, denn in der Pfanne kochte eine Medizin und erforderte meine größte Aufmerksamkeit. Das war ein Glück für mich, denn ohne Zusammenhang sagte er plötzlich: ‚Übrigens, Taylor, ist nicht Ihr Gehalt fällig?‘
Man denke sich meine Erregung. Ich konnte nicht sogleich antworten. Meine Augen auf die Pfanne gerichtet und den Rücken dem Doktor zugewandt, sagte ich so ruhig wie möglich, dass es allerdings seit einiger Zeit fällig sei. Wie dankbar war ich in jenem Augenblick! Gott hatte mein Gebet vernommen und Dr. Hardy veranlasst, in der Zeit der größten Not an mein Gehalt zu denken, ohne ein Wort oder eine Andeutung meinerseits.
Dr. Hardy erwiderte: ‚Es tut mir leid, dass Sie mich nicht daran erinnerten. Sie wissen, wie beschäftigt ich bin. Hätte ich doch etwas früher daran gedacht! Erst heute Nachmittag schickte ich alles Geld zur Bank, sodass ich Sie nicht sofort ausbezahlen kann.‘
Es ist unmöglich, den Aufruhr in Worte zu fassen, der durch diese Eröffnung in meinem Herzen entstand. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Glücklicherweise kochte die Flüssigkeit in meiner Pfanne, und ich fand dadurch einen Anlass, das Zimmer zu verlassen. Ich war froh, fortzukommen und außer Sicht zu sein, damit er meine Bewegung nicht bemerkte.
Sobald sich Dr. Hardy entfernt hatte, suchte ich mein kleines Heiligtum auf und schüttete mein Herz vor Gott aus. Es währte geraume Zeit, bis wieder Stille einkehrte. Nicht nur Stille, sondern Freude und Dankbarkeit kehrten zurück. Ich fühlte, dass Gott Seinen eigenen Weg verfolgte und mich nicht verlassen würde. Am frühen Morgen hatte ich versucht, Seinen Willen zu erkennen, und so viel ich beurteilen konnte, die Weisung zum Warten von Ihm empfangen. Und jetzt handelte Gott für mich.
Den weiteren Abend verbrachte ich wie gewöhnlich am Samstag mit dem Lesen der Heiligen Schrift. Ich bereitete mich für den Abschnitt vor, den ich am Sonntag in den verschiedenen Mietshäusern besprechen wollte. Ungefähr um zehn Uhr holte ich meinen Mantel und schickte mich an, nach Hause zu gehen. Es gab nun keine Hilfe mehr an diesem Abend. Aber vielleicht würde Gott bis Montag für mich eintreten, damit ich Mrs Finch die Miete bezahlen könnte.
Als ich das Gas ausdrehen wollte, hörte ich den Schritt des Doktors im Garten, der zwischen dem Wohnhaus und der Klinik lag. Er lachte herzlich vor sich hin, als ob er sich über eine Sache königlich freute. In die Klinik eintretend, fragte er nach dem Hauptbuch und erwähnte nebenbei, sonderbarerweise sei soeben einer der reichsten Patienten gekommen und habe seine Rechnung bezahlt. Ob das nicht eigenartig sei? Es kam mir noch nicht in den Sinn, dass dies etwas mit mir zu tun haben könnte, sonst wäre ich wohl in große Verlegenheit geraten. Aber weil ich die Sache nur vom Standpunkt eines Unbeteiligten ansah, freute ich mich auch mit Verwunderung, dass ein vermögender Mann abends nach zehn Uhr persönlich erschien, um eine Rechnung zu bezahlen, was er jeden Tag bequem durch einen Scheck hätte erledigen können. Anscheinend war er darüber nicht zur Ruhe gekommen und innerlich gezwungen worden, noch zu solch ungewohnter Stunde seine Schuld zu begleichen.
Bald war der Betrag in das Hauptbuch eingetragen und Dr. Hardy wandte sich zum Gehen. Plötzlich drehte er sich um, gab mir zu meiner Überraschung einige der soeben erhaltenen Geldscheine und sagte: ‚Übrigens, Taylor, Sie können ebenso gut diese Scheine nehmen. Ich habe kein Kleingeld; den Rest kann ich Ihnen nächste Woche geben.‘
Wieder war ich allein. Meine Gefühle waren unbemerkt geblieben. Ich kehrte in mein Kämmerchen zurück und lobte Gott mit frohem Herzen. Nun hatte ich die Bestätigung, dass ich nach China gehen durfte. Für mich war dieser Vorfall etwas Gewaltiges. Die Erinnerung daran gab mir später in besonders schwierigen Lagen – in China oder sonst wo – viel Trost und Kraft.“
In jenen Tagen beschäftigte Hudson Taylor etwas viel Wichtigeres in der Arbeit für den Herrn als die Geldfrage. In denkwürdigen Stunden begann er die Dinge wie nie zuvor vom göttlichen Standpunkt aus zu sehen. Es ging jetzt um Seelen. Er schrieb darüber an Amalie:
„Wenn ich noch zwei weitere Jahre hier verweile und etwas Geld für meine Ausstattung ersparen kann, nützt mir das mehr, als wenn ich jetzt ausreise und mir die Überfahrt unterwegs verdiene. Im Verlauf von zwei Jahren aber sterben in jenem Land wenigstens vierundzwanzig Millionen Menschen. Nach sechs oder acht Monaten müsste ich so viel Chinesisch gelernt haben, dass ich mich verständlich machen kann. Wenn ich aber nur einen einzigen Sünder in den Wahrheiten des Evangeliums unterrichtete, der Heilige Geist das Wort an seiner Seele mit Kraft bewiese und er errettet würde, wäre er in Ewigkeit glücklich und würde seinen Erlöser preisen. Was bedeuteten dann im Vergleich dazu die Schwierigkeiten einer vier bis fünf Monate dauernden Reise?“
Seiner Mutter berichtete er über Erkundigungen über die Möglichkeiten einer Überfahrt als Matrose. Der Gatte seiner Zimmervermieterin hatte ihn allerdings vor den Härten einer langen Meerreise gewarnt und ihm versichert, dass er weder die schwere Arbeit noch das Zusammenleben mit der Schiffsmannschaft ertragen würde. Davon schrieb er jedoch der Mutter nichts.
„Ich bin tief dankbar“, antwortete er ihr auf ihren letzten Brief, „dass Du das Opfer bringst, mich ziehen zu lassen, und diesen Entschluss nie zurücknehmen wirst. Vielleicht will der Herr unsere Aufrichtigkeit in diesem Punkt früher auf die Probe stellen, als wir meinen. Wenn ich auch die Größe der Mutterliebe nicht kenne, so empfinde ich doch die Macht der Sohnesliebe, Bruderliebe, Freundesliebe und die Liebe zu Brüdern in Christus. Das Aufgeben von allem, was mir lieb ist, schmerzt wie das Wegreißen eines Teils meiner selbst. Doch ich danke Gott dafür, dass ich auch etwas von des Erlösers Liebe weiß, wenn auch bis jetzt nur wenig. Er ist mein Friede, und ich kann mit dem Dichter sagen:
Allem entsag’ ich auf Erden,
der Weisheit, der Macht und Ehr’,
um Dich zum Teil zu haben,
mein Schild und auch meine Wehr.“
Obgleich Hudson Taylor das Opfer, als Matrose auszureisen, freudig bringen wollte, sollte er diese Möglichkeit doch nicht wählen.
Seine Mutter schrieb später in dankbarer Erinnerung an diese Führung als Antwort auf ihre Gebete: „Er musste das doch nicht auf sich nehmen. Ohne Zweifel war es recht, dass er innerlich bereit war, alles zu verlassen und seinem Meister zu folgen, wohin Er ihn wies.“
Sollte sein Weg aber schon jetzt nach China führen? Seine Eltern und Freunde waren dazu noch nicht bereit. Er selbst hatte gebetet, er wolle nicht länger in der Heimat verweilen, wenn es nicht Gottes Wille sei und seine Nächsten diesen Weg als den von Gott für ihn bestimmten erkennen würden. Zu seinem Erstaunen rieten alle von diesem Plan ab.
Es fiel ihm schwer, alle seine sorgfältig erwogenen Pläne aufzugeben. Er musste dabei erkennen, dass Eigenwille aussehen kann wie Hingabe. Darüber schrieb er an seine Mutter: „Im Blick auf meine Ausreise nach China habe ich vor, in Übereinstimmung mit allen, die ich befragte, und mit deiner eigenen Ansicht, ein weiteres Jahr in der Heimat zu verbringen und dabei auf Gottes Führung zu warten. Deine Beurteilung freute mich, weil ich Gott gebeten hatte, uns allen dieselbe Überzeugung zu schenken. Will Er von mir, dass ich früher gehen soll, dann kann Er mir den Weg unmissverständlich zeigen.“
Im Mai verbrachte er eine glückliche Woche daheim im Familienkreis, wo er sich erholte. Allerdings empfand er nach seiner Rückkehr die Trübseligkeit seines armseligen Quartiers umso stärker. Aber er freute sich an seinem Herrn und, obgleich er sich zuerst, wie er seiner Schwester anvertraute, beinahe nicht mehr in die Verhältnisse hineinfinden konnte, machte er sich wieder eifrig an die Arbeit.
Als die Tage länger wurden, nahm er sich auch des Streifens ungepflegten Landes vor der Behausung seiner Zimmervermieterin an. Den Sommer verbrachte er mit körperlicher Arbeit, Planen, Beten und fleißigem Studium der Schrift. Die Zeit schien eher zu kurz für all die vielen Pflichten, die sich ständig häuften. Er erfuhr dabei, wie viel mehr an einem Tag geleistet werden kann, wenn wenigstens eine Stunde für das Gebet verwendet wird.
Er selbst bedurfte jetzt der besonderen Weisung und Leitung von oben. Sein Freund und Vorgesetzter, Dr. Hardy, machte ihm großmütige Vorschläge in Bezug auf seine medizinische Ausbildung. Er wäre bereit gewesen, mit ihm einen Vertrag für mehrere Jahre abzuschließen, der ihm unentgeltlich ein medizinisches Studium ermöglicht hätte. So gern er dieses abgeschlossen hätte, glaubte er doch, dass er sich nicht durch einen Vertrag binden dürfte, weil er doch nicht wusste, wann sich sein Weg nach China öffnen würde. Er war nun zwanzigjährig und musste zusehen, wie er die Zeit, die ihm noch in England verblieb, am besten für seine Vorbereitung auskaufte.
Ausgerechnet in diesen Tagen stand er plötzlich vor einer neuen, schweren Glaubensprobe. Sein Vater fühlte sich seit einiger Zeit in seinem Apothekerladen eingeengt. Er streckte sich nach einem größeren Tätigkeitsfeld aus und meinte, die neue Welt, Kanada oder die Vereinigten Staaten, könnten vielleicht Möglichkeiten zur Erweiterung seines Geschäfts in einer geistlich bedürftigeren Umgebung bieten. Die Mutter bekam denn auch den Auftrag, Hudson zu fragen, ob er bereit sei, das heimatliche Geschäft auf die Dauer von zwei Jahren zu übernehmen.
Überrascht und bestürzt über diese unerwartete Zumutung war er wenig geneigt, darauf einzugehen. Wohl hätte er gern seines Vaters Wunsch erfüllt. Doch dessen Geschäftsreise nach Amerika – selbst wenn sie mit einer evangelistischen Tätigkeit verbunden würde – nein, das konnte nicht Gottes Wille sein! Was er in seinem Antwortschreiben an die Eltern berichtete, ist nicht bekannt. Doch gibt ein zweiter Brief, der dem ersten sogleich gefolgt sein musste, Einblick in sein Denken.
„Das Gewissen hat mich seit meiner Antwort auf Deine Frage bezüglich meiner Bereitschaft, Dich zwei Jahre zu vertreten, oft gedrückt. Ich führte zwar die Opfer auf, die für mich mit einem Heimkommen verbunden wären, erwähnte jedoch kein Wort über alle jene, die Du so willig für mich gebracht hast – alle die schlaflosen Stunden, die Sorgen, die Mittel für die Ausbildung und für alles Schöne, woran ich mich erfreuen durfte. Und dies ist nun mein Dank für alle Deine Freundlichkeiten! Ich habe nur meine Opfer aufgezählt, die ich zu bringen hätte, wenn ich das Geschäft übernähme, in dem Du zu meinen Gunsten zwanzig Jahre gearbeitet hast. Vater, ich war ein undankbarer Sohn – es tut mir aufrichtig leid. Kannst Du mir vergeben? Ich will mich ernstlich bemühen, mit Gottes Hilfe in Zukunft anders zu handeln und meinen Pflichten getreuer nachzukommen. Solltest Du meine Heimkehr noch immer wünschen, so bin ich dazu bereit.“
Dieses Opfer wurde ihm aber erspart. Sein Vater gab den Gedanken an Amerika auf und war bald wieder wie zuvor mit seinem arbeitsreichen Leben in Barnsley zufrieden. Hudson konnte sich wieder seinen eigenen Plänen hingeben. Vor allem erwog er jetzt die Frage einer Übersiedlung nach London.
Diese Stadt zog ihn an, denn für sein Medizinstudium besaß sie viele Vorzüge. Er hatte das Angebot von Mr Pearse und der Chinesischen Evangelisationsgesellschaft nicht vergessen. Sie hatten sich zur Bezahlung aller Auslagen in London bereit erklärt, wenn er eine Anstellung fände, die ihm genügend Zeit zum Lernen ließe. Auch auf andere Weise wären sie für Unterhalt und Unterkunft aufgekommen. Nun fragte er sich, ob dieses Angebot auch heute noch Gültigkeit besäße, und wie er dann davon Gebrauch machen könnte.
Nachdem er viel über diese Fragen nachgedacht und darüber gebetet hatte, erkannte er, dass er nicht länger in Hull bleiben sollte. Alles, was er unter den gegenwärtigen Umständen von Dr. Hardy lernen konnte, hatte er sich angeeignet. Ein längeres Verweilen, soweit es seine Vorbereitung für China betraf, hätte er als Zeitverlust erachten müssen. Doch was sollte er unternehmen, wie sah der erste Schritt aus?
Je klarer er erkannte, was Gott von ihm wollte, umso höher schienen sich die Schwierigkeiten zur Ausführung des Plans vor ihm aufzutürmen. Vorerst musste er Dr. Hardy in seine Pläne einweihen und sich nach einer Anstellung in London umsehen, was sich als äußerst schwierig erwies, weil er ohne Mittel war, auf die er sich verlassen konnte. Zwar besaß er eine kleine Summe, die er für seine Ausrüstung für China beiseitegelegt hatte. Er hätte allen Grund zur Mutlosigkeit gehabt. Es stand ihm dort kein Heim offen, das ihn aufgenommen hätte. Doch in jenen Juli- und Augusttagen erfreuten ihn einige Verheißungen aus Gottes Wort ganz besonders. Sie stehen im 37. Psalm: „Hoffe auf den Herrn … tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich! Habe deine Lust an dem Herrn; der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihn; Er wird’s wohlmachen.“
Während er über diese eindeutig klaren Zusicherungen nachsann, begann er alles in dem Licht zu sehen, das von dem Ungesehenen ausgeht. Musste er handeln ohne eine klare Zusage? Fand er seinen Meister auch wirklich auf dem vor ihm liegenden Meer? War es wirklich Seine Stimme, die ihn über das Wasser erreichte? Wenn Er es war, dann konnte er sein kleines Boot ohne Zögern verlassen und Jesus entgegengehen. Des Jüngers Worte lauteten: „Bist Du es, Herr, dann heiße mich zu Dir kommen!“ Und die Antwort kam unmissverständlich. Er konnte sie nicht anzweifeln. In einem Brief an seine Mutter schrieb er am 27. August:
„Ich begann mich auf einmal zu wundern, warum mir denn so viel an London gelegen sei. Ich kann aufrichtig sagen, es geht mir darum, dem Herrn besser zu dienen und Ihm zur Förderung Seines Königreichs nützlicher zu sein. Dieser Schritt ist bestimmt eine wichtige Vorbereitung für China. Warum gehe ich eigentlich nicht? Aus dem einfachen Grunde, weil ich nicht weiß, wie ich es anstellen soll. Hätte mein irdischer Vater mir fünf oder zehn Pfund angeboten, dann hätte ich ohne Zögern die Stelle hier aufgegeben. Wie viel williger sollte ich vorwärtsgehen im Vertrauen auf den, der verheißt: ‚Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden? … Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen alles bedürfet … Vertraue dem Herrn und tue Gutes, so wirst du sicher wohnen im Lande.‘
Wenn ich weiterhin mein Vertrauen auf Umstände setze, schiene mir das ein Zweifel an Gott. Deshalb sprach ich am vergangenen Samstag mit Dr. Hardy und erklärte ihm, dass ich allein im Vertrauen auf den Herrn nach London umsiedeln wollte, ob ich nun eine Anstellung hätte oder nicht. Heute vernahm ich, dass eine Stelle frei geworden ist. Ich werde mich dort melden, obgleich ich kaum annehmen kann, dass sie für mich passend ist. Das Spital scheint mir zu entlegen zu sein. Verdienen kann ich dort bestimmt nichts. Wenn ich eine Anstellung finde, die es mir ermöglicht, sechs bis acht Stunden Vorlesungen zu besuchen, dann ist das alles, was ich erwarten darf.“
Nachdem dieser Entschluss gefasst war, fürchtete er sich nicht mehr davor, die Brücken hinter sich abzubrechen. Er schrieb sogleich an seinen Vetter in Barnsley und schlug ihm vor, sich um die frei werdende Stelle bei Dr. Hardy zu bewerben.
Kurz danach klärte sich sein Weg. Ein Onkel, der in London lebte, bot ihm ein vorläufiges Heim an. Die Chinesische Evangelisationsgesellschaft (CEG) erneuerte ihr Angebot zur Deckung seiner Auslagen im Krankenhaus, und die gläubigen Freunde, zu denen er sich in Hull gehalten hatte, rüsteten ihn aus mit Empfehlungen an einige Gläubige, die er vom Krankenhaus aus mit Leichtigkeit erreichen konnte. Er bekam noch weitere Hilfsangebote, die ihm bewiesen, dass er auf dem rechten Wege war, obgleich er sie nicht annahm. Voll Dankbarkeit schrieb er Mitte September an seine Schwester:
„Wie ist doch Gottes Liebe, die Güte meines und Deines Vaters, meines und Deines Gottes so groß! Wie freundlich ist Er, mir solch vollkommenen Frieden, solch vollkommene Freude und vollkommenes Glück zu schenken, obgleich ich mich nach außen hin in der schwierigsten Lage befinde! Hätte ich mich in der Frage, ob ich bleiben oder gehen sollte, durch Umstände leiten lassen, wie unsicher wäre ich geblieben! Doch als ich diesen Schritt unter Seiner Führung wagte, weil Er dadurch geehrt werden sollte, und alles in Seine Hände legte, schenkte Er mir Ruhe.
Preise den Herrn für Seine Güte! Er hat bis jetzt für das Notwendige gesorgt. Mir wurde ein Heim angeboten und ich besitze genügend Geld zum Bezahlen des Honorars in der Ohrenklinik und für die Kurse in London. Ich kenne hier auch gläubige Freunde. Im vergangenen Herbst wusste ich von allem noch nichts. Ich habe gerechnet und mich gesorgt, und all dies umsonst. Auch wenn uns alles verkehrt zu sein scheint, beseitigt der Herr, wenn Er den Weg auftut, eine Schwierigkeit nach der andern und sagt ganz einfach: ‚Sei stille und erkenne, dass Ich der Herr bin!‘“