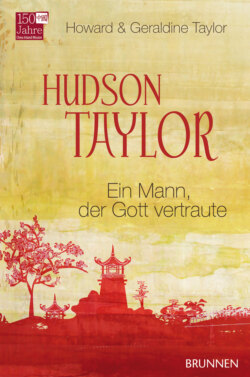Читать книгу Hudson Taylor - Howard Taylor - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dem Herrn geweiht
ОглавлениеEs war wie ein Heimkehren, als Benjamin Hudson, Prediger der Methodistenkirche, nach Barnsley versetzt wurde. Nicht weit davon entfernt, am Rande der weiten Heide, lag sein Heimatort, in dem Amalie, seine Frau, ihre Jugend verbracht hatte. Dieses Yorkshiretal mit seinen vielen Hügeln und der sich meilenweit hinziehenden Bergkette trug vielleicht etwas zur künstlerischen Veranlagung und tapferen Gesinnung ihrer Kinder bei.
Benjamin Hudson war zwar kein besonders guter Redner, dafür aber ein treuer, hingegebener Diener am Evangelium und ein wirklicher Künstler. Sein Talent als Porträtmaler übertrug sich auf mindestens drei seiner Kinder. Sein auffallendster Charakterzug war ein unwiderstehlicher Drang zum Humor. Dieser bereitete ihm nicht selten Schwierigkeiten. Als er einmal während einer Konferenz der Wesleyaner wegen seiner Unfähigkeit, diesen Hang zu meistern, getadelt wurde, entschuldigte er sich so geistreich, dass die ganze Versammlung in Lachen ausbrach. Doch in Barnsley, ja, da fühlte er sich verstanden. Die Yorkshireleute schätzten seine humorvollen Reden und gezielten Ermahnungen. Auch diese Veranlagung, sein trockener Humor, übertrug sich auf seine Nachkommen.
Keiner verstand ihn aber in Barnsley besser als der Schilfrohrflechter John Taylor, dessen einfaches, doch solides Steinhaus gegenüber dem Predigerhaus stand. Die älteste Tochter des Predigers, Amalie, hatte eine schöne Stimme. Deshalb nannte John Taylor sie Nachtigall. Sein Sohn, James Taylor, Apothekerlehrling in einem Nachbardorf, besuchte seine Eltern häufiger, seitdem er die hübsche Sängerin kannte. Die beiden jungen Leute verliebten sich und heirateten endlich nach einer siebenjährigen Verlobungszeit im April 1831.
Zu der Zeit besaß James Taylor bereits seine eigene Apotheke am Marktplatz. Dort schaltete und waltete nun Amalie. Ihre Gaben und Fähigkeiten konnten hier nicht verborgen bleiben. Sie brachte Frohmut und Interesse an der Arbeit ihres Mannes mit in ihre Ehe und unterrichtete in der Sonntagsschule. Die vierzig bis fünfzig Buben und auch die Mädchen fühlten ihre Anteilnahme und Gebete. Eine besondere Freude brachte eine Erweckung in der Gemeinde. Dabei kamen viele ihrer Sonntagsschüler zum Glauben an Jesus Christus.
Bei seinen Predigtvorbereitungen fand James Taylor in seiner Frau eine unerwartete Hilfe. War sein Herz voll, die Feder aber unfähig und zu langsam zum Festhalten seiner Gedanken, ging er im Hinterzimmer seines Ladens auf und ab, während Amalie kurze Notizen machte und später zu Predigten ausarbeitete, was er vor ihr ausgebreitet hatte. James Taylor legte großen Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung seiner biblischen Botschaften. Aber er war auch ein gewissenhafter und tüchtiger Apotheker und als Geschäftsmann hoch geachtet. Er nahm die Geldangelegenheiten so genau, dass er es sich zur Gewohnheit machte, jede Schuld sofort zu begleichen.
„Wenn ich sie eine Woche stehen lasse“, pflegte er zu sagen, „schädige ich meinen Gläubiger, auch wenn es sich nur um einen geringen Betrag handelt.“
Überzeugt von der unbedingten Treue Gottes, glaubte er einfach Seinem Wort. Für ihn war die Bibel das praktischste Buch der Bücher. So sprach er im ersten Winter ihrer Ehe eines Tages mit seiner Frau über eine Bibelstelle, die ihn besonders beeindruckte. Es handelte sich um einen Teil des dreizehnten Kapitels aus dem 2. Buch Mose und um einige ähnliche Verse aus dem 4. Buch Mose. Da stand geschrieben: „Heilige mir alle Erstgeburt!“ – „Die Erstgeburt ist mein.“ – „Alle Erstgeburt sollst du dem Herrn weihen.“
Lang und ernst war das Gespräch, das sie im Ausblick auf das bevorstehende Glück zusammen führten. Um so genau wie möglich einem Gebot nachzukommen, das sie nicht einfach auf hebräische Eltern einer vergangenen Zeit beziehen konnten, knieten sie zusammen nieder, und der Herr antwortete auf dieselbe klare Weise. Er schenkte ihnen die Gewissheit, dass Er ihre Gabe angenommen habe. Sie wussten, dass das ihnen anvertraute Leben hinfort einem höheren Anspruch, einer tieferen Liebe ausgeliefert bleiben müsste. Diesen Tag konnte die junge Frau nicht wieder vergessen.
Der Frühling zog ins Land und berührte mit seinem zarten Hauch die Hügel und Täler des Yorkshirelandes. Am 21. Mai 1832 wurde dann dieses Kind vieler Gebete – James Hudson Taylor – geboren. In seinem Namen sollten die Namen beider Eltern vereinigt sein.
Es blieb nicht bei diesem einen Kind. Eins der großen Vorrechte ihrer Kindheit war das Leben unter der ständigen Obhut der Mutter. Dies war ein reichlicher Ausgleich für die bescheidenen Mittel, die ihnen zur Verfügung standen. Für die Mutter gab es viel zu nähen, doch konnte sie daneben ihre Leseübungen abhören und sie Diktate schreiben lassen. Viele Stunden wurden auf diese Weise über Geschichte, Literatur und Reisebeschreibungen zugebracht. Sie vermittelte ihnen schon früh die Freude am Lesen. Ihrer Genauigkeit und Gründlichkeit wird wohl die ungewöhnliche Aufmerksamkeit im Kleinen zu verdanken sein, die ihren Sohn in späteren Jahren kennzeichnete.
Ebenso praktisch brachte sie ihren Kindern Sorgfalt in allem bei, was sie selbst betraf. Auf ihrem Waschtisch lag stets Nähzeug bereit, damit Zerrissenes sogleich wieder instandgesetzt werden konnte. Dass Sauberkeit und Ordentlichkeit trotz einfacher Kleidung eine Notwendigkeit sei, prägte sich den Kindern durch das Vorbild der Mutter früh ein.
Das kleine, hinter dem Laden liegende Wohnzimmer, in dem gegessen, gelernt, genäht und gespielt wurde, war ein Bild der Gemütlichkeit und Ordnungsliebe. Mit dem kleinen Fenster, das vom Marktplatz her interessante Eindrücke vermittelte, dem mit glänzendem Geschirr und Glas gefüllten Büffet, seinem langen, altmodischen Ruhebett und dem geräumigen Bücherregal bildete das Familienzimmer einen behaglichen Ort.
Die sanfte Strenge der Mutter trug viel zu Hudsons glücklicher Kindheit bei. Als einmal Gäste zum Mittagessen eingeladen waren, übersah sie die Bedürfnisse ihres kleinen Sohnes. Während die andern aßen, saß er schweigend am Tisch, weil beim Essen nicht gebettelt werden durfte. Endlich bat eine leise Stimme um Salz. Das war auf alle Fälle erlaubt.
„Warum möchtest du denn Salz haben?“, fragte sein Tischnachbar, der Hudsons leeren Teller bemerkte.
„Oh, ich möchte nur bereit sein, wenn mir meine Mama etwas zu essen gibt.“
Ein anderes Mal lenkte er die Aufmerksamkeit für seine Bedürfnisse durch eine Frage auf sich, als das Gespräch einen Augenblick verstummte.
„Mama, denkst du, Apfelkuchen ist etwas Gutes für kleine Buben?“
Die Kinder lebten mit ihrem Vater beinahe so vertraut wie mit der Mutter. Dieser fühlte sich nicht weniger verantwortlich für ihre Erziehung. Obgleich streng und oft aufbrausend, kann der Einfluss James Taylors im Leben seines Sohnes kaum hoch genug bewertet werden. Er war bestimmt ein häufig unerbittlicher Erzieher. Doch wer könnte sagen, ob Hudson je der Mann und Leiter eines großen Werkes geworden wäre ohne ein solches Element in seiner frühesten Jugend? James Taylor genügte die Tatsache nicht, dass seine Kinder verhältnismäßig gut geartet waren. Er selbst besaß ein äußerst starkes Pflichtbewusstsein. Es musste immer das zuerst getan werden, was zuerst getan sein musste. Freiheit, Vergnügen und Weiterbildung durften nur den verbleibenden Raum einnehmen. Er war ein Mann des Glaubens, doch ging sein Glaube Hand in Hand mit praktischer Arbeit. Von seinen Kindern verlangte er gründliches Erfüllen ihrer Pflichten, damit sie sich Gewohnheiten aneigneten, durch die sie zu zuverlässigen Männern und Frauen geformt würden.
Die Bedeutung der Pünktlichkeit zum Beispiel brachte er seinen Kindern durch Vorbild und Belehrung bei. Niemand durfte verspätet zu den Mahlzeiten oder andern Familienzusammenkünften erscheinen.
„Sind fünf Leute beisammen und man lässt sie eine Minute zu lange warten, dann gehen fünf Minuten verloren, die nie mehr eingeholt werden können“, belehrte er sie.
Saumseligkeit beim An- und Auskleiden, oder wenn eine Arbeit getan werden sollte, tadelte er ebenfalls als Zeitverlust. „Lerne es, dich rasch anzukleiden, denn du musst es wenigstens einmal jeden Tag deines Lebens tun. Beginne auch deine Arbeit sogleich, wenn sie dir aufgetragen wird! Zaudern hilft nicht und macht die Pflichten nur mühsamer.“
Ein anderer seiner Grundsätze lautete: „Siehe zu, dass du ohne dieses oder jenes auskommst!“ Das bezog sich vor allem auf die bescheidenen Tischfreuden. Er kannte den lebenslangen Einfluss kleiner Gewohnheiten und fühlte sich verpflichtet, seinen Kindern die Kraft zur Selbstbeherrschung zu sichern.
„Manchmal werdet ihr zu euch selbst Nein sagen müssen, wenn wir einmal nicht mehr bei euch sein und euch helfen können. Das wird euch sehr schwerfallen, wenn es euch nach irgendetwas gelüstet. Darum lasst uns die Tugend der Selbstdisziplin heute üben, denn je früher ihr beginnt, desto stärker wird die Gewohnheit sein“, erklärte er ihnen.
Nach dem Frühstück und der Teezeit hielt er regelmäßig eine Familienandacht. Dabei durfte keins der Kinder fehlen. Die gelesene Schriftstelle wurde vom Vater in einer solch praktischen Art erklärt, dass auch die Kinder die Anwendung erfassten. Er war sehr darauf bedacht, ihnen das ganze Wort Gottes zu geben. Nichts durfte übergangen werden. Das Alte Testament wurde ebenso durchgelesen wie das Neue. Nach der Bibellese trug er das Datum regelmäßig in die Familienbibel ein.
Es wurde den Kindern gesagt, dass die Pflege ihrer Seele durch Gebet und Bibelstudium ebenso wichtig sei wie Bewegung und Essen für das leibliche Leben. Dies zu unterlassen, meinte er, bedeute eine Vernachlässigung des Allerwichtigsten. Er sprach oft darüber als von einer Sache, die nicht übersehen werden dürfe, und sorgte dafür, dass seine Angehörigen täglich wenigstens eine halbe Stunde mit Gott allein sein konnten. Bald entdeckten auch die Kleinsten das Geheimnis eines glücklich verbrachten Tages.
James Taylor war ein geselliger Mann und sprach sich gern unter Gleichgesinnten frei aus. Die Vierteljahrssitzungen der kirchlichen Gemeindevorsteher, zu denen sie sich regelmäßig aus allen Teilen seines Umkreises in Barnsley trafen, bereicherte er oft durch eine Einladung an alle Teilnehmer zu einer Teepause in seinem Heim. Dabei wurden meistens Themen der Missionsarbeit in fernen Ländern berührt. Die Kinder liebten die Geschichten fremder Völker. China nahm den ersten Platz in ihres Vaters Interesse ein. Er beklagte nicht selten die Gleichgültigkeit der heimatlichen Kirche gegenüber der erschreckenden Not jenes Landes. Es beunruhigte ihn, dass die Methodistengemeinden nichts zur Evangelisation Chinas beitrugen.
„Warum nur senden wir keine Missionare dorthin?“, rief er zuweilen aus. „Dies ist das Land, das eingenommen werden sollte – China mit seiner dichten Bevölkerung, seinen starken, intelligenten und gebildeten Menschen.“
Schon ganz früh entschloss sich Hudson, einmal als Missionar nach China auszuziehen. Sein Interesse an diesem Land wurde noch durch eine kleine Schrift „China“ vertieft. Er las sie so oft, bis er sie beinahe auswendig konnte. Jede Hoffnung jedoch, die seine Eltern gehegt haben mochten, dass er je zu einem solchen Dienst berufen sein könnte, hätten sie wegen seiner zarten Gesundheit begraben müssen.
Erst als Elfjährigen hatten sie ihn in die Schule schicken können, und bereits nach zwei Jahren musste er sie wieder verlassen. Obgleich er den Unterricht liebte, war es keine glückliche Zeit gewesen. Es verging keine Woche, in der er nicht einen oder zwei Tage daheim zubringen musste. Er machte sich auch zu wenig aus Bubenspielen, um allgemein beliebt zu sein. Darum freute er sich über den Entschluss der Eltern, ihn zu Hause weiterlernen zu lassen. Nebenher durfte er seinem Vater im Apothekerladen helfen. So vergingen seine Kindheitsjahre, und ganz unbemerkt näherte sich Hudson Taylor der Krise seines Lebens.
Mit siebzehn Jahren war er ein hübscher Junge. Nach außen hin schien er unbeschwert und sorglos zu sein. Doch innerlich war er voll Auflehnung und Zweifel. Er hatte einige Monate in einer Bank in Barnsley gearbeitet, wo die meisten seiner neuen Bekannten ihm selbst unbekannte Ansichten vertraten. Es war nicht selten zu heftigen Diskussionen gekommen. Religion war eins ihrer Themen. Darüber wurde viel geschimpft. Einer zeichnete sich als besonders kritisch aus. Er war ein älterer, gut aussehender, allgemein beliebter Bursche, der bei jeder Gelegenheit Hudsons „altväterliche“ Ansichten belächelte und sich sehr bemühte, ihn davon abzubringen. Hudson begann denn auch, sich nach Vergnügungen und Abwechslung, nach Geld und einem Pferd zu sehnen, um wie die andern seine Freizeit auszufüllen. Er war es müde, ständig die äußeren Formen christlichen Lebens wahren zu müssen, nachdem er sich lange bemüht hatte, daran festzuhalten. Als dann Überstunden bei trübem Gaslicht eine ernste Entzündung seiner Augen verursachten, musste er seine Stelle aufgeben und in den Apothekerladen seines Vaters zurückkehren. Seine innere Zerrissenheit vertiefte sich nun noch mehr.
Sein Zustand wirkte sich natürlich ungünstig auf den Frieden und das Glück seiner Familie aus und beschattete sein ursprünglich sonniges Wesen. Die Eltern erkannten seinen Zustand wohl. Der Vater versuchte ihm zu helfen, fand es jedoch schwer, geduldig zu bleiben und ihn immer zu verstehen. Die Mutter verdoppelte ihre Zartheit ihm gegenüber. Doch am besten verstand ihn seine erst dreizehnjährige Schwester Amalie. Ihr schenkte er sein Vertrauen.
Seine Gleichgültigkeit und innere Zerrissenheit gingen ihr so nahe, dass sie sich vornahm, täglich dreimal für ihren Bruder zu beten, bis er durch eine klare Bekehrung Frieden mit Gott fände. Einzig ihrem Tagebuch vertraute sie an, sie wolle nicht eher mit Beten aufhören, bis Hudson zum Licht durchgedrungen sei, und sie rechne bestimmt mit der Erhörung ihrer Gebete.
Gehalten durch den Glauben und die Gebete seiner Angehörigen, nahte endlich der unvergessliche Tag. Jahre später schrieb er darüber:
„Meine Mutter weilte irgendwo in den Ferien. Am Nachmittag eines freien Tages suchte ich in Vaters Bibliothek nach einem Buch, doch fand ich keins, das mich interessierte. Dann durchstöberte ich einen mit Traktaten und Broschüren gefüllten Korb. Ich fand eine Schrift, die interessant aussah, und sagte zu mir selbst: Wahrscheinlich steht zuerst eine Geschichte darin, und dann folgt eine Evangelisationsbotschaft oder Moralpredigt. Ich werde die Geschichte einmal lesen und den Rest denen überlassen, die daran Freude haben.
Ich machte es mir gemütlich und begann beinahe gleichgültig zu lesen. Dabei nahm ich mir vor, die Schrift bestimmt beiseite zu legen, wenn etwas über die Erlösung darin stehen sollte.
Wie konnte ich wissen, was in jener Stunde im Herzen meiner Mutter vorging, die etwa 120 Kilometer entfernt ihre Ferien verbrachte! Sie hatte den Mittagstisch mit einem tiefen Verlangen nach der Bekehrung ihres Sohnes verlassen, und weil ihr viel freie Zeit blieb, wollte sie diese im Gebet für mich zubringen. So zog sie sich denn auf ihr Zimmer zurück, schloss die Tür ab und war fest entschlossen, den Raum nicht eher zu verlassen, als bis ihre Gebete erhört worden seien. Stunde um Stunde brachte die gute Mutter im Gebet zu, bis sie sich gedrungen fühlte, Gott für Seine Erhörung zu danken.
Während ich selbst das Traktat las, fielen mir die Worte ‚Das vollendete Werk Christi‘ auf.
Ich fragte mich: Warum gebraucht der Schreiber wohl den Ausdruck ‚vollendetes Werk Christi‘? Warum heißt es nicht Wiedergutmachungs- oder Versöhnungswerk? Dabei dachte ich an die Worte Jesu: ‚Es ist vollbracht!‘ Was aber bedeutet ‚vollbracht‘? Die Antwort gab ich mir selbst. Es musste sich um ‚eine ganze und vollkommene Erlösung und Sühne für die Sünde‘ handeln. Sagt doch die Heilige Schrift: Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.‘
Dann dachte ich weiter: Wenn das ganze Werk vollbracht ist, was bleibt mir dann noch zu tun übrig?
Damit dämmerte in mir durch den Heiligen Geist die frohe Überzeugung wie ein Licht auf, dass ich in dieser Welt nichts anderes zu tun hätte, als auf die Knie zu fallen und diesen Erlöser und Seine Erlösung dankbar anzunehmen. Damit würde ich Ihn auf ewig preisen.
Während meine Mutter in der Ferne in ihrem Zimmer Gott lobte, dankte ich Ihm im alten Lagerschuppen, wohin ich mich inzwischen zum Lesen zurückgezogen hatte.
Erst nach einigen Tagen machte ich meine Schwester zur Vertrauten meiner Freude. Dabei nahm ich ihr das Versprechen ab, niemand etwas davon zu verraten. Als meine Mutter nach zwei weiteren Wochen zurückkehrte, begegnete ich ihr als Erster und sagte ihr, ich hätte eine gute Nachricht für sie. Noch meine ich, die Arme meiner lieben Mutter um meinen Nacken zu fühlen, als sie antwortete: ‚Ich weiß, mein Junge.‘
‚Wie, hat Amalie ihr Versprechen nicht gehalten? Sie sagte doch, sie wolle niemand davon sagen.‘
Da versicherte mir die Mutter, dass sie von keiner menschlichen Quelle das Geschehene vernommen habe. Sie erzählte mir dann von ihrem Erleben und sagte: ‚Du würdest es doch sicher auch eigenartig finden, wenn ich nicht an die Macht des Gebets glaubte.‘
Aber das war nicht alles. Nach einiger Zeit blätterte ich einmal in einem Notizbuch, weil ich meinte, es sei mein eigenes. Die Zeilen, auf die mein Blick fiel, waren jedoch von meiner Schwester geschrieben. Es war ihr kleines Tagebuch, in dem ich von ihrem Versprechen las, Gott so lange bitten zu wollen, bis ihr Bruder bekehrt sei. Nur einige Wochen hatte es gedauert, bis es Gott gefiel, mich aus der Finsternis zum Licht hindurchzubringen.“
Es war vielleicht natürlich, dass Hudson vom Anfang seines Glaubenslebens an den Verheißungen Gottes vertraute und um die Macht des Gebets wusste, nachdem er in einer solchen Familie aufgewachsen und unter solchen Umständen errettet worden war.
Diese entschiedene Annahme des Erlösungswerkes Christi geschah im Juni 1849. Von jetzt an freute er sich über die Gewissheit der Annahme bei Gott, und zwar nicht aufgrund eigener Leistungen, sondern allein durch das Werk und die Person Christi. „Nicht ich, sondern Christus.“ Dieses Wissen brachte Freiheit, Frieden und Ruhe. Das war der Wendepunkt, der Anfang eines neuen Lebensabschnitts, der für ihn – ohne dass er sich dessen bewusst war – China bedeutete.
Nun zeigte sich auch der unschätzbare Wert von Strenge und Gewöhnung in einem christlichen Haus. Er machte rasche Fortschritte, denn die Bibel war ihm kein fremdes Buch, sondern vertrautes Gebiet, ein Land der Verheißung, das nur eingenommen werden musste. Das Gebet bedeutete keine ungewohnte Anstrengung. Ihm war es natürlicher Ausdruck eines Herzens, das gewohnt war, sich in allem an Gott zu wenden. Es gab viel zu lernen in diesem neuen Leben, doch erfreulicherweise wenig hässliche Gewohnheiten oder Erinnerungen auszulöschen. Der Heilige Geist hatte verhältnismäßig freien Raum in seinem Herzen. Und vor dem Siebzehnjährigen lag ein ganzes Leben, über das sein Herr verfügen sollte.
Als Ausdruck seiner Dankbarkeit wollte er eine Arbeit für Gott tun, einen Dienst, der vielleicht sogar mit Leiden verbunden wäre. Mit diesem Verlangen im Herzen verbrachte er einen seiner freien Nachmittage auf seinem Zimmer. Er musste mit Gott allein sein. Da begegnete ihm Gott auf besondere Weise.
„Lebhaft erinnere ich mich jener Begebenheit“, schrieb er lange danach, „wie ich in ungeteilter Hingabe mich selbst, mein Leben, meine Freunde, mein alles auf den Altar legte, und wie Gott mir die Zusicherung gab, dass mein Opfer angenommen sei. Die Gegenwart des Herrn wurde unaussprechlich real. Ich weiß noch, dass ich in tiefer Ehrfurcht und Freude vor Ihm auf dem Boden lag. Es erfüllte mich das Bewusstsein, nicht mehr mein Eigen zu sein. Das habe ich seither nie mehr verloren.“
Nun begann er sich als Ergebnis dieser bestimmten Übergabe an Gott um das Wohlergehen anderer Menschen zu kümmern. Vermochte er auch noch nicht zu predigen, so konnte er doch christliche Blätter verteilen und Leute zur Sonntagspredigt einladen. War er an den Werktagen zu sehr beschäftigt, so benutzte er die Sonntage dazu. Statt am Sonntagabend wie bisher zur eigenen Erbauung in der Kirche zu sitzen, suchte er nun mit seiner Schwester die ärmsten Stadtteile auf. Sie gingen von Tür zu Tür und boten allen, die sie haben wollten, ihre Schriften an. Die elendesten Mietshäuser suchten sie auf, obgleich es sie nicht wenig kostete, durch dunkle, enge Zugänge zu den überfüllten Küchen vorzudringen. Doch wurden sie reichlich in dem Wissen belohnt, dass der Meister ihr Tun billige.
Die Freude an seinem Herrn und dem Dienst für Ihn war aber nicht seine einzige Erfahrung jener Spätsommertage. Es gab Zeiten der Gleichgültigkeit und widerstreitender Gefühle und Gedanken. Es schien irgendwie eine Kluft zwischen der errettenden Macht Jesu und den Nöten des täglichen Lebens in Laden und Heim zu bestehen. Das Gute, das er wollte, tat er nicht, und das Böse, das er hasste, siegte nur zu oft. Er bejahte das Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen, doch erkannte er ein anderes Gesetz, das ihn in die Gefangenschaft der Sünde mit all ihren ertötenden Wirkungen brachte. Er hatte noch nicht gelernt, Gott zu danken, dass „das Gesetz des Geistes, das da lebendig macht in Christo Jesu, mich frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes“.
In solchen Zeiten bleiben der betrübten und erschreckten Seele nur zwei Wege offen. Der eine bedeutet, das hohe Ziel fahren zu lassen und stufenweise zu einer niedrigeren Ebene christlichen Lebens hinunterzusteigen, wo es weder Freude noch Kraft gibt. Der andere Weg führt in die Nachfolge Jesu hinein, in der aufgrund Seiner großen und kostbaren Verheißung völlige Befreiung nicht nur von der Schuld, sondern auch von der Herrschaft der Sünde beansprucht werden darf.
Nichts Geringeres als das konnte Hudson Taylor zufriedenstellen. Die Bekehrung hatte er nicht als leichtfertige Verstandesangelegenheit erlebt. Von seinem alten Leben war er für immer durch das Kreuz Christi geschieden worden und damit auch von dem Erfülltsein durch irgendein Glück, das die Welt bietet. Was er nun brauchte, nachdem er durch seine Bekehrung die Wiedergeburt erlebt hatte, war die ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott. Von jetzt an beunruhigten ihn Zeiten der geistlichen Erschlaffung und Gleichgültigkeit. Er sehnte sich nach völliger Befreiung von der Macht der Sünde und täglichem Sieg über sie – nach wirklicher Heiligkeit.
Die innere Zerrissenheit dauerte den ganzen Herbst hindurch an. Dazu kamen noch einige erschwerende äußere Umstände. Der September brachte einen empfindlichen Wechsel im Familienkreis. Amalie zog nach Barton am Humber, um dort ihre Ausbildung zu vervollkommnen. Die Schwester ihrer Mutter, Mrs Hudson, führte dort eine Mädchenschule und nahm auch einige Mädchen in ihren Familienkreis auf. Ihr ältester Sohn John sollte gleichzeitig bei seinem Onkel in Barnsley eine Apothekerlehre machen. Damit beiden Familien große Auslagen erspart blieben, wurde ausgemacht, dass Cousin und Cousine ihre Heimstätten tauschen sollten. Weil John nun mit Hudson das Zimmer teilte, fand dieser weniger Zeit zum Gebet und Bibellesen, dafür aber mehr Grund, sich zu ärgern. Dazu kamen noch Spannungen im Geschäft. Obwohl er die ausgezeichneten Eigenschaften seines Vaters kannte und schätzte, war die Zusammenarbeit mit ihm nicht immer leicht. Alle diese Schwierigkeiten führten in den ersten Dezembertagen zu einer Krise.
Nach außen hin blieb alles unverändert, doch innerlich war er der Verzweiflung nahe. Er war sich einer schrecklichen Leere bewusst. Das Gebet wurde zur Anstrengung und die Bibel besaß für ihn keine Anziehungskraft mehr. Weihnachten stand vor der Tür und in der Apotheke gab es viel Arbeit. So schien keine Zeit für ein stilles Warten vor Gott übrig zu sein, selbst wenn der Wunsch dazu vorhanden gewesen wäre. Doch dies war nicht der Fall. Bisweilen erfasste ihn eine große Angst, dass er aus Gottes Gnade fallen und Gottes Ziel nicht nur in dieser Zeit, sondern vielleicht sogar nach diesem Leben verfehlen könnte.
In jenen Tagen wurde seine Aufmerksamkeit auf einen Artikel in der Novemberausgabe der „Methodisten-Zeitschrift“ gelenkt, der in glühenden Ausdrücken ausgerechnet die Erfahrung schilderte, nach der er suchte. Die Überschrift lautete: „Schönheit der Heiligkeit“. Was darüber geschrieben wurde, weckte in ihm ein tiefes Verlangen nach Sieg über sich selbst. Dann wurde in der Gemeinde, zu der er gehörte, in jenen Tagen eine Evangelisation durchgeführt, die so gesegnet war, dass innerhalb von wenigen Tagen mehr als hundert Menschen Jesus als persönlichen Erretter erkannten und annahmen. Auch ihn selbst erreichte eine besondere Verheißung aus Gottes Wort: „Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinigkeit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Herz geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun“ (Hes. 36,25-27).
Am Sonntag, dem 2. Dezember, verbrachte er den Nachmittag wegen einer Erkältung in seinem Zimmer. Hier war er allein. Obgleich er Gottes Gegenwart deutlich spürte, war sein innerer Zustand noch nicht in Ordnung. Wohl hatte er sich Gott ohne Vorbehalt übergeben und wollte immer und allein Sein Eigentum bleiben. Aber er vermochte nicht in dieser Haltung zu verharren.
„Ich wollte, ich hätte statt dieser leichten Erkältung irgendeine Krankheit, die zum Sterben führte, und ich könnte in den Himmel eingehen, denn ‚ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, was viel besser wäre‘“, schrieb er am Schluss eines langen Briefes an seine Schwester. Und doch zählte er noch nicht zwanzig Jahre.
An jenem Sonntagabend war er tief betrübt. Seine Seele dürstete nach Gott, und es erfüllte ihn das Bewusstsein seiner Schwachheit und Unwürdigkeit. „Nahe dich zu Gott, so naht er sich zu dir“ ist eine Verheißung, die sich an jedem aufrichtigen und demütigen Geist erfüllt. Aber wie oft löst diese geschenkte Schau den Schrei aus: „Wehe mir, ich vergehe; denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen.“
Ganz mit seiner eigenen Not beschäftigt, streckte sich der junge Mann nach echter Heiligkeit aus, einem Leben, in dem nicht das Ich, sondern Christus in allem herrschen sollte. Es war der Herr, der ihn damals für Seine großen Ziele zubereitete; denn es war jetzt die Zeit gekommen, da das Evangelium „den Enden der Erde“ nicht länger vorenthalten bleiben durfte.
Nach Gottes Plan sollte China sich jetzt öffnen, sollten seine äußersten Provinzen bald die Botschaft der Liebe des Erlösers hören. Noch immer lag dieses Land seit alters her mit seinen Millionen – einem Viertel der Menschheit – in Finsternis, lebte und starb ohne Gott. Der Herr erinnerte Hudson an diese Tatsache. Doch er selbst war noch nicht bereit zum Hören des Rufes: „Wen soll ich senden, und wer will mein Bote sein?“ Der Geist Gottes musste tiefer dringen, damit es zum vollen Einklang mit Gottes Gedanken kam. Deshalb führte ihn Gott in ein tieferes Bewusstsein der Sünde und seiner Bedürftigkeit im Ringen nach Befreiung, ohne die Hudson nicht weiterleben wollte noch zu gehen wagte.
War es bloß das, das ihn zurückhielt von einem Leben, nach dem er sich doch ausstreckte? Was war die Ursache seines vielen Versagens und der Lauheit seines Herzens? Gab es etwas in seinem Leben, das nicht völlig dem Herrn ausgeliefert war, einen Ungehorsam vielleicht oder eine Untreue dem geschenkten Licht gegenüber? Er bat Gott immer wieder, ihm das Hindernis doch zu zeigen, was immer es sein mochte, und ihm zu helfen, es zu beseitigen. Er war am Ende mit seiner eigenen Kraft und an einem Punkt angelangt, da Gott allein Befreiung schenken konnte. Er brauchte Seinen Beistand, Seine Erleuchtung, Seine Hilfe. Es ging nun um Leben oder Tod. Wie Jakob in alter Zeit rief er zu Gott: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“
Und dann geschah es – in der Stille vor Gott –, dass sich in ihm ein Entschluss formte. Würde ihm Gott helfen, die Macht der Sünde zu brechen, ihn nach Leib, Seele und Geist für Zeit und Ewigkeit zu erretten, dann war er bereit, auf alle irdischen Aussichten zu verzichten und Ihm sein Leben ganz zur Verfügung zu stellen. Er würde dann überallhin gehen, alles auf sich nehmen, was Gottes Sache von ihm verlangte, und ganz Seinem Willen leben. Nichts sollte ihn zurückhalten, wenn nur Gott ihn befreien und vor dem Fallen bewahren wollte.
Unwillkürlich treten wir vor einem solch heiligen Reden mit Gott beiseite, denn es ist heiliger Boden. Was sich weiter ereignete, wissen wir nicht. Einzig einige Zeilen, die er im darauffolgenden Jahr schrieb, sind Zeugnis davon. Auch später erwähnte er dieses Erlebnis selten, obgleich er es ein ganzes Leben lang auslebte.
„Nie werde ich das Gefühl vergessen können, das damals über mich kam“, schreibt er. „Worte vermögen es nicht zu beschreiben. Ich wusste mich in der Gegenwart Gottes und ging mit dem Allmächtigen einen Bund ein. Es war mir, als ob ich mein Versprechen zurücknehmen wollte, aber ich konnte nicht. Etwas schien zu sagen: ‚Dein Gebet ist erhört, deine Bedingungen sind angenommen.‘ Klar, wie von einer menschlichen Stimme ausgesprochen, lautete der Befehl: ‚Dann gehe für mich nach China!‘ Seither hat mich das Bewusstsein nie mehr verlassen, dass ich nach China berufen und für China bestimmt sei.“
Still wie der Sonnenaufgang über dem weiten Meer dämmerte dieser neue Tag über seiner wartenden Seele auf. China? Ja, China. Das war die Bedeutung seines Lebens, seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Weit außerhalb der kleinen Welt seiner persönlichen Erlebnisse lag die weite, wartende Welt, um die sich niemand kümmerte, für die Jesus Sein Leben hingegeben hatte. „Dann gehe für mich nach China!“ Dein Gebet ist erhört, deine Bedingungen sind angenommen. Alles, was du bittest, und viel mehr dazu soll dir gegeben werden: eine tiefere Erkenntnis Christi, Gemeinschaft Seiner Leiden, Seines Todes, Seiner Auferstehung, ein Leben inneren Sieges und innerer Kraft. Denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch will erscheinen lassen, und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich sende, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt Satans zu Gott.“
„Von jener Stunde an“, schrieb seine Mutter, „war sein Entschluss gefasst. Sein Streben und seine Studien blieben nur auf jenes Ziel gerichtet. Mochten sich ihm auch mancherlei Schwierigkeiten entgegenstellen, er blieb fest in seinem Entschluss.“
Er war erfüllt von einer tiefen Ergebenheit in den Willen Gottes und einem unerschütterlichen Wissen um dessen Bedeutung für sein Leben. Durch die tiefere Reinigung und neue Kraft vermochte er die Prüfungen während seiner Vorbereitungszeit, die sich auf Jahre erstreckte, zu ertragen.
„Getreu ist er, der euch beruft. Er wird’s auch tun.“ So sagt die Heilige Schrift und Hudson erlebte die bewahrende Macht. Es war der eigentliche Anfang seines Wandelns mit Gott als ein dem Herrn Geweihter.