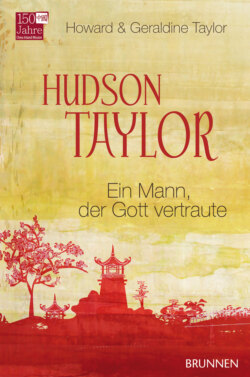Читать книгу Hudson Taylor - Howard Taylor - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Herr wird’s verseh’n
ОглавлениеNebelhörner zeigten von allen Seiten an, dass sich der Küstendampfer zwischen Hull und London langsam die Themse heraufbewegte. Es war am 25. September, einem Sonntagabend, als Hudson Taylor zusammen mit anderen Passagieren an Land gehen wollte. Doch die Nebeldecke verdichtete sich mehr und mehr über der großen Stadt, bis nichts anderes übrig blieb, als den Anker auszuwerfen und auf den kommenden Morgen zu warten. Um die Mittagszeit des nächsten Tages konnte endlich der Tower erreicht werden. Die meisten Leute gingen hier an Land. Alle andern, die auf dem Schiff verblieben, verlebten einen stillen Sonntag. Hudson Taylor war dafür besonders dankbar, lag doch vor ihm ein neuer Lebensabschnitt.
Wie neu und groß sein Bedürfnis nach der Kraft aus dem lebendigen Gott war, konnte niemand ahnen. Weder seine Mutter noch seine Schwester, die seine letzten Tage in Drainside mit ihm zusammen verlebt hatten, wussten etwas über seinen Entschluss, den er vor dem Weggehen gefasste hatte. Damit beschäftigten sich seine Gedanken, während er auf dem Dampfer auf und ab ging. Er berichtete darüber:
„Mein Vater hatte mir angeboten, alle meine Unkosten des Aufenthalts in London zu bezahlen. Ich wusste aber, dass dies nach seinen kürzlichen Verlusten im Geschäft für ihn ein beträchtliches Opfer bedeuten würde. Vor Kurzem wurde ich dem Komitee der CEG vorgestellt, in deren Verbindung ich später nach China ausreisen werde. Diese Männer konnten natürlich nichts vom Vorschlag meines Vaters wissen. Sie erneuerten ihr Angebot zum Tragen aller meiner Auslagen in London. Als diese Vorschläge früher gemacht worden waren, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Meinem Vater und den Sekretären der Mission antwortete ich, dass ich vor einer Entscheidung zuerst darüber beten möchte.
Während ich Gott um klare Führung bat, erkannte ich, dass ich ohne Sorge beide Angebote ablehnen könne. Die Sekretäre konnten nicht wissen, dass ich mich bezüglich meines Unterhalts ganz allein auf Gott verlassen wolle. Der Vater dagegen musste annehmen, ich hätte ihre Hilfe angenommen. So lehnte ich denn auf beiden Seiten ab. Nun brauchte sich niemand um mich zu kümmern. Ich stand jetzt allein in Gottes Hand. Innerlich hatte ich die Gewissheit, dass Er für alles sorgen werde, wenn Er mich wirklich in China gebrauchen wollte. Kennt Er doch mein Herz und mein Bemühen, Ihm schon in der Heimat zu gefallen.“
So stellte er sich am Montagmorgen in Mr Ruffles Pension ein, die sich in der Nähe des Sohoplatzes befand. Hier wohnten sein Onkel Benjamin Hudson und ein Vetter aus Barton-on-Humber, der bei Mr Ruffle, einem Baumeister und Dekorateur, in der Lehre stand. Der Onkel, ein lebhafter, begabter Junggeselle, war nicht nur ein geschickter Porträtmaler, sondern auch ein Poet. Er war sehr beliebt in seinem Bekanntenkreis, denn neben allen andern Gaben war er auch ein gewandter Erzähler mit einem ausgezeichneten Gedächtnis für gute Geschichten. Zu seinen Bekannten gehörten auch einige Mediziner, mit denen er seinen Neffen bekannt machen wollte. Vielleicht ließe sich durch ihre Vermittlung eine Gehilfenstelle finden.
Auch der Vetter begegnete seinem Verwandten freundlich. Er bot ihm an, mit ihm das Zimmer zu teilen, damit die Auslagen geringer wären. Mit Freuden ging Hudson auf diesen Vorschlag ein, war es ihm doch eine große Hilfe, in der Fremde nicht allein zu sein, denn Tom Hudson erinnerte ihn an seine Lieben daheim.
Inmitten des hektischen Lebens, das ihn hier umflutete, kam er sich in der Pension wie ein Wassertropfen im Ozean vor. Alles war so neu und fremd. Er war in einen durchaus unreligiösen Kreis hineingeraten und sah sich von Menschen umgeben, deren Welt ihm beinahe gänzlich unbekannt war. Geschäft, Politik und die Jagd nach Vergnügungen nahmen ihr ganzes Denken gefangen. Onkel und Vetter versuchten alles, ihn mit sich fortzureißen. Sie waren gern zu jeder Hilfe bereit, doch konnten sie seine Ansichten weder verstehen noch teilen.
„Was redest du von Gottvertrauen“, sagte zuweilen sein Vetter, „man muss sich selbst auch anstrengen.“
Die beiden Männer konnten auch nicht verstehen, dass er sich wegen seines Rufs nach China nicht zu einer gewöhnlichen Berufsausbildung verpflichten wollte. Schien es ihnen doch, als ob die Missionsgesellschaft, zu der er sich zählte, in dieser Sache sich mehr als gleichgültig verhielt. Das bedrückte auch Hudson selbst und war ihm äußerst schmerzlich.
Als er den Sekretär der Gesellschaft aufsuchte, sagte dieser etwa Folgendes: „Wir haben bis jetzt noch nichts Bestimmtes unternommen, weil wir Ihr Kommen abwarten wollten. Nun aber, da Sie die Arbeit im Krankenhaus aufnehmen wollen, muss die Angelegenheit vor das Komitee gebracht werden. Natürlich erfordert das Zeit. Wenn Sie aber wollen, dass die Sache ins Rollen kommt, dann senden Sie sofort Ihre Anmeldung, damit sie in der nächsten Missionsratssitzung besprochen werden kann. Diese findet nur jede zweite Woche statt.“
Welch ein Schreck für Hudson! Am 7. Oktober sollte diese Sitzung stattfinden, und jetzt stand man erst in der zweiten Septemberhälfte. Wenn aber sein Fall nicht bei der nächsten Zusammenkunft erledigt werden konnte, musste er weitere zwei Wochen und vielleicht noch länger warten. Inzwischen aber konnte er keine Anstellung annehmen. Seine Ersparnisse würden aufgebraucht sein. Und was würden erst die Leute in der Pension sagen, wo seine scheinbare Unentschlossenheit bereits eine Quelle des Vergnügens bildete!
Wenn er das alles in Hull gewusst hätte! Doch was machte dies alles schon aus? Er war nicht im Vertrauen auf seine eigenen Mittel oder die Abhängigkeit von andern nach London gekommen. Wenn auch die Winde tobten und die Wellen hoch gingen, war doch einer neben ihm, dessen Hand stark genug war, ihn zu halten, und dessen Wort Frieden schenkte. Dieser Eine kannte den Ausgang sowohl wie den Anfang.
So reichte er denn seine Bewerbung ein. Die Wartezeit nützte er zu eifrigem Studium aus. Darin wurde er jedoch oft durch seinen Vetter gestört, dessen Beruf es ihm ermöglichte, ab und zu daheim zu sein. Seine bestimmt nicht böse gemeinte Kritik war jedoch kein Ansporn zu ruhigem Denken.
Die Unsicherheit dauerte an, auch nachdem das Komitee seine Sitzung gehalten hatte. Sonderbarerweise hielt man es für nötig, sich erst näher über ihn zu erkundigen. Es war beschlossen, zunächst eine Reihe von Zeugnissen über ihn anzufordern. Das war Hudsons erste Erfahrung mit dem Geschäftsgang einer organisierten Gesellschaft. Obgleich er später die Notwendigkeit gewisser Vorschriften einsehen lernte, vergaß er doch diese Erfahrung nie, wenn er mit angehenden Missionaren zu tun hatte. Er schrieb darüber an seine Mutter:
„Dies bedeutet einen nicht leicht zu nehmenden Aufschub. Heute werde ich Mr Pearse aufsuchen; denn ich verstehe nicht, was es mit den verlangten Leumundszeugnissen auf sich hat. Werden sie jedoch von mir verlangt, dann danke ich dem Komitee für seine Freundlichkeit und belästige es nicht weiter, weil unsere Ansichten sich nicht decken. Wenn ich nach der Aussprache mit Mr Pearse Zeit finde, werde ich noch einige Zeilen beifügen, sonst schreibe ich später.
Bekümmere dich nicht, liebe Mutter! Gott hat bisher für mich gesorgt, mich beschützt und geleitet. Er schenkt mir völligen Frieden und wird alles herrlich hinausführen. Wie gut ist es, Ihm in allem vertrauen zu dürfen!“
Er traf dann diesen viel beschäftigten Sekretär in Hackney, ehe er sich auf die Börse begab, und erklärte ihm seine Schwierigkeiten. Mr Pearse schien ihn verstanden zu haben. Als Resultat dieser Unterredung wurden die Zeugnisse für überflüssig erklärt. Man verlangte nur einen oder zwei Briefe von Menschen, die ihn am besten kannten.
Am 24. Oktober schrieb er: „Ich freue mich, berichten zu können, dass die Dinge festere Gestalt annehmen. Morgen werde ich wohl die Arbeit im Krankenhaus aufnehmen.“
Während er sich in seiner Stube, so gut es ging, seinen Studien widmete, merkte er nicht, wie sein Zimmergenosse trotz seines Widerstrebens zu der einzigen Quelle der Freude und des Friedens hingezogen wurde. Es war aber wirklich so. Tom Hudson, der die Erlebnisse seines Vetters scharf beobachtete, sah sich vor Tatsachen und Schlussfolgerungen gestellt, denen er weder ausweichen noch widersprechen konnte. Nichts anderes hätte ihm wahrscheinlich seine eigene Gottesferne und seinen Mangel an wahrer Befriedigung deutlicher machen können als das Vorbild seines Verwandten. Ehe das Jahr zu Ende war, durfte Hudson es erleben, dass sein Vetter Christus im Glauben annahm und sich offen als Sein Eigentum bekannte.
Und dann endlich erfüllte sich sein Wunsch. Es waren beinahe drei Jahre verflossen seit jenem Dezembertag, an dem Hudson Taylor endgültig auf den Ruf Jesu in Seinen Dienst eingegangen war. Seitdem hatte er sich ständig mit dem Gedanken seiner zukünftigen Brauchbarkeit beschäftigt und ein Medizinstudium als die beste Vorbereitung erachtet. Mit wenig Hilfe und trotz vieler Hindernisse hatte er durchgehalten und auf praktischem Gebiet Fortschritte gemacht. Nun lag der breite Höhenweg vor ihm – die Vorlesungen, die klinische Ausbildung mit allen Vorzügen eines städtischen Krankenhauses.
Hier geht es nicht so sehr um seine äußeren Erfahrungen während dieser Zeit in London, sondern mehr um die Entfaltung seines inneren Lebens, das Wachstum des Glaubens.
Durch die schweren Regenfälle war diese Jahreszeit trostlos. Große Teile von Londons Osten waren überschwemmt. Das hatte schlimme Folgen für alle, die in der Nähe des Flusses lebten und deren Arbeit sie in den feuchten, nebligen Straßen festhielt. Zu diesen gehörte Hudson Taylor. Das Sohoviertel, in dem er wohnte, lag vier Meilen vom Krankenhaus entfernt. So musste er täglich einen zweistündigen Fußweg von der Oxfordstreet nach Whitechapel und zurück machen. Als einziges Transportmittel diente zwar ein altmodischer Omnibus; der junge Medizinstudent übte sich aber im Sparen und verzichtete auf alles nur eben Mögliche. Darüber schrieb er:
„Allmählich habe ich gelernt, wie ich am besten spare. Ich lebe jetzt zur Hauptsache von braunem Brot und Wasser. So komme ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln aus. Gewöhnlich kaufe ich auf dem Rückweg vom Krankenhaus einen Laib Brot. Damit komme ich zum Abendessen und Frühstück aus. Zum Mittagessen gibt es eine Zulage von einigen Äpfeln.“
Ob der Bäcker, der ihm die Brote verkaufte, wohl erriet, warum sein Kunde die Laibe in zwei Hälften geschnitten haben wollte? Die Erfahrung hatte Hudson gelehrt, wie schwer es ist, eine Teilung unparteiisch vorzunehmen, denn die eine Hälfte musste für den nächsten Morgen aufgespart werden. Zuerst hatte er die Brote selbst geteilt, doch waren dabei die Morgenrationen ständig zu kurz gekommen. Nicht selten hatte er deshalb seinen Weg ins Krankenhaus hungrig antreten müssen. Doch der Bäcker teilte gerecht.
Schwarzbrot, Äpfel, Wasser! Wahrlich eine ungenügende Kost für einen jungen Menschen! Hunger nach Brot und Mattheit bedeuteten jedoch in jenen Tagen wenig im Vergleich zu dem Verlangen seines Herzens. Das vor ihm liegende Ziel erfüllte ihn ganz. China in seiner unbeschreiblichen Not, und was er selbst zu deren Behebung tun könnte, lag schwer auf seinem Herzen, dazu auch das Suchen nach Gottes Weg, den er nur durch Glauben und Gebet erkennen konnte.
„Nein, meiner Gesundheit schadet es nicht“, schrieb er seiner Mutter als Antwort auf ihre Fragen nach seinem Ergehen, „jeder beteuert, wie gut ich aussehe. Die langen Korridore der Stationen ermüden mich nicht mehr so sehr wie am Anfang. Die leichtfertigen Gespräche einiger Studenten betrüben mich jedoch.“
Die Prüfungen dieser Zeit wurden noch durch einen unerwarteten Abzug von seinem bereits dürftigen Einkommen vermehrt. Noch immer stand er mit Mrs Finch in Drainside in Verbindung und konnte für sie regelmäßig von der Reederei, die in der Nähe von Cheapside lag, den halben Betrag vom Lohn ihres Mannes abholen und ihr zusenden. Einmal hielten ihn dringende Examensarbeiten vom rechtzeitigen Abholen des Geldes ab. Deshalb sandte er ihr das Geld aus der eigenen Tasche. Als er später bei der Reederei den Betrag forderte, wurde ihm bedeutet, dass der Offizier von seinem Dampfer in die Goldgruben davongelaufen sei und er das Geld nicht bekommen könne.
„Bald darauf, vielleicht schon am gleichen Tag, heftete ich einige Bogen Papier zusammen, auf denen ich während der Vorlesungen Anmerkungen machen wollte. Dabei stach ich mich in meinen rechten Daumen, vergaß es aber bald.
Am darauffolgenden Tag sezierten wir im Krankenhaus. Es handelte sich um jemanden, der am Fieber gestorben war. Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen, mit welcher Vorsicht wir vorgingen. Die Gefahren waren uns zu gut bekannt. Doch noch ehe der Vormittag um war, fühlte ich mich ungewöhnlich müde, und als ich am Nachmittag die chirurgischen Säle betrat, befiel mich plötzlich ein Unwohlsein und heftiges Erbrechen. Bei meiner einfachen Lebensweise war dies äußerst ungewöhnlich. Nach einer kurzen Ohnmacht kehrte ich wieder zu den Studenten zurück. Doch ich fühlte mich immer elender. Während der Nachmittagsvorlesungen vermochte ich nicht einmal mehr den Bleistift zu halten. Später spürte ich Schmerzen in der rechten Seite und im Arm. Ich fühlte mich richtig krank.
Da ich nicht weiterarbeiten konnte, begab ich mich in den Sezierraum, um meine Sachen zu packen. Dabei sagte ich zu meinem Vorgesetzten, einem geschickten Chirurgen: ‚Ich kann mir nicht erklären, was mit mir los ist‘, und zählte die Symptome auf.
‚Nun, die Sache ist ganz klar. Sie müssen sich beim Sezieren geschnitten haben, und dies war ein Fall bösartigen Fiebers‘, lautete sein Bescheid.
Plötzlich fiel mir der gestrige Stich ein. Ich fragte den Arzt, ob es möglich wäre, dass ein Nadelstich bis dahin nicht geheilt sei. Er glaubte, dies sei die Ursache, und riet mir, eine Droschke zu mieten, in meine Wohnung zurückzukehren und meine Angelegenheiten zu ordnen. ‚Denn‘, fügte er hinzu, ‚Sie sind ein verlorener Mann!‘
Im ersten Augenblick war ich bestürzt, weil mir nun der Weg nach China verschlossen schien. Dann kam mir der Gedanke: ‚Wenn ich mich nicht irre, habe ich in China ein Werk zu vollbringen; darum werde ich nicht sterben.‘ Ich war aber froh, bei dieser Gelegenheit ein Gespräch mit dem Arzt, der ein Zweifler war, über göttliche Dinge führen zu können. Ich sprach denn auch mit ihm über die Freude, bald bei meinem Meister sein zu dürfen, sagte ihm aber, dass ich nicht glaubte, jetzt schon sterben zu müssen, weil ich einen Ruf nach China hätte. Ich würde durchkommen, wenn auch der Kampf schwer sei.
‚Das ist alles ganz schön‘, antwortete er, ‚aber besorgen Sie sich jetzt sofort eine Droschke und fahren Sie so schnell wie möglich nach Hause! Sie haben keine Zeit zu verlieren. Bald werden Sie Ihre Sachen nicht mehr ordnen können.‘
Ich lächelte im Stillen, besaß ich doch keine Mittel zu einem solchen Luxus. Dieser Schwierigkeit enthob mich mein gütiger Onkel, der mir sogleich alles schickte, was ich benötigte.
Die Schmerzen waren beinahe unerträglich, doch ich wollte nicht, dass meine Eltern etwas über meinen Zustand erfahren sollten. Ich war gewiss, dass ich nicht sterben müsste, sondern in China einen Auftrag zu erledigen hatte. Kämen meine Eltern und fänden mich in diesem Zustand, dann hätte ich nicht die Gelegenheit, die Gott mir jetzt schenkte, um Sein Wort zu erproben. Er würde sich bestimmt meiner Lage annehmen, waren doch meine Mittel beinahe erschöpft. So versprachen Onkel und Vetter, nachdem ich Gott um Weisung gebeten hatte, meinen Eltern nichts zu berichten, sondern es mir zu überlassen, ihnen Bescheid zu geben. Als ich ihr Versprechen hatte, fühlte ich, dass dies die klare Antwort auf meine Gebete war. Meinen Bericht über die Krankheit schob ich aber so weit hinaus, bis das Schlimmste vorbei war. Daheim wunderten sie sich nicht über mein Schweigen, sie wussten ja von meinen Examensvorbereitungen.
Die Tage und Nächte des Leidens verstrichen langsam, doch konnte ich nach wenigen Wochen mein Zimmer wieder verlassen. Ich vernahm dann auch, dass zwei Studenten, die allerdings nicht zum Londoner Krankenhaus gehörten, sich zur gleichen Zeit ebenfalls beim Sezieren verletzt hatten und gestorben waren, während ich als Antwort auf meine Gebete für Gottes Auftrag in China erhalten blieb.“
Nun aber sollte Hudson zur Erholung zu seinen Angehörigen in Yorkshire zurückkehren. Noch immer war er entschlossen zu erfahren, wie Gott auf seine Gebete hin aushelfen würde. Darum sagte er niemandem von seiner Geldnot, betete aber umso mehr. Zu seiner Überraschung wurden seine Gedanken auf die Reederei gelenkt. Dort sollte er sich nach der Summe erkundigen, die er nicht hatte abheben können.
„Ich erinnerte den Herrn daran, dass ich mir keine Erholung erlauben könnte, und fragte mich, ob die Heimkehr ein eigener Wunsch und nicht Sein Leiten sei. Nach vielem Beten und Warten auf Gottes Erhörung wurde ich in meinem Glauben gestärkt, dass Gott selbst mich zur Reederei schickte.“
Diese war etwa drei Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Wie aber sollte er dorthin gelangen? Hatte er doch schon zum Treppensteigen Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Bot ihm aber nicht ausgerechnet seine Schwachheit eine weitere Gelegenheit zum Erproben der Wirksamkeit des Gebets?
„Ich bat Gott im Namen Jesu, Er möge mir sofort die nötige Kraft geben, und sandte einen Diener nach Hut und Stock in mein Zimmer. Dann begab ich mich auf den Weg. Ich wollte nicht nur einen Versuch machen, sondern wirklich nach Cheapside gehen.“
Nie hatten ihn Schaufenster so angezogen wie auf diesem Weg. Nach ein paar Schritten musste er sich immer wieder auf der Brüstung eines Schaufensters ausruhen, um Kraft zum Weitergehen zu sammeln. Als er endlich sein Ziel erreicht hatte, ruhte er sich zuerst auf einer Stufe aus, ehe er die Treppe zum Büro im ersten Stock hinaufsteigen konnte.
„Ich empfand meine Lage als äußerst peinlich, als ich so völlig erschöpft auf der Treppe saß, während die Herren, die neben mir auf und ab gingen, mich erstaunt betrachteten. Nach einer kurzen Ruhepause und einem weiteren Stoßgebet brachte ich die Treppe hinter mich. Zu meiner großen Erleichterung fand ich den Beamten im Büro, mit dem ich bisher in der Sache verhandelt hatte. Er erkundigte sich eingehend und sehr freundlich nach meinem Ergehen, weil ihm mein elendes Aussehen auffiel. Ich berichtete ihm von meiner schweren Erkrankung und der Anordnung des Arztes, mich auf dem Lande zu erholen. Dann erkundigte ich mich, ob es sich nicht vielleicht um ein Missverständnis gehandelt hätte und der Offizier doch noch bei der Reederei tätig sei.
‚Ich bin froh, dass Sie gekommen sind‘, rief der Beamte aus, ‚denn es war tatsächlich ein anderer Seemann mit gleichem Namen, der sich aus dem Staube gemacht hatte. Mr Finch befindet sich noch immer auf seinem Schiff, das soeben in Gravesend einlief. Er wird bald hier sein. Ich bezahle Ihnen inzwischen den halben Lohn aus, denn das Geld wird seine Frau sicherer durch Sie erreichen als durch ihren Mann. Wir alle wissen, welche Versuchungen die Männer erwarten, wenn sie endlich nach einer Reise in die Heimat kommen.‘
Ehe er mir jedoch die Summe aushändigte, bestand er darauf, dass ich mit ihm zusammen essen sollte. Weil ich fühlte, dass dies des Herrn Fürsorge sei, nahm ich das Anerbieten dankbar an. Nach der Erfrischung und dem Ausruhen gab er mir ein Stück Papier, damit ich Mrs Finch die Umstände erklären konnte. Auf meinem Rückweg zahlte ich den Rest des Geldes ein, den sie noch zu erwarten hatte. Dann ließ ich mich im Omnibus nach Hause fahren.
Mein gütiger Freund war beim Abschied sehr bewegt und sagte unter Tränen: ‚Ich würde eine Welt geben um einen solchen Glauben.‘
Am nächsten Tag war ich daheim im Elternhaus. Meine Freude über die erfahrene Hilfe und Fürsorge Gottes war so groß, dass ich sie unmöglich für mich behalten konnte. Ehe ich wieder nach London zurückkehrte, kannte meine Mutter das Geheimnis meiner Erlebnisse der vergangenen Monate.
Ich brauche wohl nicht lange zu erklären, warum ich nach meiner Rückkehr nach London nicht mehr so einfach leben durfte wie vorher. Ich hätte es auch nicht ertragen können.“
Nach einem weiteren halben Jahr verbesserte sich Hudsons Lage. Er erhielt eine Anstellung als Assistent eines Chirurgen in der Stadt.
In jener Zeit ereigneten sich in China Dinge, die sein Verlangen, dorthin zu gelangen, vertieften. Fast unglaubliche Nachrichten fanden langsam ihren Weg aus den Inlandprovinzen und erfüllten die ganze westliche Welt mit Staunen. Die Taiping-Rebellion, die im Jahre 1850 bekannt wurde, hatte anscheinend eine große Ausdehnung angenommen. Im südlichen China beginnend, hatte sie sich über die mittleren Provinzen ausgebreitet und schließlich den größten Teil des Yangtsetales, die Hauptstadt eingeschlossen, in Besitz genommen. In Nanking, der ehemaligen Hauptstadt des Kaiserreiches, hatte der neue Herrscher den Sitz seiner Regierung aufgeschlagen und hier seine Truppen zu einem Ansturm auf Peking zusammengezogen. Doch nicht allein der Erfolg machte diese Bewegung so bedeutsam und interessant für die christliche Welt, sondern vielmehr ihre auffallenden Begleiterscheinungen.
Mitten aus einem heidnischen Volk heraus und ganz frei von fremden Einflüssen, schien dieser Aufstand, soweit er beurteilt werden konnte, ein Kreuzzug auf ausgesprochen christlichen Linien zu sein. Die Zehn Gebote bildeten das Sittengesetz dieses neuen Königreichs. Götzendienst in jeder Form wurde schonungslos abgeschafft und die Anbetung des wahren und lebendigen Gottes eingeführt. Der christliche Sonntag wurde als Tag der Ruhe und des Gebets anerkannt und alles, was die Verbreitung des Evangeliums hemmte, aus dem Wege geräumt.
„Ich habe der Armee und dem Volk die Zehn Gebote gepredigt“, schrieb der Taipingführer dem einzigen Missionar, den er kannte, „und habe sie beten gelehrt. Dazu erachte ich es als richtig, Dir, älterer Bruder, einen Boten zu senden, der Dir Frieden wünschen und Dich bitten soll, falls Du mich nicht meinem Schicksal überlassen willst, mit vielen Lehrern zu kommen und mir in der Verbreitung der Wahrheit zu helfen und die Taufen zu übernehmen.
Hernach, wenn mein Unternehmen geglückt ist, werde ich die Lehre im ganzen Kaiserreich verbreiten lassen, damit alle zu dem einen Herrn zurückkehren und allein den wahren Gott anbeten. Das ist’s, was mein Herz ernstlich wünscht.“
Kaum weniger überraschend war seine Stellung zu den westlichen Nationen. Das Opiumrauchen war streng verboten. Der Taipingführer machte kein Geheimnis aus seinem Vorhaben, die Opiumeinfuhr zu verhindern. Aber gegen Ausländer, seine christlichen „Brüder“ von jenseits der Meere, zeigten er und seine Anhänger eine große Herzlichkeit.
„Der große Gott“, sagten sie, „ist der Vater aller Menschen, die unter dem Himmel leben. China steht unter Seiner Herrschaft und Obhut. Es gibt viele Menschen unter dem Himmel, doch sind sie alle Brüder. Warum sollten wir weiter hier eine Schranke oder dort eine Mauer aufrichten? Warum weiter einander vernichten und aufreiben wollen?“
Kein Wunder, dass Hudson Taylor und viele andere Gläubige darin Gottes Vorsehung sahen! Was Könige und Regierungen nie hätten zustande bringen können, vermochte Er auf Seine eigene wunderbare Weise in kürzester Zeit zu vollbringen. Doch wie groß war jetzt die Verantwortung der christlichen Gemeinde! Und wie unvorbereitet erwies sie sich für diese Aufgabe!
Es ist verständlich, dass sich Hudson Taylor angesichts dieser Ereignisse fragte, ob es recht sei, wenn er sich durch sein Medizinstudium in der Heimat zurückhalten ließe, sollte doch sein ärztliches Wissen als Hilfe zur Evangelisation in Gebieten dienen, die bisher unerreicht geblieben waren. Zu diesem Werk wusste er sich gerufen, davon war er fest überzeugt. Ob aber die Chinesische Missionsgesellschaft zustimmen würde, wenn er sein Studium abbräche, war eine andere Frage.
Nach ihren Regeln und Bestimmungen zu urteilen, würden sie auf alle Fälle absolute Kontrolle über die Unternehmungen ihrer Vertreter ausüben. Es wurde von diesen genaues Befolgen der Satzungen erwartet. Wenn die berechtigte Autorität des Komitees berücksichtigt werden musste, wie könnte er dann aber das Werk ausführen, zu dem Gott ihn gerufen hatte? Wenn nun einzelne Punkte ihrer Satzungen nicht mit seinem Ruf übereinstimmten?
Er schrieb schließlich an die Gesellschaft und teilte ihr seine Überlegungen bezüglich seines Chirurgiestudiums mit, das diese ihm ermöglichen wollte.
„Die Regeln der Missionsgesellschaft sind vernünftig und für die Organisation notwendig“, schrieb er an seine Mutter, „doch für mich, der ich auf ihre Kosten ausgebildet und ihr darum verpflichtet bin, würde es bedeuten, dass ich ein Angestellter der Gesellschaft wäre. Damit aber stünde ich nicht mehr unter der direkten, persönlichen Führung Gottes. Als Mittelloser könnte ich mich nicht vor neun Monaten, der festgelegten Kündigungsfrist, ehrenhaft von der Gesellschaft lösen und auch nichts unternehmen. Zu große Vorteile kosten möglicherweise zu viel. Das aber wäre mehr, als mein Gewissen mir erlaubt.“
Doch all diese wichtigen Überlegungen durften ihn in seinen täglichen Pflichten nicht stören, und er vernachlässigte auch nicht die größte Pflicht, Menschen den Weg zu Christus zu zeigen. Die Ungeretteten in der Heimat belasteten ihn ebenso sehr wie die in China.
Einer der Patienten seines Vorgesetzten war dem Trunk ergeben gewesen und litt nun in seinen mittleren Jahren an Greisenbrand. Sein Zustand war ernst und sein Hass gegen alles, was mit Religion zu tun hatte, so groß, dass es hoffnungslos schien, Einfluss auf ihn zu gewinnen. Darüber schrieb Hudson Taylor:
„Die Krankheit begann wie gewöhnlich harmlos. Der Patient ahnte nicht, dass er verloren war und nicht mehr lange leben würde. Ich behandelte ihn nicht als Erster; doch als er mir übergeben wurde, war ich sehr besorgt um seine Seele. Er lebte in einer christlichen Familie. Von ihr vernahm ich, dass er ein eingeschworener Atheist sei. Man hatte, ohne ihn zu fragen, einen Seelsorger gebeten, er möge ihn einmal besuchen. Der war aber von dem Patienten aus dem Zimmer gewiesen worden. Auch der Gemeindevikar hatte ihn besucht, aber auch ihm begegnete der Kranke abweisend, spie ihm ins Gesicht und verbat sich alles Reden. Seine Gemütsart wurde mir als äußerst heftig geschildert, und alles zusammengenommen schien der Fall hoffnungslos zu sein.
Als ich dann die Behandlung übernahm, betete ich viel für den Mann, sagte ihm aber in den ersten Tagen nichts von religiösen Dingen. Durch ganz besondere Sorgfalt beim Verbinden konnte ich seine Leiden erheblich lindern und bald schien er meine Dienste zu schätzen. Eines Tages nahm ich zitternd seine dankbare Anerkennung wahr und sagte ihm den Beweggrund meines Handelns. Ich machte ihn aufmerksam auf seine ernste Lage und darauf, dass er der Gnade Gottes durch Jesus Christus bedürfe. Es kostete ihn sichtlich große Überwindung, seine Lippen geschlossen zu halten. Er drehte sich im Bett gegen die Wand und sagte kein Wort.
Ich musste ständig an den armen Menschen denken und betete täglich mehrmals für ihn zu Gott, Er möge ihn durch Seinen Geist erretten, ehe Er ihn von der Welt nehme. Nach jeder Behandlung seiner Wunde sagte ich ihm einige Worte, von denen ich hoffte, der Herr würde sie segnen. Jedes Mal drehte er sich gegen die Wand, sah gelangweilt aus und antwortete nie etwas darauf. Nachdem ich dies einige Zeit erfolglos getan, sank mein Mut. Es schien, als ob ich nicht bloß nichts ausrichtete, sondern ihn eher verstockte und damit seine Schuld Gott gegenüber noch vergrößerte. Eines Tages, nachdem ich ihn verbunden und meine Hände gewaschen hatte, wandte ich mich nicht wie üblich an ihn, sondern ging zögernd auf die Tür zu und wartete dort einen Augenblick.
Es beschäftigte mich das Wort: ‚Ephraim hat sich zu den Götzen gestellt; so lass ihn hinfahren!‘ Ich blickte noch einmal auf meinen Patienten zurück und bemerkte seine Überraschung, war es doch das erste Mal, dass ich ihn verlassen wollte, ohne einige Worte für meinen Meister zu ihm gesagt zu haben.
Nun konnte ich es nicht länger ertragen. In Tränen ausbrechend eilte ich zu ihm zurück und sagte: ‚Mein Freund, ob Sie es hören wollen oder nicht, so muss ich doch meinem Herzen Luft machen.‘ Dann redete ich ernst mit ihm und sagte, wie sehr ich wünschte, mit ihm beten zu dürfen. Zu meiner unaussprechlichen Freude wandte er sich nicht weg, sondern erwiderte: ‚Wenn es Ihnen Befreiung bedeutet, dann tun Sie es!‘
So kniete ich neben ihm nieder und betete für ihn. Ich glaube, dass Gott in jenen Augenblicken in seinem Herzen eine Umwandlung bewirkte. Von dem Tag an zeigte er sich nie mehr unwillig, wenn ich mit ihm sprach oder betete. Und schon nach wenigen Tagen nahm er Christus bewusst als persönlichen Erlöser an.
Der glückliche Dulder lebte nach seiner Veränderung noch einige Zeit und wurde es nie müde, von Gottes Gnade zu reden. Obgleich sein Zustand erbarmungswürdig war, machte die Umwandlung seines Charakters und seines Benehmens die vorher so schwierige Pflege zu einer wirklichen Freude. Oft wurde ich durch dieses Erlebnis an die Worte der Heiligen Schrift erinnert: ‚Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.‘ Vielleicht würden wir öfter den gewünschten Erfolg sehen, wenn ein tiefes Empfinden für Seelen uns weinen ließe. Während wir vielleicht die Härte der Herzen beklagen, deren Wohl wir suchen, mag die eigene Herzenshärtigkeit und unser schwaches Verständnis der ernsten Wirklichkeit ewiger Dinge der wahre Grund des Versagens sein.“
Bald nach diesem Erlebnis klärte sich plötzlich Hudson Taylors Weg. Alles hatte so verworren ausgesehen, vor allem, seitdem er der Missionsgesellschaft seinen Entschluss mitgeteilt hatte, die Studien nicht fortzusetzen. Er hatte aber ernstlich um Gottes klare Führung gebetet und von ganzem Herzen danach verlangt, Seinen Willen zu erkennen und zu tun. Nun kam das Licht ganz unverhofft und auf eine ganz unerwartete Weise. Gottes Zeit war gekommen, und hinter den Ereignissen stand, wie der Prophet aus alter Zeit uns sagt, „ein Gott, der so wohl tut denen, die auf Erden wohnen“ (Jes. 64,4).
In China überstürzten sich die Ereignisse. Seit der Eroberung Nankings im März hatten die Taipings sich die mittleren und nördlichen Provinzen unterworfen und selbst Peking besetzt. Dies konnte nur eins bedeuten: Sollte Peking sich unterwerfen, dann stünde China forthin dem Evangelium offen. Diese Möglichkeit, so unermesslich sie war, erwies sich als kraftvoller Antrieb zur Missionsarbeit. Überall gab es Herzen, die für China brannten. Es musste unbedingt etwas unternommen werden, und zwar sofort. So floss das Geld eine Zeit lang in die Sammelbüchsen.
Anfang Juni schrieb der Sekretär der Gesellschaft an Hudson Taylor:
„17 Red Lion Square
4. Juni 1853
Mein lieber Herr!
Da Sie fest entschlossen sind, nach China zu ziehen, und das Studium abbrechen wollen, möchte ich Ihnen freundlich raten, sich ohne Zögern auf die Ausreise vorzubereiten. Wir brauchen jetzt Männer, die dem Herrn ganz ergeben sind. Ich glaube, Ihr Herz steht richtig zu Gott und Ihre Motive sind lauter, sodass nichts einer Anmeldung im Wege steht.
Ich glaube jedoch, dass Sie es schwer finden werden, Ihren Plan der Selbstversorgung auszuführen, denn sogar Mr Lobscheid konnte sich keine freie Überfahrt beschaffen.
Wenn Sie Freudigkeit haben, sich unserer Gesellschaft anzubieten, lege ich dem Vorstand gern Ihre Anmeldung vor. Es ist ein wichtiger Schritt, der viel ernstliches Gebet erfordert. Doch wird Ihnen Weisung von oben geschenkt werden. Unternehmen Sie alles, was Sie können, und dies bald!
Ich bin, mein lieber Herr,
Ihr
Charles Bird.“
Nun überstürzten sich die Ereignisse. Schon nach wenigen Wochen erschien ein Abschnitt in der „Ährenlese“. Es hieß darin:
„Am Freitag, dem 9. September, wurde in den Räumen der Chinesischen Evangelisationsgesellschaft eine Versammlung durchgeführt, wobei Mr James Hudson Taylor, ein nach China ausreisender Missionar, Gottes Schutz anbefohlen wurde. Mr James Hudson Taylor wird sich auf der ‚Dumfries‘ (Kapitän A. Morris) für Schanghai einschiffen. Die ‚Dumfries‘ wird Liverpool am 19. September verlassen.“
Damit begann Hudson Taylors Lebenswerk.