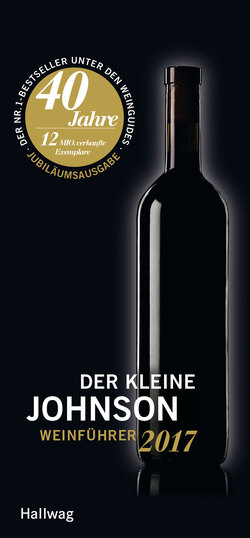Читать книгу Der kleine Johnson 2017 - Hugh Johnson - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеZur Ausgabe 2017
Alle fragen, wonach sie sich als nächstes umsehen sollen. Welches Land oder welche Region ist gerade auf dem Weg nach oben? Na ja, alle irgendwie. Weine, die gerade schlechter werden, sind derzeit nirgends in Sicht – nicht einmal welche, die nicht besser würden. Meine Gegenfrage lautet daher: »Ist das wirklich wichtig?« Suchen Sie verzweifelt nach einem neuen Trend, bei dem Sie der Erste sein können, oder wollen Sie einfach nur eine gute Flasche Wein zu einem guten Preis haben? Für berühmte Namen oder einen Stoff, um den gerade ein völlig verrückter Hype gemacht wird, können Sie natürlich astronomische Preise bezahlen, aber geht es nicht vielmehr darum, zunächst einmal etwas zu finden, was Ihren richtig schmeckt?
Einen solchen Trend kann man derzeit bei den »Naturweinen« beobachten, also Weinen, bei deren Herstellung lang erprobte Vorsichtsmaßnahmen wie etwa das Schwefeln im Keller ganz oder großteils beiseite gelassen werden. Für mich spielt das, was ich trinke, eine viel zu große Rolle, als dass ich mich auf vegane Attitüden einlassen würde. Weinbereitung ist eine alte Kunst, bei der Moden durchaus ihre Bedeutung haben, aber als erfahrener Weingenießer lässt man sich nicht mehr so leicht mitreißen.
Die vor 40 Jahren erschienene erste Ausgabe dieses immer dicker werdenden Büchleins war noch ziemlich bescheiden. Ich scheute mich vor dem Wort »Enzyklopädie«, oder sogar »Führer«: Es war einfach mein Pocket Wine Book, mein Weinbuch für die Hosentasche, in das ich möglichst knappe Notizen zu allen Weinen schrieb, die ich für international beachtenswert hielt. Das waren damals 144 Seiten mit einer Menge hübschem Weißraum um die Texte herum. Die Idee war, dass man es wie einen Taschenkalender einstecken konnte, und tatsächlich mussten wir einen Kalenderbinder finden, um das schmächtige Werk ordentlich binden zu lassen.
Das war 1977. Ich war leicht überrascht, als der Verlag dann eine aktualisierte Version für 1978 haben wollte. Dafür war mehr Arbeit und Recherche erforderlich. Erst jetzt dämmerte es mir, dass ich in ein Thema mit eingebautem Bedarf für jährliche Aktualisierungen gestolpert war. Mit eingebauter Obsoleszenz, genaugenommen – der Traum jedes Vermartkters. Jedes Jahr bringt auch einen neuen Jahrgang hervor – ganz zu schweigen von neuen Namen, neuen Weinbergen, besserer und schlechterer Qualität und sogar, in geradezu erschreckendem Maß, kompletten neuen Ländern, die dazukommen. Wie viele andere Themen brauchen ein jährliches Update?
Wir trinken weniger
Die Statistiken sind überraschend. Es wird weniger Wein getrunken auf der Welt, nicht mehr, und er wird von einer deutlich kleineren Rebfläche produziert. Kein Land hat noch einen Verbrauch von 130 Litern pro Kopf und Jahr wie noch vor Zeiten. In Frankreich liegt die Zahl jetzt bei 50 und sinkt weiter. Sie können das auf einen veränderten Lebensstil schieben, auf höhere Einkommen, die für bessere Weine ausgegeben werden, ich aber glaube, dass es an den Autos liegt. Jeder fährt heutzutage Auto (oder ein Zweirad), da muss man vorsichtig sein. In den 1970ern trank niemand Mineralwasser, und nur wenige gingen ins Restaurant, wo der Wein drei- bis viermal so teuer ist.
Vor 40 Jahren waren die größten Unternehmen der Branche kleine Fische verglichen mit, nur zum Beispiel, Constellation Brands, das für 3,77 Milliarden US-$ im Jahr Wein verkauft. Großunternehmen werden, fast müßig zu sagen, von Buchhaltern geführt, Buchhalter hören auf Marketingleute, und Marketingleute beklagen, dass die Weinindustrie ein hoffnungsloser Fall ist. Das Pferd wird von hinten aufgezäumt. Man soll herstellen, was die Kunden mögen, nicht darauf hoffen, dass die Kunden mögen, was man herstellt. Es stimmt schon: Das Weingeschäft ist seit jeher »produktorientiert«, wie es heute heißt.
Die Erzeuger geben sich Mühe, doch die Natur hat das letzte Wort. Im Keller ist inzwischen eine Menge möglich, aber wenn es regnet, dann regnet es (manchmal auch nicht genug). Erinnern Sie sich an die Erleichterung und die Freude über einen Jahrgang wie 2015, als der größte Teil Europas einen idealen Sommer erlebte. Was für eine Industrie! Stellen Sie sich vor, man würde in Stuttgart oder Wolfsburg Partys schmeißen, wenn einmal ein Satz Autos gelingt, mit denen man fahren kann!
Der Wein ist in der modernen Welt ohne Absicht und Ziel aufgetaucht. Er hat sich über ein paar Jahrtausende einfach irgendwie durch Versuch und Irrtum entwickelt. Seine berühmtesten Repräsentanten – Bordeaux, Burgunder, Champagner – entstanden als Antworten auf lokale Fragen geografischer, meteorologischer, geologischer, kultureller, historischer und fast immer auch politischer Natur. Einfacher Zugang zu wohlhabenden Märkten war der Schlüssel. Roter Bordeaux etwa schmeckt so, wie er schmeckt, weil die Bauern rund um Frankreichs bedeutendsten Hafen für den Handel mit Nordeuropa sich für jene Trauben entschieden, die am verlässlichsten reiften für den Wein, den sie exportieren konnten. Der heimische Markt? Nicht für den guten Stoff.
Champagner hat seinen aufregenden Charakter gewonnen, weil die besten Trauben Ostfrankreichs recht schwächlich werden, wenn sie weiter im Norden wachsen. Die Weine, angebaut unweit von Paris und der reichen flandrischen Märkte, waren zu dünn, um zu gefallen – außer man vergor sie so, dass sie schäumten. Wie Burgunder und Bordeaux verband sich der Champagner mit einem nahegelegenen Luxusmarkt. Das war nur wenigen Weinen vergönnt. Ein anderes natürliches Beispiel ist der Rhein mit seinen Weinen; Port und Sherry hingegen mussten erfunden werden: Nierenwärmer für schlotternde Nordländer.
Bis noch vor wenigen hundert Jahren war der Weinbau auf Europa beschränkt. Man muss sich nicht darüber wundern, dass die Rebenpioniere der Neuen Welt sich am Goldstandard der berühmtesten Weine Europas orientierten. Also wurden die gleichen Rebsorten gepflanzt. So gelangten wir vor etwa 100 Jahren auf eine Art Plateau, insofern, als den meisten der ehrgeizigen Weinbaugebiete die gleichen Trauben wuchsen: diejenigen, die im Lauf der Geschichte aus sehr unterschiedlichen Gründen selektiert worden waren.
Wir wechseln die Traubensorten
Auf diesem Plateau sind wir noch immer – aber wie lange noch? Ein Wechsel liegt in der Luft, die Blicke richten sich überallhin, nach außen und nach vorn. Wann hörten Sie zum ersten Mal den Namen Albariño? Oder sogar (außer Sie waren schon ein ziemlicher Spezialist) Carmenère oder Touriga oder Vermentino? Sagt Ihnen Fiano irgendetwas? Aghiorgitiko? (Ah, Sie haben erraten, dass das griechisch ist.) Es war unvermeidlich, dass neue Weine sich Ihre Identität zunächst von prestigeträchtigen Traubennamen ausliehen. Aber das ist 50 Jahre her. Mit der neuen Welle wird gerade voll Stolz etwas eingeführt, was man »ethnisch« nennen könnte – so wie derzeit an jeder Ecke Sushi oder Tapas oder Dim Sum zu bekommen ist. Mit Aglianico, Arneis, Blaufränkisch, Bourboulenc, Cannonau, Fiano, Dolcetto, Godello, Primitivo, Leanyka, Tannat, Malvasia, Saperavi, Ribolla sind die Weinlisten bereits doppelt so lang geworden. Aber das ist erst der Anfang. Warum sich auf bereits existierende Rebsorten beschränken? Der Querdenker unter den kalifornischen Weinmachern, Randall Grahm, macht sich daran, bessere zu züchten. Und ich bin sicher, ihm oder andern wird es bald gelingen.
Das sind die Trends, die kommen. Ganz vorne steht, stets im Wandel, die Frage nach dem Stil. Ich habe schon viele Moden vermerkt, manchmal auch gefördert und manchmal beklagt, etwa die naive Begeisterung für den Geschmack nach Eiche, die in den 1990er-Jahren ihren Höhepunkt erreichte und in manchen Kellern immer noch anhält. Die immer massiver werdende Alkoholstärke fast aller Weine seit den 1970ern bis erst vor kurzer Zeit war ein weiteres wiederkehrendes Motiv in diesem Buch, zusammen mit der Bedeutung von Robert Parker und seinem verführerischen Punktesystem. Zum Glück meine ich, dass die 100 Punkte nun allen Schaden angerichtet haben, zu dem sie fähig waren. Die Kellermeister haben erkannt, dass Ein-Glas-Weine eine Sackgasse sind; auf lange Sicht lohnt es sich viel mehr, etwas so Köstliches und Harmonisches zu produzieren, dass der Kunde eine zweite Flasche möchte.
Die Alkoholfrage ist ärgerlich und gar nicht so einfach zu lösen. Zu ihr gehört auch die Inflation in den Weingläsern. Früher fassten sie, halb gefüllt, 75 ml, heute sind 200 ml normal. Kein Wunder, dass wir torkeln. Als der Alkoholgehalt in den 1990ern und 2000ern immer weiter nach oben ging, hat sich kaum einer beschwert. Ich kenne Leute, die sich immer noch nach »mächtigen Roten« von 15 Vol.-% umsehen. Es ist mir immer ein Rätsel geblieben, warum Erzeuger Weine produzieren, bei denen man nach ein paar Gläsern aufhört. Jetzt machen sie die globale Erwärmung verantwortlich.
Doch der Klimawandel setzt die Erzeuger in warmen Gebieten zu Recht unter Druck. Das große Geheimnis der besten Weinberge der Welt ist, dass sie klimatisch in Randgebieten liegen. In den entscheidenden Augenblicken kühlen sie ab: nachts und nach der Lese, wenn alles etwas langsamer werden muss. Fast alle der neuen Rebflächen der Welt liegen in Gebieten, die ein bisschen wärmer sind als ideal. Wenn es dann noch wärmer wird, werden die Leute nervös. Darum zieht es schlaue Winzer im Norden weiter nach Norden und im Süden weiter nach Süden, und sowieso alle bergauf. Ein Gebiet ganz am Rand wie die Mosel hat seit mindestens einer Generation keinen schlechten Jahrgang alten Schlags mehr gehabt.
Ich feile nun seit 40 Jahren an diesen Texten. Und nach so vielen Durchgängen möchte ich meinem Team von Mitwirkenden danken, 30 an der Zahl, die ihre Nasen in jede Weinecke auf dieser Welt stecken. Ich treffe sie nicht immer alle von Angesicht zu Angesicht, aber sie liefern. Dann koche ich das Süppchen daraus. Margaret Rand, meine Gesamtredakteurin, fügt alles zusammen, Hilary Lumsden, in Schottland, bringt es in Form, Yasia Williams kümmert sich ums Layout, und Denise Bates gibt es heraus. Ihr seid alle wunderbar. Danke. Und jetzt auf zu Nummer 41 …
Hugh Johnson