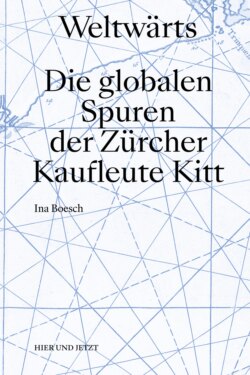Читать книгу Weltwärts - Ina Boesch - Страница 12
Freie Ware
ОглавлениеNach der Hochzeit wohnte Baschi mit Regula bei seiner Schwiegermutter – damals nicht unüblich für junge Männer. Die Frau des «bescheidenen» Händlers brauchte Hilfe im Haus, das in der sogenannt Kleinen Stadt am Münsterhof stand. Sie suchte aber auch Unterstützung im Laden, den sie nach dem Tod ihres Mannes weiterhin von der Stadt mietete und der auf der Rathausbrücke beim Richthaus lag. Dort durfte Baschi Ware verkaufen, die sie nicht selbst im Angebot hatte.12
Er hielt unter anderem Pelze feil, die er in Lyon bezog. Wie die meisten Kaufleute aus Zürich, St. Gallen oder Bern und wie seine Verwandten, die Werdmüllers, kaufte Baschi seine Ware vor allem in der französischen Handelsmetropole ein. Die Stadt, bei der Saône und Rhône zusammenfliessen, lag günstig zwischen dem Mittelmeerhafen Marseille und Paris, mit Verbindungen nach Spanien und in dessen Kolonien, mit einem starken Bezug zu Italien und dem Levantehandel und mit engen Beziehungen zu Genf und der Eidgenossenschaft. Ihre besondere Stellung verdankte sie einem exquisiten Faden: Zu Tausenden webten Heimarbeiter die seidenen Stoffe, die am französischen Hof in Paris ebenso begehrt waren wie in Marseille, Zürich und anderen Städten. Baschi reiste regelmässig dorthin – trotz des gefährlichen Wegs: Einmal überfielen ihn Reisläufer und raubten ihn aus.
Er hatte jedoch nicht nur mit Wegelagerern zu kämpfen, sondern auch mit Leuten aus den eigenen Reihen. Wegen seiner Ware kam Baschi, Mitglied der klassischen Krämerzunft, der Zunft zur Saffran, ab und an in Konflikt mit Mitgliedern anderer Zünfte.13 Als Berufsorganisationen wahrten die Zünfte die Interessen ihrer Mitglieder und funktionierten häufig wie Kartelle. Baschi verkaufte Ware, auf die andere Zünfte ein Vorrecht hatten – zumindest sahen einige Zunftmitglieder das so.14 Im Herbst 1597 berichteten die Glasermeister dem Rat von Zürich von folgendem Ereignis: Das Klirren des Glases in seinem Handwagen kündigte die Ankunft des Fremden an. Schnell schickte Baschi einen seiner Knaben los, den «Welschen» abzufangen und zu seinem Haus zu führen. Die Zünfter warfen Baschi vor, die Ware nicht – wie für alle Kaufleute vorgeschrieben – zuerst ins sogenannte Kaufhaus gebracht zu haben, um sie dort zu wägen und zu verzollen. Der «Grempler» habe ihr Monopol missachtet, klagten sie.
Er habe den Glasern nicht schaden wollen, entgegnete Baschi dem Rat. Die Ware habe er in Lyon bestellt und sie auch schon bezahlt. Einen Teil der Glasware brauche er in seinem grossen Haushalt, den Rest wolle er hier und anderswo verkaufen, führte er weiter aus. Man könne ihm dieses Geschäft nicht verbieten, da das Glas «ein frye kauffmanschatz» sei, eine Ware, die Kaufleute ohne Einschränkungen handeln dürften. Und er betonte: Andere Händler täten es ihm gleich. Der Rat entschied, dass Baschi Glas kaufen und verkaufen dürfe – unter der Bedingung, dass er das Glas wie alle Händler über das Kaufhaus einführe.
Immer wieder musste der Rat Streitigkeiten zwischen Zünften schlichten. Auch wenn die Standesorganisationen das wirtschaftliche Leben ihrer Mitglieder zu regeln hatten, war es die Obrigkeit, welche die Leitlinien vorgab. Im Ernstfall entschied sie für oder gegen den Markt, pro oder kontra Regulierung. Im Fall des Streits um das Glas hatte sie sich für den Wettbewerb ausgesprochen.
Nur einige Monate zuvor hatte der Rat ganz anders entschieden. Im Frühling 1597 hatten die Kürschnermeister geklagt, dass Baschi und weitere Händler Felle und Pelze verkauften. Sie schadeten damit der Zunft zur Schneidern, betonten sie und beschrieben die Ware: In ihren Häusern und Läden würden die Kaufleute Wolfsfelle versilbern, ebenso «auf romanische Art» gefärbte Felle, auch Schlaf- und Unterröcke aus Pelz.15 Der Rat verteidigte das Monopol der Kürschner und gab den Klägern recht. Er verbot Baschi und den anderen den Verkauf von Fellen und Pelzen. Gegen den Kauf für den Eigengebrauch hatte er jedoch nichts einzuwenden.
So schlug sich Baschi mit der Obrigkeit und den Zünften herum und bemühte sich zusammen mit seiner Frau Regula, durch den Verkauf ihrer Ware die materielle Grundlage ihres Haushalts zu sichern. Mit einem Darlehen des Thalwiler Junkers Max Vogel wollte er sich mehr Spielraum verschaffen.16 1400 Sonnenkronen hatte er aufgenommen, was 27 Jahreslöhnen eines Zimmermeisters entsprach. Als Pfand setzte er das am Münsterhof gelegene Haus zum Bärenberg samt Nebengebäuden ein.
Doch er schaffte es nicht, den Wucherzins zu bezahlen, geschweige denn das Darlehen zurückzuerstatten. Als ihm 1602 das Wasser bis zum Hals stand, floh er aus der Stadt. Nach seiner Flucht drohte die Schliessung des Ladens.