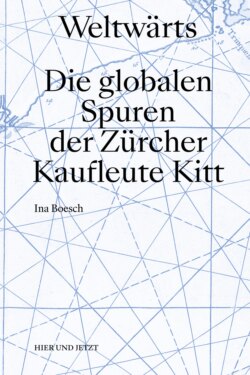Читать книгу Weltwärts - Ina Boesch - Страница 6
Vorwort Familiäre
Verwick-
lungen,
globale
Verstri-
ckungen
ОглавлениеSalomon war mein Stolperstein. Eines Tages strauchelte ich sozusagen über seinen Namen. Ein gewisser Salomon Kitt sei in der Karibik in koloniale Geschäfte verwickelt gewesen, las ich in einem Buch des Historikers Hans Conrad Peyer. Meine Zürcher Grossmutter hiess Kitt. So viel wusste ich. Ihre Familiengeschichte kannte ich so gut wie gar nicht. War einer meiner Vorfahren tatsächlich ein Kolonialherr gewesen? Möglicherweise ein Plantagenverwalter? Gar ein Sklavenhändler? Noch bevor der Gedanke Form annehmen konnte, wischte ich ihn zur Seite. Was kümmert mich die familiäre Vergangenheit, dachte ich und stürzte mich in die Aufarbeitung aktueller Themen. Doch die Vorstellung, dass meine Familie vor 250 Jahren in schmutzige Geschäfte verstrickt gewesen sein könnte, liess sich gleich einer lästigen Fliege nicht so einfach verscheuchen. Wenn etwas dran wäre? Womöglich profitierten Salomons Nachkommen, seine Kinder und Kindeskinder, Nichten und Neffen bis hin zu meiner Grossmutter und mir, von seinen kolonialen Machenschaften – und tun es noch heute. Die Idee beschämte mich.
Lange verband ich ausschliesslich die Familie meiner niederländischen Mutter mit dem Kolonialismus, nicht aber die Familie meines Schweizer Vaters. Bei meinen holländischen Verwandten erfuhr ich paradoxerweise als Erstes, dass die gewaltsame Expansionspolitik Kolonialherren im positiven Sinn verändern kann. So ist es von Vorteil, über den Tellerrand zu schauen. Ich erlebte, dass ihr Horizont weit ist – weiter, als es sogar die flache Landschaft im platten Land erlaubt. In ihren Häusern spürte ich auch zum ersten Mal das Aroma der Fremde auf der Zunge. Ich erinnere mich an die Geschmacksexplosion in meinem Mund, als ich hausgemachten Speculaas ass, das flache Gebäck aus viel Butter, ebenso viel Zucker und einer Unmenge an exotischen Gewürzen. Die Niederländer behaupten, es erfunden zu haben. Ich erfuhr jedoch auch von den weniger appetitlichen, den abscheulichen Seiten der niederländischen Kolonialherrschaft. Manchmal, selten, schnappte ich Erinnerungsfetzen auf. Vom Militärdienst in Indonesien. Von Kriegsgefangenschaft. Von der Flucht durch einen eiskalten Fluss. Mit gedämpfter Stimme sprachen die Männer auch von Erschiessungen.
Ich wäre nie auf den Gedanken verfallen, dass auch Schweizer Verwandte eine koloniale Vergangenheit haben könnten. Schliesslich besass die Schweiz keine Kolonien. Dabei standen im Haus meiner Zürcher Grossmutter Gegenstände, die von einer globalen Geschichte zeugten. Ich hätte sie nur zu lesen brauchen. Zum Beispiel eine Kopie der Büste der Nofretete. Ich wusste zwar, dass Hedwig Kitt ihre ersten Kindheitsjahre in Ägypten verbracht hatte, aber die schöne Pharaonin verführte mich nicht dazu, tiefer zu graben.
Doch eines Tages siegte die Neugier. Ich begann, an einem Faden zu ziehen, von dem ich annahm, dass er mich zu Salomon Kitts Vergangenheit führen könnte. Tatsächlich. Am Fadenende ein erstes Fundstück: ein Testament von 1785, das im Staatsarchiv von Maryland in Annapolis liegt. Es dauerte nicht lange, und ich hatte weitere Trophäen aufgestöbert: etwa Briefe, die Salomon als junger Mann an seinen Zürcher Busenfreund Johann Heinrich Füssli geschrieben hatte. Bald hatte mich das Jagdfieber fest im Griff. Ich flog ins Ungewisse und folgte Salomons Spur auf St. Eustatius, einer heute unbedeutenden Insel in der Karibik, damals das Zentrum der westlichen Welt. Auch in den Jagdgründen der südlichen USA nahm ich Fährte auf, mit einigem Erfolg: So fand ich beispielsweise in Baltimore in der Maryland Historical Society Dokumente, die Aufschluss gaben über einen Kaufmann von zweifelhaftem Ruf.
Mit der Zeit reichte mir der Beutezug in Salomons Gefolge nicht mehr. Allmählich begann ich, mein Revier auszuweiten und auch andere Mitglieder der Stadtzürcher Familie Kitt in den Blick zu nehmen, und nach und nach dehnte ich meine Zeitreise immer weiter aus. Mein Leitmotiv blieb die Frage nach einer Verbindung mit jener Welt, die ausserhalb der eidgenössischen Grenzen und Europas lag. So wurde aus dem Stolperstein Salomon der Stein, der meine weitreichenden Recherchen ins Rollen brachte, der Auslöser für meine persönlich und politisch motivierten Nachforschungen zu einem Thema, das zunehmend in den Fokus der schweizerischen Öffentlichkeit und der Geschichtswissenschaft gerät: die globale und koloniale Vergangenheit der Schweiz.
Ich wusste nicht, wohin mich meine Neugier führen würde. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir ausgemalt, einst auf einer einsamen Insel zu landen. Ich hatte auch nicht geahnt, welch grosse Welt sich in einem Kochbuch verbirgt. Und nie wäre mir in den Sinn gekommen, mich an die Fersen von Mumien zu heften. Es lohnte sich, der Wissbegier zu folgen, denn die Verlockungen des Unbekannten ermöglichten mir ebenso die Auseinandersetzung mit konkreten Themen der Vergangenheit (etwa dem Wesen eines Kaufmanns im 18. Jahrhundert) wie mit brennenden Fragen der Gegenwart (etwa der Rückgabe von Kulturgütern).
Auf meinem Weg in die 500-jährige Vergangenheit der Kitts begegnete ich vielen Krämern, Händlern, Kaufleuten – Männern, deren Geschäfte meist nicht an der Stadtmauer endeten: Einige pflegten wirtschaftliche Beziehungen zu Nachbarregionen, andere bis in die Zentren der damaligen Weltimperien, dritte bis nach Übersee. Ich stiess auch auf Söldner, die im Dienst global aktiver Auftraggeber, also von Berufs wegen Grenzgänger waren. Und ich traf auf lokal tätige Ärzte und Pfarrer, Goldschmiede und Gerber, Buchbinder und Apotheker, Fabrikanten und Makler, Lehrer und Staatsangestellte und in der Zürcher Landschaft auf Weber und Landwirte. Politiker fand ich keine. Auch keine herausragenden Persönlichkeiten, wie es sie in den Sippen Escher, Werdmüller, Bodmer, Gessner oder anderen sogenannten guten Zürcher Familien gab. Die Kitts schienen eine durchschnittliche Oberschichtsfamilie gewesen zu sein. Gerade weil sie keinen Sonderfall darstellt, wurde meine Neugier, ob und wie globale Beziehungen im Leben ihrer Mitglieder eine Rolle gespielt hatten, besonders geweckt.
Wenig erstaunlich setzte sich das Personal, das im Lauf meiner Nachforschungen meinen Computer bevölkerte, fast ausschliesslich aus Männern zusammen. Sie waren es und unter ihnen vorwiegend Mitglieder der Oberschicht, die Spuren hinterliessen. Aus nachvollziehbaren Gründen: So konnten sie etwa im 17. Jahrhundert im Gegensatz zu Frauen höhere Schulen besuchen; sie hatten in den Zünften das Sagen; sie stellten die Politiker; sie lenkten die Kirchen; sie verwalteten den Besitz der Frauen; sie dominierten das öffentliche Leben; sie allein waren per Gesetz handlungsfähig. Am männlichen Machtanspruch und seiner Durchsetzung veränderte sich im 18. und 19. Jahrhundert wenig.
Um diese Männerdominanz zu untergraben, richte ich den Scheinwerfer unter anderem auf eine Frau. Anna Margaretha Kitt lebte im 17. Jahrhundert und war in ihrem Zürcher Alltag als Haushaltsvorsteherin mit der weiten Welt verbunden. Ausser ihr stelle ich Salomon Kitt ins Licht, der im 18. Jahrhundert als Trittbrettfahrer bei der kolonialen Expansion mitmachte. Zudem hole ich Armin Kitt, der sich im 19. Jahrhundert in Kairo im Schatten der Kolonialmächte aufhielt, aus dem Dunkel. Auf meiner Reise durch die Vergangenheit – unterbrochen von Abstechern in die Gegenwart – gelange ich bis ins 16. Jahrhundert, als der erste Kitt nach Zürich zog. Von hier bewegten sich seine Nachkommen allmählich weltwärts.