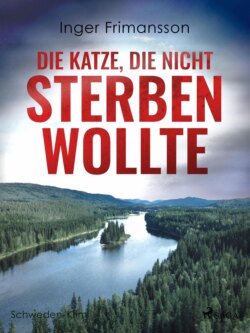Читать книгу Die Katze, die nicht sterben wollte - Schweden-Krimi - Ингер Фриманссон - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9. KAPITEL
ОглавлениеAls sie die Treppe hinabgingen, saßen zwei Mädchen auf ihr. Sie waren so in ihr Spiel vertieft, dass sie Beth und Ulf nicht kommen hörten, und erst als Ulf sie bat, ein wenig Platz zu machen, blickten sie auf. Beide hatten ein Plüschpferd mit einer langen und glänzenden Mähne im Arm.
»Wie heißt ihr?«, fragte Ulf, aber sie starrten ihn nur schüchtern an und antworteten nicht.
Im Auto begann Beth zu weinen. Er stellte keine Fragen, ließ den Wagen an und setzte rückwärts aus der Parklücke.
Nach einer Weile meinte er: »Das mit Susanne tut mir Leid. Es geht offensichtlich rapide bergab mit ihr.«
Beth schluchzte auf.
»Papa tut mir so Leid.«
»Sie können einem beide Leid tun.«
»Klar, aber ich glaube, sie bekommt gar nicht mehr so viel davon mit. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, in der sie stark und irgendwie zufrieden zu sein scheint.«
»Ja, man kann froh sein, dass man nicht weiß, was die Zukunft einem bringt.«
Beth zündete sich eine Zigarette an.
»Was ist eigentlich, wenn das erblich ist«, sagte sie leise. »Stell dir vor, ich werde auch so verrückt und absonderlich wie sie. Dann weißt du, was dich erwartet.«
»Keine Sorge, ich werde dich einfach in einem Heim unterbringen«, lachte er.
»Das wagst du nicht. Ich würde es dir heimzahlen. Nein, das war nur ein Scherz. Manchmal habe ich fast Angst vor ihr, so als wäre sie ein ganz anderer Mensch. Und dieser andere Mensch, diese fremde und gefährliche Susanne, muss es doch die ganze Zeit schon gegeben haben. In ihrem Inneren, meine ich. Als wir noch klein waren, Juni und ich, als sie Papa kennen gelernt hat. Schon immer. Obwohl man nichts davon geahnt hat. Das macht die Sache so beängstigend.«
Als Beth ihrem Vater nach dem Essen beim Abwasch geholfen hatte, war ihre Mutter in die Küche gekommen und hatte eine Milchtüte aus dem Kühlschrank geholt. Ehe sie jemand daran hindern konnte, hatte sie die Milch auch schon in die Toilette geschüttet. Anschließend schnitt sie die Verpackung auf und benutzte sie als Nachttopf. Als Beths Vater versuchte sie ihr abzunehmen, boxte sie mit den Fäusten gegen seine Stirn. Er wandte sich ab, aber Beth hatte trotzdem gesehen, dass ihm Tränen in den Augen standen.
»Vielleicht gibt es einfach nicht genug Dinge, mit denen sie sich beschäftigen kann«, überlegte Beth. »Wenn wir, Juni und ich, ihr Enkelkinder geschenkt hätten, wenigstens eine von uns, hätte das den Verfallsprozess vielleicht hinausgezögert, manchmal glaube ich das wirklich.«
Sie schluckte und fügte hinzu: »Ich habe es zumindest versucht.«
»Wir«, korrigierte er sie.
»Okay, wir. Juni und Werner aber nicht.«
»Woher willst du das wissen, vielleicht haben sie es auch versucht und wollen nur nicht darüber sprechen.«
»Juni mag keine Kinder, sie kann mit Kindern nichts anfangen. Das hat sie mir gegenüber schon mehrmals gesagt. Aber vielleicht sagt man so etwas auch nur, um sich keine Blöße zu geben.«
»Jeder will Kinder haben!«, erwiderte er knapp.
Daraufhin fing sie erneut an zu weinen, weil ihr alles wieder in den Sinn kam. Sie war damals nach einem anstrengenden Tag in der stickigen Luft des Klassenzimmers, von der sie Kopfschmerzen bekommen hatte, nach Hause gegangen. Die Schüler hatten ständig Unfug getrieben und nicht richtig zugehört und sie hatte nach dem Zeigestock gegriffen und so fest damit auf die Pulte geschlagen, dass er zerbrach. Ein Mädchen begann keuchend zu atmen und zu zittern, so als würde sie einen epileptischen Anfall bekommen, und Beth gelang es nicht, sie wieder zu beruhigen.
Sie kannte die Klasse erst seit zwei Monaten, aber vom ersten Tag an war die Stimmung im Klassenzimmer abweisend, ja fast feindselig gewesen. Eigentlich hätten sie eine andere Lehrerin bekommen sollen, die aber in letzter Sekunde gekündigt hatte. Man hatte beschlossen, dass Beth nicht ihre Klassenlehrerin werden sollte, da sie eh bald in den Mutterschutz gehen würde. Die Situation war weder für sie noch für die Klasse befriedigend. Dann gab es plötzlich keinen anderen Ausweg mehr.
Sie ging zu Carin Lagman, der Rektorin. Sie hatte stechende Kopfschmerzen.
»Ich muss nach Hause«, sagte sie und hob die Finger an die Stirn.
Carin Lagman saß an ihrem Computer. Beth konnte sich noch genau an die Bluse erinnern, die sie trug. Sie hatte ein Muster aus kleinen Hufeisen und Steigbügeln gehabt.
»Du liebe Zeit, es ist doch nicht etwa schon so weit?«, fragte sie besorgt.
»Nein, das ist es nicht. Aber mir geht es nicht gut, ich gehe jetzt nach Hause.«
»Soll ich jemanden bitten dich zu begleiten?«, fragte Carin Lagman, stand auf, legte den Arm um Beth und strich über ihren dicken Bauch. Beth schüttelte den Kopf.
»Nein, ist schon okay. Ich habe nur fürchterliche Kopfschmerzen.«
Es war ein sonniger und windiger Tag. Die Ebereschen hatte bereits ihre Blätter verloren, aber die Birken waren noch grün. Die Buslinie 119 kam pünktlich und sie fuhr bis zur Haltestelle Markviksvägen. Anschließend musste sie noch ein Stück eine Steigung hinaufgehen. Als sie die Tür aufschloss, war sie müde. Sie erinnerte sich noch an den Staub, der in einem Streifen Sonnenlicht wirbelte, und war unendlich müde. Als sie gerade ihre Jacke aufgehängt hatte, setzte die erste Wehe ein. Es war viel zu früh dafür, sie war erst im siebten Monat. Kontraktionen hatte sie schon früher gehabt, aber das hier war etwas ganz anderes. Ihr war sofort klar, dass es eine richtige Wehe war. Sie wartete einen Moment und versuchte ruhig und entspannt zu atmen. Dann setzte die nächste Wehe ein und fuhr ihr mit solcher Wucht ins Rückgrat, dass sie vor Schmerz laut aufschrie.
Sie rief Ulf an, aber er war für eine Reportage unterwegs, und niemand konnte ihr sagen, wann er wieder zurück sein würde.
»Was denn für eine Reportage?«, schluchzte sie.
»Er ist in der Börse, dort wird heute bekannt gegeben, wer den Literaturnobelpreis bekommt.«
»Aber ich bekomme doch ein Kind!«
Sie versprachen, ihn nach Hause zu schicken, sobald er zurück war. Mehr konnten sie im Moment nicht für sie tun, das konnte niemand. Was vor ihr lag, musste sie ganz allein durchstehen. Sie war voller Energie und glücklich gewesen und hatte sich so sehr auf diesen Moment gefreut.
Solche Schmerzen hatte sie sich nicht vorstellen können.
Nach einer Weile gelang es ihr ein Taxi zu bekommen. Der Fahrer war groß und ruhig, kleine rote Härchen wuchsen aus seinen Nasenlöchern.
»Keine Sorge, gute Frau, Sie kommen schon noch rechtzeitig hin«, tröstete er sie. »Aber selbst wenn es jetzt gleich kommen sollte, schaffen wir beide das schon. Hier sitzt ein Fachmann! Ich fahre rechts ran und dann klettere ich zu ihnen rüber, und sollte das Baby rausflutschen, bevor der Krankenwagen hier ist, nehme ich es in Empfang. Ich habe das schon mal gemacht, es hat wunderbar geklappt.«
»Was war es?«, stöhnte sie.
»Ein Junge. Allerdings war das nicht hier, sondern in Köping. Und dann kam die Presse und hat ein Bild von uns gemacht, ich habe es hier im Portmonee, ich zeige es Ihnen, wenn Sie möchten. Mutter und Kind und ich sind darauf . . . so als wäre ich der Vater. Sie meinte, sie würde den Jungen nach mir nennen, aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich getan hat, gesagt hat sie es jedenfalls. Und das findet man natürlich nett.«
Vermutlich erwartete er jetzt von ihr, dass sie nach seinem Namen fragte, aber eine neue Wehe war im Anmarsch und zwang sie dazu, sich nach hinten zu werfen und die Unterlippe zwischen die Zähne zu pressen.
Sie erinnerte sich noch an den Eingang zur Entbindungsstation. Eine Frau in einer luftigen Strickjacke stand davor. Sie fasste sich in den Rücken und blickte ausdruckslos ins Leere. Beth versuchte ihrem Blick zu begegnen, aber es war, als läge eine Haut über den Augen der Frau, sie hatte sich völlig in sich selbst und das, was in ihrem unförmigen Körper vorging, zurückgezogen.
Dann musste Ulf gekommen sein.
Ihr geliebter Mann und Freund. Er war gekommen und blieb die ganze Zeit bei ihr, den ganzen Tag und die Nacht und den ganzen nächsten Tag bis Mitternacht. Soweit sie sich erinnern konnte, versuchte er nicht einmal, zwischendurch ein wenig zu schlafen. Einmal aß er eine Banane. Das war ihr im Gedächtnis haften geblieben, weil sie sich vor dem faden Geruch ekelte, so wie sie sich vor der Konsistenz der Wörter ekelte, wenn er mit dem Bananenmus im Mund etwas sagte. Die Geräusche reizten sie und machten sie wütend.
Die Zwillinge wurden abends kurz nach zehn geboren, nach fast dreißig Stunden. Die Babys waren klein und unausgereift. Zu allem Überfluss hatte jedes von ihnen noch ein großes, entstellendes Muttermal, das eine auf der linken Wange und das andere auf dem Hals.
Es sah aus wie zwei Stempel. Ungenügend!
Natürlich stellte sie sich die übliche Frage, warum so etwas ausgerechnet ihr und Ulf passieren musste. Zwei Kinder, die nicht leben durften. Es war so ungerecht und grausam. Und warum? Es lag an ihren Herzen, sie waren zu schwach und zu klein. Der Fehler musste bereits zu Beginn der Schwangerschaft aufgetreten sein. In ihrem Inneren hatte sich etwas verschoben, sie taugte nicht, etwas war verkehrt. Jetzt erinnerte sie sich auch, dass sie von missgebildeten Föten geträumt hatte. Im Traum gebar sie Tiere, keine Kinder, sondern Tiere mit Schnäbeln und Kiemen. Träume dieser Art waren nichts Ungewöhnliches bei schwangeren Frauen. Aber es war ungewöhnlich, dass sich solche Träume erfüllten.
Sie war nie wieder schwanger geworden. Niemand konnte einen Grund dafür finden. Es hatte den Anschein, als würde sich etwas in ihr sperren, als säße die Angst wie eine massive und abstoßende Wand in ihrem Inneren, die Angst davor, dass es wieder passieren könnte und das Trauma sich wiederholte.
Unmittelbar nach der Geburt hatte Beth die beiden Kinder nicht angenommen, es ging ihr zu schlecht. Den Gesichtern des Personals hatte sie angesehen, dass etwas schiefgegangen war, sie sah, dass die Hebamme verkrampfte und sich hinter nervösem und hektischem Hantieren mit Verbänden und Kanülen verschanzte. Beth stellte keine Fragen. Das machte es für alle leichter.
Lange Zeit später bereute sie das. Aber da war es schon zu spät, sie zu berühren, ihre nackten Körper zu betrachten, den Konturen ihrer Leiber mit den Fingern zu folgen, nicht vor den braunen Flecken zurückzuschrecken.
Sie hätte ihnen gerne Namen gegeben, als sie noch am Leben waren, schöne Namen wie Alexandra und Frida. Zeitgemäße Namen. Vielleicht hätten sie die nötige Kraft zum Überleben geschöpft, wenn sie ihnen rechtzeitig Namen gegeben hätte.
Ulf glaubte nicht daran. Sie waren in vielen Dingen ganz verschiedener Ansicht. Das wurde ihr in den folgenden Monaten immer klarer.