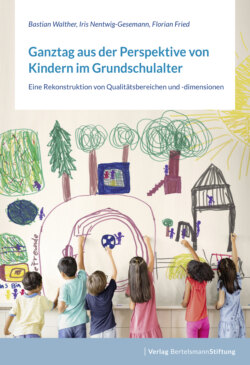Читать книгу Ganztag aus der Perspektive von Kindern im Grundschulalter - Iris Nentwig-Gesemann - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erhebungsmethoden
ОглавлениеInspiriert durch den multimethodischen Ansatz des Mosaic Approach5 (Clark 2017) und aufbauend auf dem differenzierten Methodenschatz, der in der Studie »Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung in KiTas« entwickelt und erprobt worden ist (Nentwig-Gesemann et al. 2021), wurden den Ganztagskindern maximal mögliche Freiräume eröffnet, ihre Erfahrungen, Orientierungen und Einschätzungen zum Ausdruck zu bringen.
Das Prinzip der Offenheit und der möglichst geringen (und dann in den Analysen immer mitinterpretierten und -reflektierten) Eingriffe der Forscher:innen in den Relevanzrahmen und die Ausdrucksweisen der Kinder gewährleistete ein hohes Maß an Gültigkeit, also an Angemessenheit und Adäquanz, mit der empirisch tatsächlich das Erfahrungswissen der Kinder rekonstruiert werden konnte.6 Die eingesetzten Erhebungsmethoden werden im Folgenden kurz vorgestellt.
Die Gruppendiskussion ist ein für die Kindheitsforschung besonders geeignetes Verfahren, das sich variabel den jeweiligen verbalen Ausdrucksweisen von Kindern unterschiedlichen Alters anzupassen vermag (Nentwig-Gesemann 2010; Nentwig-Gesemann und Gerstenberg 2014). Die Kinder, die an der Studie teilgenommen haben, konnten die für sie wichtigen Themen im Ganztag aufgreifen und diese in ihrer alltäglichen Sprache und der gewohnten Form der Interaktionsorganisation bearbeiten (Nentwig-Gesemann 2010: 6).
Ein besonderer Fokus auf Freundschaften und soziale Beziehungen der Kinder untereinander wurde in dialoggestützten, narrativen Interviews zum Thema »Freundschaft im Ganztag« gelegt (Weltzien 2012). Dabei erzählten immer zwei, in Ausnahmefällen auch drei Kinder, die sich selbst als Freund:innen bezeichneten, von ihren gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnissen im Ganztag.
Malbegleitende Gespräche (Bakels und Nentwig-Gesemann 2019) boten den Kindern die Möglichkeit, sich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen und mit den Forscher:innen ins Gespräch zu kommen. Möglich war, sich sowohl in den Prozess des Malens zu vertiefen und damit in eine symbolische Sprache, in der auch implizites, präreflexives Wissen ausgedrückt werden kann, als auch intensive, dialogorientierte Gespräche mit den Forscher:innen zu führen.
Die Methode Kinder fotografieren ihren Ganztag wurde in Anlehnung an die »Autofotografie« von Deinet (2009: 78 f.) entwickelt: Je zwei Kinder erhielten eine Kamera, mit der sie abwechselnd ihre Lieblingsorte, »blöde Orte«, Rückzugsorte oder interessante Orte fotografieren sollten. Im Anschluss wurden die digitalisierten Fotos gemeinsam mit den Kindern angeschaut, um mit ihnen – fotobasiert – über ihre Erfahrungen, Aktivitäten und Sichtweisen ins Gespräch zu kommen.
Schließlich wurde den Kindern in einer separaten Forschungsstation eine Briefbox samt Materialien (Karteikarten, Stifte, Stempel, Aufkleber mit Smileys) zur Gestaltung von Briefen zur Verfügung gestellt. Die Kinder wurden gebeten, Ideen, Kritik, Wünsche oder Lob zu formulieren und diese (anonym) als »Briefe« in die Box zu werfen.
Um auch aus der unmittelbaren Praxis im Ganztag Rückschlüsse auf die Orientierungen der Kinder ziehen zu können, wurde zusätzlich fokussiert teilnehmend beobachtet (Heinzel et al. 2010; Krüger 2006). Die dokumentarische Auswertung der Beobachtungsprotokolle von Situationen beim Mittagessen, bei den Hausaufgaben und im Freispiel ermöglichte – ergänzend zu den gesprächsorientierten Erhebungsverfahren – die Rekonstruktion von Interaktionsqualität, also der Qualität der interaktiv hervorgebrachten Beziehungen zwischen den Kindern sowie zwischen ihnen und den pädagogischen Fachkräften.