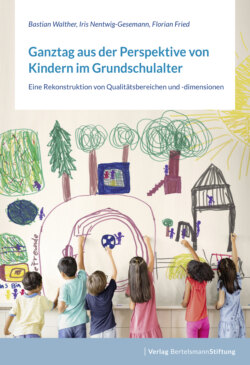Читать книгу Ganztag aus der Perspektive von Kindern im Grundschulalter - Iris Nentwig-Gesemann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDer Ausbau der Ganztagsschulen in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren schnell und dynamisch entwickelt: »Lag der Anteil an Ganztagsschulen an allen schulischen Verwaltungseinheiten im Jahr 2005 noch bei 28 Prozent, liegt er inzwischen laut aktueller Statistik der Kultusministerkonferenz (KMK 2018) im Schuljahr 2016/2017 bei knapp 68 Prozent« (DIPF et al. 2019: 8). Wenn im Jahr 2025 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt wird, ist anzunehmen, dass – analog zur Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz – die Besuchsquoten des Ganztags stark steigen werden (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020: 121 f.). Um eine ganztägige Betreuung von Grundschulkindern gewährleisten zu können, müssen in den nächsten sechs Jahren etwa 820.000 neue Plätze geschaffen werden (DJI 2019). Mit dieser Entwicklung ist auch der klassische Hort (der vor allem in den ostdeutschen Bundesländern eine ausgeprägte Tradition hat, vgl. Autorenkollektiv 1987) als sozialpädagogisches Angebot der Kinder- und Jugendhilfe mit einem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag wieder in den Blick gerückt und die Debatte um eine Professionalisierung der Hortpädagogik ist angestoßen worden. Nordt und Strätz (2017) konstatieren diesbezüglich einen Mangel an Verknüpfungen zwischen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten sowie an Konzepten zur Kooperation von schul- und sozialpädagogischen Fachkräften.
Verbunden mit dem Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung schreitet die Entwicklung zur »Kindheit in Institutionen« (Baader 2014: 442 ff.) weiter voran und es stellt sich dringlicher denn je die Frage nach den Erfahrungen, Orientierungen, Einschätzungen und Wünschen der Kinder. In Schule, Ganztag und Hort geht es ganz zweifelsfrei um das Kind direkt »berührende Angelegenheiten« und darum, sein »Wohl« vorrangig zu berücksichtigen (UN-Kinderrechtskonvention 1989; Wapler 2020). Dieses Wohl (»best interests of the child«) kann – werden Kinder als gleichwürdige und mit Rechten ausgestattete Subjekte anerkannt – nicht nur von außen bestimmt werden, sondern muss die Perspektiven der Kinder und ihr subjektives Wohlbefinden maßgeblich berücksichtigen. Die Rechte der Kinder – ihr Recht auf Achtung ihrer Würde, ihr Recht auf Bildung sowie auf Spiel, Freizeit und Erholung, ihr Recht auf Beteiligung, also darauf, gehört zu werden, mitwirken und mitbestimmen zu können – bilden auch in Schule, Ganztag und Hort das Fundament, auf dem Beziehungs- und Bildungsarbeit ruhen.
Im Zentrum der explorativen Studie, deren Ergebnisse hier zusammenfassend vorgestellt werden, stand die Rekonstruktion der Erfahrungen und Praktiken, der Orientierungen und Relevanzen von Grundschulkindern in Bezug auf den Ganztag1. In einem kontinuierlichen Prozess des Vergleichens konnten 14 Qualitätsdimensionen in vier Qualitätsbereichen herausgearbeitet werden. Dabei handelt es sich um – zwischen positiven Horizonten und negativen Gegenhorizonten2 aufgespannte – typische Orientierungen von Kindern hinsichtlich der Frage, was aus ihrer Perspektive einen guten Ganztag ausmacht. Eingegangen sind auch explizite Einschätzungen und Bewertungen der Kinder, doch der Formulierung der Qualitätsdimensionen liegen vor allem ihre impliziten Wissensbestände zugrunde, die aus Fokussierungssequenzen3 rekonstruiert wurden.
Die Studie verortet sich methodologisch-methodisch in einer spezifisch wissenssoziologisch fundierten, praxeologisch ausgerichteten Kindheitsforschung, in deren Zentrum die Dokumentarische Methode (Bohnsack 2014, 2017; Bohnsack, Nentwig-Gesemann und Nohl 2013) steht. Im Folgenden werden wir kurz von »Dokumentarischer Kindheitsforschung« sprechen (Nentwig-Gesemann et al. 2021; Wagner-Willi, Bischoff-Pabst und Nentwig-Gesemann 2019).
1Mit Ganztag sind im Folgenden alle Formen der ganztägigen Betreuung von Schulkindern in Grundschulen und Horten gemeint.
2Mit (Gegen-)Horizonten werden in der Dokumentarischen Methode explizite und vor allem implizite (z. B. narrativ entfaltete) Vergleichshorizonte bezeichnet, zwischen denen ein Orientierungsrahmen gleichsam aufgespannt ist: Wohin streben Orientierungen, was ist ihr positives Ideal und wovon grenzen sie sich ab? (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014: 296).
3Mit Fokussierungssequenzen werden in der Dokumentarischen Methode Fokussierungs-metaphern und Fokussierungsakte bezeichnet, besonders selbstläufige, interaktiv dichte, metaphorisch-szenisch aufgeladene Passagen, in denen sich Erlebniszentren dokumentieren (vgl. genauer: Nentwig-Gesemann 2010).