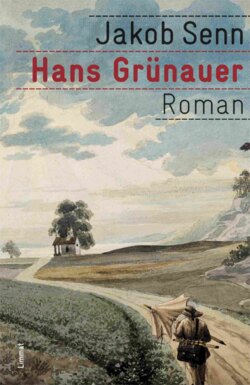Читать книгу Hans Grünauer - Jakob Senn - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеMein Vater war das jüngste von dreizehn Kindern, darum wurde er nicht bloß von seinen Geschwistern, sondern auch von der ganzen Nachbarschaft zeitlebens der «Kleine» genannt, obgleich er körperlich größer war als alle seine Geschwister. Ein achtzehn Jahre älterer Bruder wohnte im Nebenhause, welches seit unvordenklichen Zeiten das eigentliche Stammhaus unserer Familie gewesen war. Früher, bei Lebzeiten der Großeltern, war das Haus meines Vaters an eine Familie vermietet gewesen, von welcher man allgemein wußte, daß sie mehr verstehe als Brot zu essen. Dieselbe bestand aus Vater, Mutter und vier Töchtern, letztere von wunderbarer Schönheit, von denen jedoch, ungeachtet ihrer körperlichen Vorzüge, nur die jüngste zur Heirat gelangte, da die übrigen gleich der Mutter «Hexen» waren und durch diese Berühmtheit der männlichen Bevölkerung allzugroßen Respekt einflößten.
Der älteste Bruder meines Vaters, der, gleich mir, Hans hieß, war ein leidenschaftlicher Liebhaber vom Frakturschreiben und füllte mit dieser Schrift eine unglaubliche Menge von teilweise dicken Heften aus; Nachtmahlbüchlein und kleine Katechismen schrieb er zu vielen Hunderten, alle aufs sauberste, jede Seite mit einer großen farbigen Initiale verziert. Das hatte er ohne eigentlichen Schulbesuch erlernt, und da seine tägliche Beschäftigung in landwirtschaftlichen Arbeiten bestand und er bloß achtundzwanzig Jahre alt wurde, so scheint es geradezu unbegreiflich, wie es ihm möglich war, so viel Papier mit Frakturschrift zu bedecken.
Hans schrieb denn auch die Nachtmahlbüchlein für die schönen Hexlein, und er konnte dem Zauber eines derselben nicht widerstehen und verliebte sich in es, es hieß Margritli. Die Eltern Hansens waren aber besonders hart gegen diese Liebschaft und verboten dem Liebhaber bei Seel und Seligkeit das Betreten der Hexenwohnung, sowie überhaupt allen Verkehr mit der Hexenfamilie. Mein Vater war damals sechs oder sieben Jahre alt und wurde von Hans als geheimer Liebeskurier verwendet, wofür ihm Margritli manch schneeweißes Stücklein Brot bescherte mit einem so süßen Stoffe darauf, daß der Empfänger lebenslang glaubte, selbes sei keine natürliche, sondern eine zauberhafte Süßigkeit gewesen. Aber Hans kriegte den Lohn für seinen Ungehorsam, er bekam die Schwindsucht und starb daran, die Feder in der Hand, mitten in einem Nachtmahlbüchlein und mitten im Worte zu schreiben aufhörend. In Hansens Sterbestunde war mein Vater bei Margritli, er hatte ihr das letzte Brieflein gebracht, sie wußte, daß es das letzte war, und durfte doch nicht zu Hans, durfte nicht selber ihm die lieben, treuen Augen zudrücken. Ihr verzweifeltes Gebaren machte auf meinen Vater einen unauslöschlichen Eindruck. Sie preßte ihn auf ihren Schoß, drückte sein Köpflein an ihren Busen, wickelte die langen braunen Zöpfe ihres Hauptes um die Hand und raufte, als wollte sie diesen Schmuck für immer herunter reißen. Als der Junge darauf seiner Mutter erzählte, wie Margritli getan, da sagte sie: «Die hat wohl Ursache dazu! Der Hans ist ihr jetzt entkommen und einen andern wird sie wohl nicht wieder bekommen.» Der Grund, warum die Hexen nach Männern höchst begierig waren, war nach ihr der, daß sie nur dann dereinst selig sterben konnten, wenn sie im Ehestand Mutter geworden waren und wenn möglich ihren letzten Atemzug in des Mannes Mund aushauchen konnten.
Diese Hexenfamilie wohnte einundvierzig Jahre lang in besagtem Hause, wobei sie ein großes Stück Ackerfeld benutzte und jährlich achtzig Mannslasten aus den Waldungen bezog, alles für den Jahreszins von dreizehn Gulden. Mein Großvater hatte wohl auch nach und nach gefunden, diese Jahresrente sei etwas zu niedrig angesetzt, aber nie hatte er es gewagt, den zauberfähigen Mietsleuten gegenüber aufzuschlagen oder aufzukünden. Endlich war das Hexenelternpaar gestorben und es waren nur noch die drei älteren Töchter beisammen. Mit diesen glaubte es ein junger, starker Nachbar aufnehmen zu dürfen, nachdem ihm meines Vaters Bruder die Wohnung für ein Jahr zinsfrei zugesagt, falls er es wage, das Weibergeschmeiß hinauszutreiben. Der Nachbar säuberte richtig das Haus, aber die älteste Hexenjungfrau, welche er gewaltsam hinausstieß, sagte ihm lächelnd vor der Türe: «Kaspar, es kann dir im weiten Haus noch zu eng werden!» Und Tatsache ist, daß dieser Kaspar einige Jahre später an Engbrüstigkeit starb.
Noch vor diesen Vorgängen waren meine Großeltern gestorben und des Vaters sämtliche noch lebende Schwestern in den Ehestand getreten. Die Brüder schritten zur Teilung der Liegenschaften. Die Grundstücke lagen zerstreut nach vielen Seiten; statt nun aber dieselben als ganze Stücke dem einen oder andern zuzuweisen, wurde jedes, auch das kleinste Stück in zwei Teile geteilt. Dabei ging man folgendermaßen zu Werke: In das zu teilende Stück wurden durch einen herbeigezogenen Vertrauensmann Merkzeichen gesteckt, der eine Teil mit Eins, der andere mit Zwei bezeichnet. Dann nahm jeder der Brüder zwei Steinchen in die Hände und wies auf die Frage des Vertrauensmannes, welchen Teil er vorziehe, ein oder zwei Steinchen vor. Fiel die Wahl beider auf den gleichen Teil, so mussten die Zeichen («Ziele») so lange verändert werden, bis die Wahl entschieden hatte. Das nannte man «runen». Nun hatte sich mein Vater von Anfang geäußert, er wünsche für seinen Teil das Stammhaus, weil er nicht in das von den Hexen bewohnt gewesene einziehen möchte. Das merkte sich der ältere Bruder und wußte es so zu richten, daß je die schönere Hälfte der Grundstücke der verhaßten Wohnung zugeteilt wurde, vor welcher er selber geringeres Grauen empfand. Als nun die Teilung in dieser Weise bereits sehr günstig arrangiert war, verlor der Vater plötzlich die Vorliebe für das Stammhaus und wählte die verrufene Hexenwohnung samt den dazu gehörenden Grundstücken. Solcherweise hatte sich der ältere Bruder, der den Jüngeren übervorteilen gewollt, selbst betrogen und blieb darob zeitlebens verstimmt.
In seinem vierundzwanzigsten Jahre heiratete mein Vater ein Mädchen aus dem Schulkreise Nideltobel. Dieser Ehe entsprossen innerhalb zehn Jahren fünf Kinder, von welchen ich das mittlere war. Das jüngste starb bald nach der Geburt, das älteste, ein Mädchen, Betheli, starb in seinem dreizehnten Jahre an Blutarmut. Einen Tag vor seinem Tode flocht es meine ersten langgewachsenen Haare in Zöpfe, welche alsdann von der Mutter abgeschnitten und zum Andenken an die Verstorbene aufbewahrt wurden, sodaß sie noch heute in meinem Schreibtische liegen. Meine beiden andern Geschwister waren Brüder, von welchen der ältere Kaspar, der jüngere Jakob genannt wurde.
Der um vier Jahre ältere Kaspar besuchte die tägliche Schule, wovon ich oft hörte, äußerst begierig, zu erfahren, was die Schule für ein Ding sei. Ich durfte denn auch einmal nach langem Bitten mit Kaspar hingehen. Das Schulhaus stand drüben in Frühblumen und der Weg dahin führte über die Tosa, deren Ufer nur durch zwei auf einer Seite flach behauene Tannenbäume verbunden waren, deren dünne Enden in der Mitte des Flußbettes zusammenreichten und dort lose auf einem erhöhten Steine lagen, während durch die Wurzelenden je ein Pfahl in den Wuhrboden getrieben war. Wenn dann die Tosa stark anschwoll, so wurden die beiden Bäume vom Steine weggespült und blieben längs den Wuhrseiten hängen, bis das Wasser sich soweit gesetzt hatte, daß sie wieder auf den Stein gehoben werden konnten. Über diesen Steg führte der Weg in die Schule. Dieselbe fand ich schon beim ersten Besuche so sehr nach meinem Geschmacke, daß ich, als Kaspar folgenden Tages meine Begleitung verbat, so lange bei der Mutter anhielt, bis sie mir erlaubte allein hinzugehen, mir die gestrichelte Zipfelkappe aufsetzte und auch auf dringendes Verlangen einen «Lobwasser» herunterreichte, damit ich, ein Buch unterm Arme, einem Schüler ähnlich sehe. So zog ich meines Weges und gelangte auf den Steg, gaffte in das fließende Wasser, meinte, der Steg fließe mit, trat ihm nach und patsch spritzte es auf, ich schwamm in tiefster Strömung. Ein unfern dem andern Ufer stehender Schlossergeselle bemerkte mein Unglück und holte mich schon Bewußtlosen heraus. «Lobwasser» und Zipfelkappe waren dahin, keineswegs aber die Lust am Schulbesuch, so daß ich noch dreimal, bevor derselbe für mich obligatorisch wurde, bei gleicher Veranlassung in die Tosa stürzte.
In diese Zeit fällt das Sterben eines meiner Altersgenossen, das mir seiner besondern Umstände wegen unvergeßlich geblieben ist. Er war das einzige Kind eines jenseits der Tosa wohnenden bemittelten Bauers. Diesem Hause durfte ich eines Sonntagnachmittags in Begleitung meiner Eltern einen Besuch machen. Dasselbe befand sich etwas außerhalb der dorfähnlichen Häusergruppe Frühblumens auf freiem Wiesenplan und die Bewohner derselben pflegten von jeher mit der Nachbarschaft wenig Gemeinschaft zu haben. An diese Eigenschaft wurde auch der jüngste Sproße von frühe an gewöhnt trotz dessen ausgesprochenem Widerwillen, da er bedeutsame Anlagen für Geselligkeit verriet. Körperlich weit entwickelter als ich, war er doch von äußerst zarter Gesundheit, mußte vor Kälte und Nässe wohl bewahrt bleiben und bei großer seelischer Reizbarkeit ebenso vor gemütlichen Anfechtungen. Schon deshalb ließ man ihn nie ohne Aufsicht bei andern Kindern und suchte ihm das Leben innerhalb der vier Pfähle des väterlichen Hauses vor allem beliebt zu machen. So kam denn gerade diesem Jüngsten seines Stammes unser Besuch sehr erwünscht. Nach einigen spürsamen Umgängen ward von uns Kameradschaft geschlossen und wir tummelten uns auf Weg und Wasen nach Herzenslust. Der Knabe trug den damals in Grünau noch seltenen Namen Jean, aus welchem «Schangli» gemacht wurde. Wie sehr beneidete ich den Besitzer darum! Wie läppisch und abgebraucht hörte sich dagegen Hans mit dem Diminutiv «li»; ich konntʼ es nicht satt werden, Schangli zu rufen, so sehr es mich verdroß, jedesmal «Hansli» widerhallen zu hören. Schangli zeigte mir alle Herrlichkeiten in Haus und Stall und ringsherum, und zu allem, worüber ich mein Wohlgefallen äußerte, sagte er: «Das ist mein, der Vater, oder die Mutter hatʼs gesagt.» Er führte mich hinaus unter die Bäume, wo rotwangige Joggenbergeräpfel und honigsüße Schafmattbirnen im Grase lagen; er führte mich aber ganz besonders zum langen ungestutzten Haselhag, wo ganze Höcke bräunlich gereifter Nüsse zum Pflücken einluden. Welche Lust, wenn die Nüsse schon beim Berühren aus der grünen Hülse fielen! Welch Behagen, in die Tasche zu langen, wo der Vorrat gar merklich wuchs! Wir pflückten, bis das Abendrot erlosch, bis in die Nacht hinein. Endlich mußten wir aufhören, da der Sterne Schein zu geringen Ersatz bot für das verschwundene Tageslicht. Wir krabbelten von den Stauden hinunter, setzten uns aber trotz den tiefen Schatten der Nacht noch zum Zählen der Nüsse ins Gras. Allein es ging nicht und wir sahen immer aufwärts, ob denn niemand die Lichter des Himmels ein wenig heller machen wolle. Auf einmal entdeckten wir beide zugleich einen seltsam hellen Stern, der die andern Sterne mächtig überglänzte. Eine Weile sahen wir entzückt hin, dann sagte Schangli:
«Sieh, Hansli, dort ist mein Stern!»
«Er ist aber auch mein Stern», erwiderte ich, ärgerlich und eifersüchtig, daß mein Kamerad sich sogar die Sterne am Himmel zueignen wollte.
«Nein, nein, er ist allein mein Stern, die Mutter hatʼs gesagt!» antwortete Schangli in zornigem Eifer. Seine anmaßliche Beharrlichkeit machte auch mich wärmer und ich erneute meine Ansprüche in kecken Ausdrücken.
Schangli wurde immer hitziger und böser, er drohte mir, es seiner Mutter zu vermelden, falls ich ihm das alleinige Eigentumsrecht auf den Stern fürder streitig machen wolle. Das verursachte mir geringe Furcht; konnte ich ja erwidern, daß auch ich eine Mutter habe, der ich die Anmaßung Schanglis klagen durfte. So war von Nachgeben beiderseits keine Rede und nicht lange gingʼs, so lagen wir einander in den Haaren. Schangli zog trotz seiner längern Postur das Kürzere, ich drückte ihn mit einer Erbitterung zu Boden, die ihm das Leben hätte kosten können. Er schrie aber noch rechtzeitig und bat mich inständig, ihn frei zu lassen. Ich forderte dagegen Zurücknahme seiner übertriebenen Ansprüche, welcher Forderung er zögernd und unter heißen Tränen nachkam. Allein kaum hatte ich ihn losgelassen, als er seine Ansprüche erneuerte, doch jetzt nicht fordernd, sondern bittend.
«Hörʼ, Hansli, der Stern ist wahrlich mein, fragʼ nur meine Mutter.»
Ich schüttelte den Kopf: «Deine Mutter weiß es nicht.»
«Doch, sie weiß alles; hörʼ Hansli, laßʼ mir doch den Stern, ich brauche ihn, ich kann ihn nicht weggeben. Gelt, Hansli, Du läßest mir ihn?»
Die Bitte Schanglis war so rührend, daß ich trotz der hohen Schätzung meines Anteils an dem prächtigen Stern die Verzichtleistung auf denselben aussprach. Schangli merkte, wie nahe es mir ging, und trat mir zu etwelcher Entschädigung seinen ganzen Vorrat von Nüssen ab, der freilich während des Ringens im Grase größtenteils verstreut worden war.
Als wir zurückkamen, hatten die Mütter uns schon eine Weile mit Schmerzen gesucht. Schanglis Mutter insbesondere jammerte, daß ihr Büblein so lange draußen im Nachttau geblieben, was ihn ja krank machen könnte.
Mehrere Tage später, während welchen es viel geregnet hatte, nahm mich die Mutter abends nach ihrer Gewohnheit in den Stall, damit ich, während sie die Kühe molk, meine Gebetlein hersage. Ich saß dabei auf der Schwelle der Stalltüre, das Gesicht ins Freie gewendet. Die Sterne schimmerten wieder hell und ich suchte unwillkürlich Schanglis Stern. Ich glaubte, ihn gefunden zu haben, als plötzlich eine Schuppe von der fixierten Stelle fiel, worauf mir seltsamerweise auch der Stern entschwunden war. Das überraschte mich so sehr, daß ich mich selber im Gebete unterbrach, mit dem Ausrufe: «Nein, o Mutter, Schanglis Stern ist herunter gefallen!» Die Mutter lächelte und ermahnte mich, beim Beten ruhig zu sein, ich dürfe nicht an etwas anderes denken. Ich aber brachte es nicht aus dem Sinn und behelligte sie noch mit mannigfachen Fragen und Anreden. Schanglis Stern erglänzte von neuem in den Träumen der Nacht, aber auch der Fall wiederholte sich. Am Morgen kam die Mutter an mein Bettlein und weckte mich mit der Trauerkunde: «Hansli denkʼ, der Schangli ist gestorben! Gestern Abend ist er verschieden. Betʼ für den Schangli, daß er ein Engelein werde.» Ich betete inbrünstig für den verstorbenen Freund. Am nächsten Abend sah ich durch Tränen wieder nach dem Firmamente und, o Wonne, ich sah den Stern schöner und heller glänzen, als je. Und unaussprechlich freute ich mich für den Schangli, von dem die Mutter tröstend sagte, daß er jetzt auf seinem Stern daheim sei.