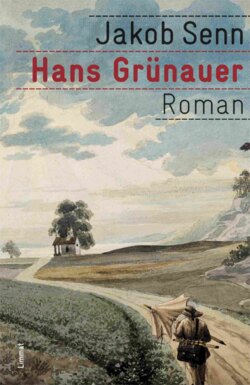Читать книгу Hans Grünauer - Jakob Senn - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеIch wurde jetzt ans Spulrad gewiesen und erhielt meinen täglichen regelmässigen Rast, so daß wenig Gefahr blieb, mutwillig zu werden. Es waren mir Tage tiefster Betrübnis und ich las zur Erholung nichts mehr so gern, als die Sterbeseufzer und Sterbelieder in unseren Andachtsbüchern. In einem derselben fand sich die Abbildung eines Friedhofes mit einem offenen Sarg, in welchem ein junges Mädchen lag, weiß und still, die rechte Hand ruhsam auf die linke gelegt, die Augen wie zum süßesten Schlummer geschlossen; Schaufel und Sargdeckel lagen daneben und viel gebleichtes Gebein umher; um verwitterte Kreuze blühten Rosen und Vergißmeinnicht, Hügel an Hügel reihte sich zierlich bis an das offene Grab und jenseits des Grabes war noch frischer Boden zu neuen Gräbern und ich hätte gerne mein eigenes Grab dicht bei dem offenen Graben gesehen, es schien mir so lockend, neben der weißen Leiche vom Spulen ausruhen zu können.
Es war keine leere Gefühlständelei, das Wohlgefallen an dem Bilde erwuchs zur Hoffnung, daß es vielleicht möglich sei, den Tod herbeizusehnen; die Mutter erschrak nicht wenig, als sie eines Abends in der Dämmerung vom Felde kommend mich mit einem langen Hemde angetan auf der Bank liegend fand, Hand auf Hand gelegt, akkurat wie bei der Leiche im Sarg, und tief schlafend. Die Ähnlichkeit war ihr beim ersten Anblick aufgefallen. Als sie mich geweckt hatte, fragte sie mich weich, was mich auf diesen Einfall gebracht habe? Ich gestand ihr ohne Hehl, daß ich gerne sterben möchte, um vom Spulen erlöst zu werden. Darüber schoß ihr das Wasser in die Augen und sie sagte: «Ich glaubʼ es Dir, Hans, das hast Du von mir, siehst mir nicht umsonst so ähnlich. Lug, als ich ein Kind war von Deinem Alter, da mußtʼ ich auch schon Seide spinnen; das war aber keine so leichte Beschäftigung, wie das Spulen, ich brachte lange kein rechtes Garn heraus und wurde deshalb täglich gekeift. Da wünschte ich auch zu sterben und freute mich, als ich schwer krank wurde, und wollte keine Arznei nehmen, damit ich ja nicht mehr aufkomme. Aber nachher bin ich doch wieder froh gewesen, daß ich nicht hatte sterben müssen. Sag, was tätest Du denn lieber, als spulen?» – «In die Schule gehen!» erwiderte ich schluchzend, «ach, wenn ich nur wieder in die Schule gehen könnte!» – «Ja, das möchten ich und der Vater Dir wohl gönnen, aber der Schulmeister will ja nichts mehr von Dir wissen. Sag aber, weil Du so ungern spulst, möchtest Du vielleicht weben lernen?» – «Ja», sagte ich, froh, nur irgendein Mittel zu finden, das mich vom Spulen erlösen könnte.
Die Mutter versprach, gleich morgen damit anzufangen, und sie hielt Wort, ich durfte an den Webstuhl sitzen. Aber nun zeigte sich erst, welch eine kleine Person ich war. Meine Füße reichten noch nicht auf die Tretschienen hinunter und letztere mußten daher um so viel höher heraufgezogen werden, auf das Sitzbrett mußte ein zweites Brett gelegt werden, damit ich auch Höherliegendes erreichen möge. Begriffen war meinerseits die Hexenkunst nun bald, dieses Lob gab mir die Mutter und es tat mir wohl, konntʼ ich doch daraus den Trost schöpfen, nicht für lebenslänglich zur Spulerei verdammt zu sein. Ich ließ mich denn auch mit einem so unsinnigen Eifer an, daß ich mein Hemd meist bachnaß schwitzte und die Mutter mich bat, sachter zu Werke zu gehen. Ich hielt die Mahnung für mütterliche Artigkeit und wurde um so eifriger, ihr Ursache zur Wiederholung derselben zu geben. Doch nun zeigte sichʼs, daß mein schnell verfertigtes Fabrikat ihr Bedenken erregte; war sie anfangs durch die Schönheit meines Tuches in Verwunderung gesetzt worden, so rückte sie jetzt mit Tadel um Tadel heraus, und wenn ich mich tröstete, daß sie mein Tuch in dieser oder jener Hinsicht doch nicht übel gefunden habe, so kam sie unfehlbar das nächste Mal auch auf diesen Punkt zu sprechen, bis ich endlich begriff, daß an meinem Tuche eigentlich gar nichts Gutes sei.
Das war schon ein kleiner Anfang zu neuem Mißbehagen, dessen, wie mir schwante, noch ein gut Teil auf mich warten mochte. In den paar ersten Wochen dieser neuen Berufsperiode war mir mehrenteils nur in den Stunden zu weben vergönnt, in welchen die Mutter anderweitig beschäftigt war; wenn aber sie wob, mußte ich wieder zum Spulrad sitzen. Diese Abwechslung ließ ich mir in Ermangelung von etwas besserm gern gefallen; das Spulen war im Verhältnis zum Weben wirklich ein Kinderspiel, da letzteres den kleinen Körper teils strahlenförmig auseinanderrenkte, teils über die Brust wie mit einem Knebel preßte. Mir bangte daher, das Weben dürfte in die Länge noch viel weniger nach meinem Geschmacke sein, als das Spulen und blangerte bald gar nicht mehr auf die Gelegenheit, mich in dieser Kunst zu vervollkommnen. Mein älterer Bruder, Kaspar, war schon vor ein paar Jahren in dieselbe eingeweiht worden und er hatte oft im Bett zu mir geklagt, was es für eine Schinderei sei mit dem Weben und er wünschte sehr, daß der Unmensch, welcher das Weben erfunden habe, noch im Jenseits weben müßte. Er war daher sehr froh, daß der Vater so viele Grundstücke besaß, um mit Beschäftigung im Freien die schönere Jahreszeit hinbringen zu können und höchstens im Winter an den Webstuhl gebannt zu sein. Damals hatte ich seinen Jammer nicht verstanden und er hatte tauben Ohren gepredigt, ich war wohl sogar darüber eingeschlafen und er hatte mich dann gestupft und unwirsch gefragt: «Magst denn nicht ein wenig hören?» Und wenn ich fortschlief auch sich aufs Ohr gelegt und geseufzt: «Da sieht man, wie ruhig einer schlafen kann, der noch nichts vom Weben weiß!»
Diese brüderlichen Herzensergüsse tauchten jetzt in meinem Gedächtnisse auf und ein so klares Verständnis begegnete denselben, daß ich davor wie vor einer Unglücksprophetie zurückschauerte. Doch tröstete ich mich leidlich mit der Voraussetzung, man werde meine Versuche als Spielerei betrachten und sich nicht beifallen lassen, mich zum eigentlichen Weber ausbilden zu wollen. Doch als ich eines Mittags aus der Repetierschule zurückkam, hörte ich ein starkes Gepolter in der Stube. Es ward mir etwas unheimlich, mein Ahnungsvermögen verhieß mir nichts Gutes. Und siehe, als ich in die Stube trat, da standen dem mütterlichen Webstuhl gegenüber bereits drei andere Stuhlbäume zwischen Boden und Diele gezwängt und den vierten sägte der Vater eben zurecht. Jetzt wußte ich, wie viel Uhr es geschlagen hatte, und ich hätte über dieses Ereignis wohl vierzigtägige Trauer anlegen mögen. Der Webstuhl war für mich bestimmt, und es stand mir frei, dazu ein saures oder süßes Gesicht zu machen. Der Vater bemerkte ironisch, er wisse wohl, daß ich noch keine Stricke zerreißen werde, aber weil ich schon geschworen habe, daß ich nicht mein Leben lang spulen werde, so habe er mir zum Worthalten behilflich sein wollen.
So war ich denn traurig genug eingeschifft auf der Woge des Lebens, da es wirklich des Vaters ausgesprochene Absicht war, mich berufsmäßig an den Webstuhl zu binden. Er richtete mir denselben aufs beste ein und die Mutter half im Schweiße ihres Angesichts mit, bis alles leidlich im Gange war. Ich begann mit ihr zu wetteifern und sie rühmte heuchlerisch, ich tue es ihr merkwürdig zuvor. Dazwischen erzählte sie mir manches Geschichtlein, wovon sie meist den Anfang oder das Ende oder ein Bindeglied verloren hatte, in welchem Fall es mir Vergnügen machte, die defekten Stellen sehr sinnreich zu ergänzen. Dasselbe war mit manchem traditionellen Volksliede der Fall, das sie mir so lange vorsagte, bis ich es innehatte. Daß keines der mitgeteilten Stücklein von erotischen Elementen ganz frei war, lag im Geiste der Volkspoesie. Indessen barg diese volkstümliche Erotik für die kindliche Unschuld kaum einige Gefahr, da dem Reinen alles rein war, die Liebessituationen einfach auf elterliche oder geschwisterliche Freundlichkeiten bezogen wurden und kein Erklären die gefährliche Wirklichkeit entschleierte. Meine Mutter erzählte mit Vorliebe Beispiele von Strafgerichten Gottes wegen allerhand Gottlosigkeiten der Menschen. Eine der lieblichsten dieser mütterlichen Erzählungen mag hier folgen:
«Ein Jüngling saß singend in einem Nachen auf einem breiten reißenden Strome und ruderte aus allen Kräften, um schnell an das jenseitige Ufer zu gelangen, wo seine Geliebte, das schönste Mädchen des Stromtales, wohnte. Als er in die Mitte des Stromes kam, drang der Hülferuf eines Verunglückten an sein Ohr. Er blickte flüchtig hin und sah ein altes Weib mit den Wellen kämpfen, die es hinunterschlingen wollten ins nasse Grab. Er aber kehrte sich nicht daran und eilte, hinüberzukommen. Die Stimme klang immer flehentlicher, aber schwächer und leiser. Die Arme schwamm am Nachen des Jünglings vorüber, hinab, ihr Rufen verstummte. Doch plötzlich, wenige Klafter von dem Fahrzeug entfernt, tauchte sie leicht wie ein Nebelgebilde aus den Wellen empor, und es war keine häßliche Alte, sondern die schönste aller Jungfrauen, noch unendlich schöner als seine Geliebte, die schon harrend und winkend am Ufer stand. Die Jungfrau im Strome aber rief zürnend: «Fahrʼ immer zu! Fahrʼ zu in Ewigkeit!» Und sie schwamm spielend wie ein Schwan stromabwärts. Den Jüngling aber ergriff unnennbare Sehnsucht nach der Unvergleichlichen, die seine Sinne bezauberte. Er vergaß der harrenden Geliebten und fuhr hinab der Unbekannten nach, die in immer gleicher Entfernung vor seinen Augen dahinschwamm, nicht achtend auf sein liebeflehend Rufen und nur von Zeit zu Zeit ihm vorwurfsvoll ihr leuchtend schönes Antlitz zukehrend. Der Jüngling fuhr Tage, Wochen und Jahre stromabwärts, aber das Ziel seiner Sehnsucht vermochte er nie zu erreichen. Und so fährt er noch immer zu, bis in die Ewigkeit hinein.»
Besonders schreckliche Exempel entnahm die Mutter, wie ich später entdeckte, einem alten Andachtsbuche, betitelt: «Übung der Gottseligkeit» von Bischof Bayle, einem Buche, das den Geist krassester Strenggläubigkeit atmete, von Engeln und Teufeln wie von Freunden und Bekannten sprach und namentlich Unglücksfälle immer als direkte Zeichen des göttlichen Zornes betrachtete. Die Qualen der Verdammten in der Hölle schilderte es mit schauderhafter Einläßlichkeit und diese Schilderungen bewirkten, daß die Mutter die Wörter «Tod» und «Ewigkeit» nur mit scheuem Flüstern aussprach und selbst dem Worte «lahm» stets beifügte: «Gott behüte uns davor!» Der Gedanke ans Sterben verursachte ihr wahre Höllenangst, da sie sich für eine so sündige Kreatur hielt, daß sie ohne die größte göttliche Barmherzigkeit eine Beute des leibhaftigen Satans werden müsse. Sie kam nur zu oft auf dieses Kapitel zu sprechen und ich sah dann den Angstschweiß in großen Tropfen ihr auf Stirne und Schläfe stehen. Religiösen Büchern bewies sie insgeheim so große Achtung, daß, wenn ihr z.B. eines aus Versehen auf den Boden fiel, sie daselbe, nachdem sie es aufgehoben, äußerlich auf beiden Deckeln küßte und auch uns Kinder dazu anhielt, in gleichen Fällen ein Gleiches zu tun.
Ein Sommer war mir so ganz erträglich hingegangen, schmächtiger und bleicher war ich geworden, kränklich aber fühlte ich mich in keiner Beziehung. Die Schulzeit lag schon hinter mir wie eine ferne Vergangenheit, und der Schmerz, sie entschwunden zu sehen, war versiegt. Die Repetierschule mußte mir gleichgültig sein, da ich nur Bekanntes wiederholen sollte und der Schulmeister mir die angenehmste Stunde, die Schreibstunde, durch geistloses Diktieren verdarb. Da die Repetierschüler zum Teil aus bösen Buben bestanden, die dem guten Felix manchen vorsätzlichen Verdruß bereiteten, so war er fast immer in gereizter Stimmung und es kam mitunter zu heftigen Auftritten. Ich fühlte dann ein inniges Bedauern, den Felix in fruchtlosem Eifern sich verzehren zu sehen. Einmal diktierte er in solcher Stimmung einen geschichtlichen Abschnitt, der von Fremdwörtern wimmelte, und so abgerissen, daß sich kein Sinn herausdifteln ließ; das tat er, um recht viele Schreibfehler rot anstreichen und den Übermütigen zeigen zu können, wie wenig weit es mit ihrer Wissenschaft her sei. Mich langweilte das Zeug und als ich ein paar Zeilen geschrieben, zog ich ein paar dicke Striche durch dieselben und wagte es, einen eigenen Aufsatz zu erschaffen. Ich wählte die Briefform und schrieb an einen Freund über die schöne Vergangenheit, da wir zusammen die Schule besuchten, glücklich, überglücklich, jeden Tag etwas Neues lernen zu können. «Auch jetzt», schrieb ich wörtlich, «sitze ich in der Schule, aber es ist da so viel anders geworden, es ist keine Lernbegierde mehr da, und viele, die gar nichts verstehen, meinen, sie seien gescheiter als der Schulmeister.» Da Felix meine Schrift von vornherein für fehlerfrei hielt, so pflegte er sie in der Regel nicht anzuschauen und in dieser Voraussetzung hatte ich meiner Phantasie freien Lauf gelassen. Diesmal hatte ich mich verrechnet, er griff eifernd nach allem, was vorlag, und er stutzte, auf meinem Bogen etwas anderes, als sein Diktat zu finden. Er las mit steigendem Interesse und blickte abwechselnd wohlgewogen zu mir herüber, und als er mit dem Lesen zu Ende war, fuhr er sich mit dem Nastuch über die Augen und sagte gerührt: «Hans, Du bist und bleibst doch meine einzige Freude, in Dir habʼ ich mich nicht betrogen. Euch aber, ihr miserabeln Bärenhäuter, euch will ich jetzt zeigen, was Einer zuwegebringt, der an euern ungeleckten Witzen nicht teilnimmt.» Nach dieser Vorrede beging er die Taktlosigkeit, meinen Brief laut vorzulesen, dessen erhabener Stil und glänzende Metaphern zwar von allen mehr oder weniger instinktiv gespürt wurden, dessen Inhalt mir aber begreiflich keine Freundschaften eintrug.
War es mit der Freude an der Schule Frühblumens für immer vorbei, so klammerte ich mich um so fester an die Tröster, die es mir in frühesten Tagen waren, an die Bücher. Es fand diesen Sommer in einer Schweizer Stadt eine Bücherverlosung statt, das Los kostete einen Gulden und der obgenannte Schneiderjunge vermochte in den Besitz eines solchen zu gelangen. Da der Plan besagte, daß jedes Los gewinne und daß einzelne Gewinne sich auf mehrere hundert Bände beliefen, so lag nahe, daß ich gegen eine solche Gelegenheit, glücklich zu werden, nicht gleichgültig sein konnte. Ich steckte mein Verlangen hinter die Mutter und die Mutter steckte es hinter den Vater und der Vater sagte, er wolle dann sehen; und als es hohe Zeit zum Sehen war, lehnte er es mit kältester Indifferenz ab. Diese Kälte tat mir sehr weh, ich war ja doch, wie ich die Mutter ihm einmal zu Gemüte führen hörte, ein so fleißiger Weber, daß er mir diesfalls wohl hätte willfahren dürfen. Er führte aber für sich den allerdings sehr triftigen Grund an, ein reichlicher Büchergewinn dürfte meinen Weberfleiß nicht vermehren und ich sei nicht zum Bücherlesen, sondern zum Weben da.
Die Herbstzeit unterbrach die Weberei für einige Wochen. Die Mutter mußte Kartoffeln ausgraben helfen, ich war bald Hüterbub für unsere paar Kühe, bald hatte ich Reisigbüschel aus einem entlegenen Bergwald nach Hause zu schleppen. Die Sprossen stachen unbarmherzig durch das dünne Gewändlein in den Rücken, und die durch keine Schuhe geschützten Füße litten auch nicht wenig auf des Weges spitzigem Steingeröll. In solchen Leidensstunden meditierte ich inbrünstig über die Passionsgeschichte Jesu Christi, und ich kann wohl sagen, daß der Trost, den ich daraus schöpfte, oft das einzige war, was mich unter der beinahe erdrückenden Last der Reisigbüschel und der Trübsal des Lebens aufrecht erhielt; da mochten die Sprossen noch so arg stechen, ich dachte, die Nägel durch des Heilands Hände haben ohne Zweifel unvergleichlich größere Schmerzen verursacht; die Füße mochten am Abend noch so geschunden aussehen, ich dachte, gehen die Löcher auch weit hinein, so gehen sie doch nicht durch, wie die Nägel durch des Heilands Füße. Und dann kratzte ich getrost Sand und Gras aus den Löchern heraus und verschlief Schmerz und Kummer auf meinem harten Laubsack und war am Morgen wieder so froh, wie ein anderes Menschenkind. Wenn ich dann auf die Wiese zog mit unsern folgsamen Kühen, die ihre struppigen Häupter im Vorbeigehen an den knorrigen Obstbäumen rieben, wodurch leicht einige der reifsten Früchte zu Falle gebracht wurden, die frische, nur ein wenig nach dem Rauche der Feldfeuer riechende Luft mir ins Gesicht blies, die Tautropfen in aller Farbenpracht auf dem grünen Teppich erglänzten, die Hüterbuben sangen, die Glocken klangen, die Axtschläge aus den Waldplätzen ertönten, die Tosa kräftiger zwischen den Wuhren hinabtoste, dann sang auch ich mit meiner guten Stimme aus voller, freudiger Seele:
Gott ist mein Lied,
Er ist der Gott der Stärke,
Hehr ist sein Namʼ und groß sind seine Werke
Und alle Himmel sein Gebiet.
Der kleinste Halm
Ist seiner Weisheit Spiegel;
Du Luft und Meer, ihr Auen, Täler, Hügel,
Ihr seid sein Loblied und sein Psalm.
Er tränkt das Land,< br />Führt uns auf grüne Weiden,
Und Nacht und Tag, und Korn und Wein und Freuden
Empfangen wir aus seiner Hand.
Kein Sperling fällt,
Herr, ohne Deinen Willen,
Solltʼ ich mein Herz nicht mit dem Troste stillen,
Daß Deine Hand mein Leben hält!