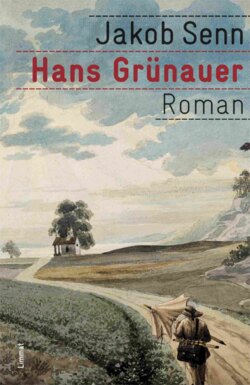Читать книгу Hans Grünauer - Jakob Senn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеUnerwartet schnell starb die Mutter, und der Vater sah sich in die tiefste Trauer versetzt. Ihre Ehe war eine friedliche gewesen und der Vater, allen Veränderungen und Neuerungen ohnehin abgeneigt, hatte wohl nicht von ferne daran gedacht, daß der Tod ihm einen solchen Streich spielen könne. Er überließ sich lange Wochen einem untröstlichen Hinbrüten, unfähig, uns Kindern, die wir anfänglich selber so sehr des Trostes bedurften, solchen zu gewähren. Doch am jungen Holz vernarben die Wunden leichter und so hatte auch ich die Traurigkeit bald überwunden. Nicht nur hatte mir der Vater alle, mehr als zwanzig Jahre hindurch aufbewahrten Kalender zur freien Benutzung ausgehändigt, sondern auch jedermann in der Umgegend, der irgend etwas an unterhaltender Lektüre besaß, diente mir jetzt bereitwilligst. So vergaß ich die wirkliche Welt mit ihrem Gram und Glücke, der Webstuhl ruhte tagelang und ich ließ mir träumen, daß es ewig so gemächlich gehen dürfte.
Der Sommer kam, und mit ihm lebte auch der Vater wieder munterer auf. Doch sollte, wie die Sage ging, etwas anderes, als allein der Zeiten Wechsel von so wohltuender Wirkung auf ihn sein. Susanna zog mich wiederholt damit auf, daß ich nun bald eine zweite Mutter bekommen werde, und was für eine, des werdʼ ich mich verwundern; jedenfalls werdʼ ich dann wieder etwas mehr zu weben und etwas weniger zu lesen bekommen. Ich nahm diese Zeitung ohne Grämen auf, mein jugendlicher Leichtsinn half mir über die mögliche Ungunst herannahender Zustände hinaus und ich freute mich für den Vater, dessen bisheriges trübseliges Wesen mir oft tief zu Herzen gegangen war.
Eines Sonntagabends, als ich aus der Kinderlehre nach Hause kam, und weil ich den Schlüssel zur Türe nicht an gewohnter Stelle liegen fand, den Eingang durchs Fenster suchte, sah ich den Vater mit einer Weibsperson drinnen in der Stube sitzen; es war mir klar, daß es die Erwählte sei. Es war die älteste Tochter von Peters Jakob, eine Jungfrau von sechsunddreißig Jahren, die gewandteste Weberin in der ganzen Umgegend, von steifer Ehrbarkeit und guter Gesundheit. Ich erschrak und mein Schrecken war nicht gering, denn soweit ich die Jungfrau aus eigener Beobachtung wie vom Hörensagen kannte, hatte sie mich nie im geringsten angemutet. Sie war eine erklärte Verächterin aller Literatur, wobei höchstens das Kirchengesangbuch und ein paar Gebetbücher nicht inbegriffen sein mochten, auch der mündlichen Erzählung so wenig geneigt, daß ihr Vater gerade ihretwegen, wie er oft bemerkte, zu Hause nie etwas von seinen Erlebnissen erzählte. Von ihrer unermüdlichen und «ausgiebigen Weberei» war im Orte nur ein Ruhm zu hören, nämlich, daß sie von niemand übertroffen werde. Alles das, zusammengehalten mit ihrer äußern Gestalt, hoch und hager, mit groben männlichen Gesichtszügen, erschien mir überaus langweilig und abstoßend. Ich zog mich daher eiligst zurück. Einen Monat später wurde Hochzeit gehalten und wir hatten wieder eine Mutter.
Die ersten Tage der neuen Zustände verliefen recht vergnügt und friedlich; die neue Mutter hatte uns mit kleinen Geschenken bedacht, gab recht gute Worte und kochte merklich besser, als wirʼs bisher gewohnt waren. Mit der Aufstellung ihres eigenen Webstuhles pressierte sie zu meiner Beruhigung nicht sehr, sondern bestand darauf, daß sie dem Vater ein wenig bei seinen ländlichen Arbeiten behülflich sein wolle. Solches mußte sie aber erst erlernen und weil der Vater dabei mit jener kleinbäuerlichen Ordnungsliebe zu Werke ging, der es selten jemand nach Wunsch zu treffen vermag, so veranlaßte ihn ihre fleißige Unerfahrenheit zu so viel Bemerkungen, daß die Stimmung der Flitterwochen keine ganz ungetrübte bleiben konnte.
Ich blieb nach wie vor beim Webstuhl; daß ich mir aber nach wie vor meine Zeit mit Lesen versüßen wollte, das führte zum ersten offenen Friedensbruch. Der Mutter fiel auf, wie bedenklich langsam ich vorwärts kam, sie fing also an, wenn sie hereinkam, an meiner Garn- und Tuchwelle zu tasten, fragte, ob das Garn so schlecht sei, daß ich nicht mehr ausrichte, und warf mir dabei ernste Blicke zu. Dann steckte sie es hinter den Vater, daß er mir ans Gewissen rede, und er tat es, doch ohne viel auszurichten. Ich versprach Besserung und hielt mein Versprechen so lange, als jemand beobachtend in unmittelbarer Nähe verweilte; sobald ich mich aber allein wußte, konnte ich der Versuchung zum Lesen nicht widerstehen. Jetzt fing ich an, zu bemerken, wie meiner Bücher tagtäglich weniger wurden, bis in kurzer Zeit sich nicht ein einziges mehr vorfand und ich mich allein an den dünnen Wandkalender halten mußte, den ich denn auch durch und durch studierte.
Bei Beginn des Winters setzte sich die Mutter auch zum Webstuhl und da sie mir gerade gegenüber saß, so war meiner Leserei radikal abgeholfen. Auch für Rede und Gesang blieb nur wenig Freiheit, da die Mutter von alledem keine Freundin war und meinte, wenn man an der Arbeit sei, so habe man keine Zeit an etwas anderes zu denken. Sie machte aber auch die helle Zeit hindurch ein so mauserig Gesicht, daß einem alle Fröhlichkeit verging und nach der Hand eine Mahnung zum Stillesein überflüssig wurde. Ihr schweigseliger Einfluß legte sich dann auch auf die ganze Haushaltung, wie ein Reif aufs Gefilde. Peters Jakob kam äußerst selten mehr zu uns.
Endlich wurde es wieder Frühling. An einem Sonntagmorgen ging ich dem Wuhr entlang bei der Tosa; die Weiden knospeten erst und das Wuhr war bei aller Dichtigkeit doch noch sehr durchsichtig. Jüngere Kinder schnitten sich aus der saftigen Rinde, die sich röhrenförmig von den Weidenstäben ziehen ließ, Flöten, Pfeifen und Waldhörner und die monotonen Klänge fern und nah weckten wehmütigsüße Erinnerungen in mir. Träumerisch verloren blickte ich in die Welt hinaus, ich wußte nicht was ich suchte, noch was mir fehlte. Ach, mir fehlte ja alles! Mattgrüne Wiesen, brauner Wald, blauer Himmel – wie ruhig lagʼs um mich und über mir! Ich mußte wohl ein wenig ergriffen und aufgerichtet werden. Ich schlüpfte durchs Wuhr in die Tosa zu einer Stelle, wo das Wasser einen spiegelglatten Teich bildete, in welchem der Himmel sich widerspiegelte. Aber nicht nur des Himmels Bild, auch das meinige lag in der Tiefe und vor demselben erschrak ich und stieß einen schweren Seufzer aus. Wie bleich und fast zu nichte war ich den Winter über geworden, wie blöd und schläfrig nickte mein Ebenbild mir zu! Dieser Anblick wollte mir bald unerträglich werden, da hörte ich meinen Namen rufen. Es konnte auch Sinnentäuschung sein; warʼs aber nicht. In einem Fahrweg, der vom Felde in die Tosa führte, stand ein Mann, der mir winkte; es war der Schulmeister Felix. Ich lief so schnell als ich konnte auf ihn zu und
achtete es nicht, daß ich einige eiskalte Strömungen durchwaten mußte. Felix sagte, er hätte zwar mit dem, was er zu sagen habe, auch bis zum Repetierschultag warten können, doch sei ihm solches, sobald er mich gesehen habe, nicht möglich gewesen. Es sei nämlich nun bestimmt und gewiß, daß noch dieses Jahr in Wiesental eine Sekundarschule eröffnet werde. Aus Wiesental und Tannenrain habe sich bereits eine ordentliche Zahl von Schülern gemeldet, auch Großmoos lasse auf ein paar rechnen, nur bei Frühblumen und Nideltobel sei noch nichts Gewißes; aber er wolle dafür sorgen, daß wenigstens einer, der Hans Grünauer, das Häuflein verstärke, und er glaube, der könne wohl für zwei gerechnet werden.
Ich war von dieser Nachricht wonnereich überrascht, öffnete den Mund einige Male lautlos wie eine Kaulquappe auf dem Trockenen und verharrte schließlich in stummem Entzücken. «Aber wie Du aussiehst! Was fehlt denn Dir? Bist Du auch gesund?» fragte der Schulmeister, indem er meine eingefallenen Wangen betastete. «Ach!» seufzte ich und eine herbe Rührung überkam mich, «nichts als weben, gar nichts anderes mehr!» Meine Stimme erstickte in Tränen. «Ja, das ist es und der Öldampf und das Spätaufbleiben», sagte Felix ebenfalls gerührt. «Aber zählʼ darauf, das ist jetzt vorbei, das wollte ich Dir sagen. Ich werde Deinen Vater heute noch oder sobald ich ihn sehe zu mir hereinrufen und es ihm andingen, daß er Dich unfehlbar in die Sekundarschule schicken solle.» Ich dankte Felix durch einen innigen Blick und bat ihn noch ausdrücklich, solches dem Vater ja recht sehr anzuempfehlen, weil er es sonst leicht wieder vergessen könnte.
Felix hielt Wort und er richtete so viel aus, daß der Vater sich wenigstens zum Pfarrer bemühte, bei demselben über das große Vorhaben Rat zu holen. Der Geistliche hörte mit gnädigem Lächeln zu und erwiderte schnell und besonnen: «Grünauer, des Schulmeisters Rat ist ein einfältiger. Ich will damit nicht bestreiten, daß Euer Bube nicht recht artige Fähigkeiten besitze, aber Außergewöhnliches ist nichts dabei, und so wäre es für einen wenig bemittelten Mann, wie Ihr seid, zu gewagt, den Jungen einem Berufe zu widmen, welcher lange Jahre der Ausbildung und bedeutende Geldopfer erfordern würde, ohne eigentliche Wahrscheinlichkeit, daß das Wagnis zu Eurer Freude und des Jungen Glück ausschlüge. Laßt ihn lieber ein Handwerk lernen, etwa just die Bäckerei. An inländischen Bäckergehülfen ist immer noch Mangel, sodaß die Hälfte derselben aus Schwaben besteht. Überlegtʼs und tut was Ihr wollt, nur versteigt euch nicht in das geschulte Wesen. Das ist mein Rat. Lebt wohl Grünauer.»
Diesen Bericht brachte der Vater ohne Randglossen zurück; die Mutter fand den Rat vernünftig und allweg gescheiter als den des Schulmeisters. Auch ich erschrak nicht davor, lag doch die Möglichkeit darin, vom Weben loszukommen. Anderer Ansicht war der Schulmeister, der einige Tage nach Eröffnung der neuen Schule in unser Haus kam. Er bemerkte aufgebracht, das stehe dem Pfarrer, der ein städtischer Aristokrat sei, ganz gut und harmoniere mit der Tatsache, daß er bei der Einweihung des Institutes, das gegen seinen Willen ins Leben gerufen worden, seine beschmutztesten Kleider getragen und extra vom sauersten Wein getrunken habe. Felix bestürmte den Vater von neuem, wenigstens ein Jahr lang den Versuch zu machen, da werde sichʼs zeigen, was der Pfarrer für ein Menschenkenner und Prophete sei. Allein der Vater fand es bequemer, dem Pfarrer zu glauben, und die Mutter sagte entschieden, aus dem werde nichts, daß ich ein ganzes Jahr lang im Sonntagsgewändlein herumlaufen dürfe; vielmehr sei es jetzt an der Zeit, daß ich endlich etwas verdiene. Der Vater nickte Beifall und die Sekundarschule war überwunden.
Da in Grünau keine Bäckerei existierte, die Lehrlinge aufnahm, und der Vater es nicht der Mühe wert hielt, sich anderswo nach einer solchen umzusehen, so blieb der Webstuhl mein Teil; ohnehin wäre ich auch für den Bäckerberuf noch viel zu klein und schwach gewesen. Ich ergab mich in mein Schicksal, hielt jedoch in romantischen Träumen an der Hoffnung fest, dereinst von Berufes wegen durch Bibliotheksäle schlendern und auf dem einsamen Zimmer über erhabenen Problemen brüten zu können. Ein Sporn zu größerem Fleiße beim Webstuhl konnte in solchen Vorgängen nicht liegen, gegenteils wurde ich immer lässiger und gleichgültiger. Ich
kam denn auch so eigentlich nicht mehr aus Strafverhängnissen heraus, die sich besonders auf die Samstagabende zusammenzogen, welche Zeitpunkte als Hauptlieferungstermine angesetzt waren, während ich selten etwas liefern konnte und sicherlich kein einzig Mal etwas rechtzeitig lieferte. Drohungen und Strafen fruchteten wenig, ebensowenig die Zusprüche Susannas, welche mir vorrechnete, was sie in einem Jahre bereits erübrigt habe. Trotzig erwiderte ich ihr, daß sie es ja wissen müsse, wie ich gar nicht darnach trachte, beim Weben vorwärts zu kommen, und daß gewiß die Zeit nicht ausbleiben werde, in welcher ich ohne Weben in einem Tage so viel verdiene, wie sie jetzt in einer ganzen Woche. Das imponierte ihr jedoch wenig, sie blickte mich spöttisch an und bemerkte, es dürfte auch noch so ein Kleinegli aus mir werden.
Bei solcher Unverbesserlichkeit geschah es auf Anregung der Mutter, daß mir auferlegt wurde, ein wöchentliches Kostgeld zu bezahlen; was ich darüber hinaus erwürbe, sollte mir gehören, in dem Sinne jedoch, daß ich daraus auch die Anschaffung der Kleider bestreiten sollte. Das war des größten Elendes Anfang. Ich erwarb selten so viel, als nur das Kostgeld betrug, und da man es mir reif werden lassen wollte, so kam ich in Kleidern so zurück, daß ich mich bald kaum mehr sehen lassen durfte. Man zeigte mit den Fingern auf mich und sagte mir ungeniert ins Gesicht, welch ein Erztaugenichts ich sei.
Um an den Sonntagen nicht allzuoft das Gespötte der Leute zu werden, fing ich an, mich auf dem Wege zur Kinderlehre zu verschlüpfen, was am sichersten im Revier des Rabenfels geschehen konnte, wo ich mich ins dichte Gestrüpp verlor; solches ließ sich um so leichter tun, als ich jetzt alle und jede Kameradschaft verloren hatte. Für solche Vorhaben nahm ich dann nebst dem Katechismus ein unterhaltendes Büchlein mit und las unter überhangenden Felsen hinter mit Efeu bedeckten Baumstrünken die Geschichte der Rosa von Tannenburg und von dem guten Fridolin und dem bösen Dietrich. Einmal war ich an der Mitnahme eines solchen Gegenstandes verhindert worden und trieb mich deshalb gelangweilt in der Wildnis herum. Ich kam höher und höher und gelangte unversehens in die Nähe eines abgelegenen Weilers. Hier erinnerte ich mich, daß Margritli, meines früh verstorbenen Onkels Geliebte, noch lebe und seit Jahr und Tagen bei einer Schwestertochter daselbst wohne. Ich hatte die längst verblühte Schönheit noch nicht oft gesehen und jetzt mutete es mich eigentümlich an, dieselbe zu besuchen; meine elende Kleidung konnte ihr nicht auffallen.
Margritli saß allein in der niedern dumpfigen Stube, ein alt verfallen Geschöpf mit schneeweißen Haaren, auf den Wangen das letzte verschwindende Rot der verblühten Rose, die freundlichen braunen Augen durch eine schwere Brille armiert. Die kleine Alte hatte die Bibel vor sich und sah bei meinem Eintritt forschend auf. Ich setzte mich nach einem halblauten Gruß auf eine gleich bei der Türe angebrachte Bank und legte den mit Chorälen versehenen, dickleibigen Katechismus neben mich. «Wer bist Du?» fragte Margritli mit sanfter, etwas leidender Stimme – «Grünauers, des Kleinen, Hans», erwiderte ich. – «Ei, komm doch ein wenig her zu mir!» – Ich gehorchte, ich mußte mich hinter den Tisch neben Margritli setzen. Sie legte mir die Hand aufs Haupt, drehte mein Gesicht ihr zu und sagte: «So, Du bist von Grünauers her? Nun, es ist wahr, Du siehst der Familie ähnlich genug. Ach Gott, wie vergeht die Zeit! Wie heißest Du?» – «Hans», entgegnete ich traurig. – «Ach, so!» seufzte Margritli und zog mich näher an sich, «so, Du heißest Hans? Sagʼ, schreibst Du auch gern?» – «O ja, wenn ich dürfte!» antwortete ich bekümmert. – «So, Du darfst nicht? Was mußt Du denn tun?» – «Weben!» wimmerte ich und legte mein Haupt über die untergelegten Hände auf den Tisch. Margritli seufzte mitleidig mit mir: «Ist denn das so etwas Trauriges? Denkʼ, der Mensch muß arbeiten und im Schweiße seines Angesichtes sein Brot essen, das ist ihm bestimmt auf Erden. Aber was möchtest Du denn eigentlich tun?» – «Nur mit Büchern zu tun haben», wehklagte ich, und meine Tränen rannen reichlicher. Und darauf erzählte ich ihr von meinem heißen Verlangen, von meinen kalten Leuten, meinem sehr traurigen Dasein. Ich erzählte ihr aus der überschäumenden Fülle meines Herzens. «Sei nur still, Hans», sagte Margritli mit weicher Stimme, «Du kommst schon noch dazu, Du bekommst schon noch Bücher nach Deines Herzens Lust, ja, so wahr ein Gott lebt und ich hoffe, bald selig zu werden. Der über uns ist, hat Dir einen Genium gegeben, wie er auch schon Deinen Vorfahren getan. Das ist nicht umsonst, und wenn Du nur stille hoffst, so wirst Du es noch mit Freuden erfahren.»
Während Margritli so tröstend noch manches Wort sagte, langte sie nach meinem Katechismus, öffnete das silberne Schlößchen und sah, daß vornen auf dem weißen Blatte etwas mit roter und blauer Tinte geschrieben stand. «Ist mir, ich sollte diese Schrift kennen; was steht denn da?» fragte sie und hielt mir das Buch hin. Ich las:
Der christenliche Unterricht,
Der lehret uns die heilʼge Pflicht,
Daß man verehre Gott, den Herrn,
Und tue seinen Willen gern.
Dieses Buch habe ich meiner herzgeliebten Margaretha zu einem
Neujahrsgeschenk verehret.
Datum den 20. Christmonat 1798
Hans Grünauer.
Ein Strahl wehmütiger Freude zuckte durch Margritlis verwitterte Züge, sie nahm das Buch und küßte die Dedikation mit jugendlicher Inbrunst: «Das war also mir bestimmt, ja, ja, das ist recht seine Hand! Er starb eben zwei Tage vor Weihnachten und konnte mir die Freude nicht mehr bereiten. Ach, wenn er länger gelebt hätte, aus ihm wärʼ auch etwas geworden! Der hatte einen Genium! Aber die Unruhe verzehrte ihn, doch auch die Treue bereitete ihm viel Ungemach. Nicht umsonst schrieb er mir an seinem Sterbetage: «Margritli, o Margritli, wenn Du wüßtest, was ich leide! Mein Herz ist wie ein Feuerpfuhl, aber heißer noch ist die Liebe, mit der ich Dich ewig lieben werde.» Sie zog das alte gelbe Brieflein aus einem auf der innern Seite des hintern Deckels der Bibel angebrachten Schubfache und ließ es mich lesen. Die Todesnot des Schreibers sprach aus jedem Zug. Margritli erzählte mir dann lange von ihrem Hans, sie erinnerte sich noch an die kleinsten Einzelheiten seiner Persönlichkeit, besonders auch seiner Gesichtszüge, welche sie in den meinigen aufs täuschendste wiederfand; es schien sie an Seelenwanderung zu gemahnen. Das bestärkte sie in dem aufrichtigen Glauben, daß meinem «Genium» noch eine bessere Zukunft bevorstehe, und diese Glaubenszuversicht war denn auch von wunderbar beruhigender Nachwirkung auf mich selber. Margritli entließ mich mit einem Segensspruch und bat mich wiederholt, sie doch noch öfter zu besuchen. Ich versprach es, kam aber nicht mehr dazu, da sie bald nachher starb.