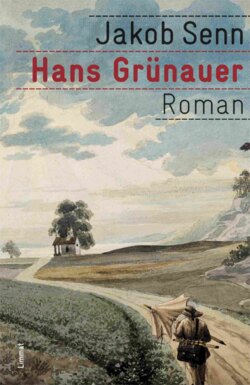Читать книгу Hans Grünauer - Jakob Senn - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеMein Sehnen, die Schule täglich besuchen zu dürfen, wurde erst im siebenten Jahre erfüllt. Vorher aber lernte ich unter mütterlicher Anleitung so fertig lesen, daß der Schulmeister mir das sogenannte Namenbüchlein, welches ich vorschriftgemäß mitbringen mußte, lachend wegnahm und mir dagegen ein Lesebüchlein anwies. Ich wurde von meinen Mitschülern, die unter Schweiß und Tränen von einem Ziel zum andern rückten, als ein Wunder angestaunt und beneidet, und meine Beihülfe, die ich oft aus Langeweile, oft aus Mitleid anbot, wurde niemals verschmäht.
Das Schulhaus war ein loses Brettergebäude, durch dessen Wandfugen der Wind jeweilen scharf pfiff. Im Hausgange stand man wie in unserer Küche, auf Gottes bloßer Erde. Die Schultische bestanden aus rohgezimmerten Brettern, in welche für die Füße auf die allereinfachste Weise Löcher gebohrt waren. Die Schüler saßen ohne Klassenordnung, meist Geschwister bei Geschwister oder Nachbarskind bei Nachbarskind. Der Schulmeister war ein munterer Greis, der als Jüngling das Schneiderhandwerk erlernt, sich aber in der Folge nicht als Freund von Nadel und Bügeleisen bewährt hatte, dagegen seiner netten Handschrift und guten Singstimme wegen zum Schulmeisteramte befördert worden war, falls es nämlich eine Beförderung genannt werden konnte, mit sechzig Gulden jährlichen Einkommens Schulmeister geworden zu sein. Die Schneiderei betrieb er jedoch später nebst der Schulmeisterei wieder, weil er eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte. So pflegte er auch während der Unterrichtsstunden stets eine Näharbeit bei der Hand zu haben, sintemal das Schulzimmer zugleich als Wohn- und Arbeitszimmer für seine Familie diente. Die Schulmeisterin, so weit es ihr die häuslichen Geschäfte gestatteten, spann Seide, ja, ich höre noch jetzt den wehmütigen summenden Ton ihrer Spindel, der die halben Tage hindurch ertönte. Im Keller, unmittelbar unter dem einfachen bretternen Fußboden, war der jüngste von des Schulmeisters Söhnen, doch immerhin schon ein Dreißiger, mit Weben beschäftigt, dessen Ladschläge die allgemeine Rührigkeit vermehren halfen. Felix, so hieß der Sohn, kam manchmal zur Erholung in die Schulstube herauf, die Schirmkappe im Genick und ein erdenes Tabakpfeifchen im Munde, eine recht possierliche Figur, besonders weil der Felix uns allemal freundlich anzulächeln pflegte, was namentlich mich oft hellauf lachen machte.
Ich war von Stundʼ an des Schulmeisters Liebling, dem er sein bestes Wissen zuwendete, was freilich sehr wenig sagen will. Ich erinnere mich an nichts, das ich ausschließlich durch ihn gelernt, als die Elementarbegriffe der Schreibkunst. Als ich bereits ganze Worte formieren konnte, fing ich an, meine Schrift mit derjenigen Kaspars zu vergleichen und fand an dem arabeskenartigen Geringel und Geschlingel derselben so großes Wohlgefallen, daß ich sie mir ohne weiteres zum Vorbild nahm. Der Schulmeister bemerkte den fremden Einfluß und sagte unter starkem Kopfschütteln: «Hörʼ, Hansli, das Geringel und Geschlingel taugt nichts, je gräder und einfacher, desto besser; laß Dirs gesagt sein.» Ich ließ mirs wirklich gesagt sein und fand diese Regel im Laufe der Jahre auch noch auf anderes, als auf die Schreibekunst, anwendbar.
Die Frau Schulmeisterin war meine Mutter Gotte. Sie litt an starkem Gliederzittern, wobei besonders das Haupt mitgenommen wurde und deshalb stets in negativer Bewegung begriffen war. Eines Tages schickte ihr meine Mutter durch mich ein Körbchen schöner Baumfrüchte als kleine Herbstgabe. Als dann die Schulmeisterin unsere Bescherung unter heftigem Kopfschütteln ansah, wähnte ich, sie wolle die Gabe aus übelzeitiger Bescheidenheit ablehnen, und protestierte mit einigen Worten gegen die Zurücknahme, bis mich die Alte lachend unterbrach: «Torenbub, wer sagt denn nein!»
Da ich mit dem siebenten Jahre das Lesen völlig, das Verstehen ziemlich los hatte, so fiel ich von unersättlicher Leselust getrieben über alles Gedruckte her, das mir zugänglich war. Indessen war im elterlichen Hause nichts vorhanden als ein Wandkalender und einige Andachtsbücher, aber all dieses las ich bis auf wenige mir durchaus unverständliche Blätter und hatte daher einen solchen Vorrat von geistlichen Sprüchen im Gedächtnis, daß die Mutter über meine frühe Frömmigkeit Freudentränen vergoß und ich bei Verwandten und Bekannten hoch angeschrieben stand.
Mittlerweile hatte das Weben im Keller unter der Schulstube aufgehört und Felix kam längere Zeit nicht mehr zum Vorschein. Es geschahen überhaupt Dinge, welche auf das Zukünftige gespannt machten. Wir bekamen nämlich Schulbänke, wie sie andern Ortes längst schon eingeführt waren, und jedes Kind mußte sich eine Schiefertafel anschaffen. Bisher waren alle Schreibeübungen auf Papier ausgeführt worden, wozu freilich wöchentlich bloß eine Stunde verwendet und darauf gehalten wurde, daß ein Bogen je für einen Monat ausreichte. Nun sollten die Schreibstunden vermehrt werden, und zu diesem Zwecke schien es aus ökonomischen Gründen nötig, sich der Schiefertafel zu bedienen. Dem alten Schulmeister kamen diese Neuerungen sehr ungelegen und er brachte seine alte Lehrmethode auf den neuen Bänken trutzig noch einige Zeit in Anwendung. Der Judäsche Katechismus mit einem Anhang von Lesestücken, betitelt: «Lehrmeister» und eine Sammlung von Gebeten, Gellertschen Liedern und Psalmen waren ziemlich die einzigen Lehrmittel für vorgerücktere Schüler, beide zu wörtlichem Auswendiglernen bestimmt. Der Katechismus, der kleine wie der große, wurden in stetem Kreislauf durchgenommen, obgleich der erstere, wie vorangedruckt stand, nur für die «Allereinfältigsten», die den großen nicht zu fassen vermöchten, bestimmt war. Dadurch wurde mir der Religionsunterricht früh genug vergällt und ich harrte sehnlich den kommenden Veränderungen entgegen.
Etwa ein halbes Jahr nach dem Verschwinden des Felix erschien derselbe plötzlich wieder und zwar nun als unser Schulmeister. Er hatte einen Kursus in dem neugegründeten Lehrerseminar durchgemacht und führte jetzt an der Hand neuer Lehrmittel auch eine ganz neue Lehrmethode und Schulordnung ein. Wir wurden klassenweise gesetzt, nach einem eigens ausgearbeiteten Lehrplane unterrichtet und durften den Schulmeister nicht mehr «duzen», sondern wurden angewiesen, denselben mit «Ihr» anzureden.
Ich war seines Vaters Günstling gewesen, ich war auch der seinige und verdankte diese Auszeichnung wohl zumeist meinem unermüdlichen Lerneifer. Ich wurde zu oberst gesetzt und behauptete meinen Platz mit unbestrittenen Ehren. In allen Fächern blieb ich meinen Klassengenossen voraus und fand nur im Rechnen einen zwei Jahre ältern Rivalen, der mirʼs zuvor tat. Meine Hauptstärke bestand in der Satzbildung, welche Felix nach einer kleinen trefflichen Sprachlehre energisch betrieb, so wenig er selber im Stande war, einen ordentlichen Satz zu produzieren. Er drang sehr darauf, daß jedes Kind in den Besitz der neuen Lehrmittel gelange, aber bei mir warʼs umsonst, weil der Vater die Anschaffung neuer Bücher für überflüssig erklärte, so lange die alten nicht aufgebraucht seien. Als ich ihm nach meinem schwachen Vermögen die Nützlichkeit und Notwendigkeit der neuen Büchlein nachzuweisen suchte, widersetzte er sich der Anschaffung erst recht hartnäckig und meinte ironisch, ich werde ohnehin gescheit genug.
War ich ein leidenschaftlicher Bücherleser, so war ich auch selbstverständlich der mündlichen Erzählung bestens gewogen. Wir hatten einen langjährigen Hausfreund, Peters Jakob genannt, der als Knabe in der Stadt gedient, als Mann sich dem Botenberuf gewidmet hatte und deshalb allwöchentlich weit ins Land zog. Dieser Peters Jakob hatte ein außerordentlich treues Gedächtnis und so pflegte er jedesmal alle seine kleinen Erlebnisse tagebuchartig zu erzählen, was manchmal vom frühen Abend bis nach Mitternacht währte. Er hatte die Schlacht bei Zürich gesehen und war bei mancher Hinrichtung zugegen gewesen, er hatte geliebt und gelitten, war alt geworden und hatte unterdessen eine Menge Familienkreise entstehen und vergehen gesehen. Und über alles wußte er so anziehend zu berichten, daß er mir nächst den Eltern der liebste Mensch auf Erden war. Eine Episode aus dessen Erzählungen ist mir noch heute gegenwärtig, die wohl verdient, aufgezeichnet zu werden.
Er übernachtete einst auf einem seiner Botengänge in der Landschaft Toggenburg in einem Bauernhause. Die Herbergsleute bestanden aus einem Ehepaar mittlern Alters, vier Kindern und einem verschrumpften Großmütterchen, Gertrud. Der Gewährsmann wurde auf einer mit Kissen belegten Bank in der Stube gebettet. Um Mitternacht erwachte er aus tiefem Schlafe bei dem Rufe: «Gertrud! Gertrud! stehʼ auf! Bitte, stehʼ ein wenig auf!» Er richtete sich auf und guckte durchs Fenster; da stand im letzten Viertelschein des Mondes ein alter Mann vor dem Hause, der nach dem Gadenfenster sah und dorthin sein Rufen richtete. Endlich ging das Gadenfenster auf und Gertrud antwortete mit zitternder Stimme: «Wer ruft mir?» – «Ich, wirst mich wohl kennen», antwortete der Alte, «laß mich doch ein wenig hinein.» – «Jesus Maria!» erwiderte Gertrud und fiel schier in Ohnmacht, «bist Du es, Sep-Anton? Was fällt Dir jetzt noch ein? Denkʼ, wie alt wir sind. Die Zeit ist wäger vorbei, Sep-Anton!» – «Alt – vorbei –», wiederholte der Alte für sich, er konnte es nicht verstehen. «Gertrud», sagte er, «was ist denn das? Ich bin achtundzwanzig, Du fünfundzwanzig Jahre alt – was ist denn das?» – «O, lieber Sep-Anton, Du weißt also nicht, daß Du fast fünfzig Jahre lang verwirrt gewesen bist? Siehʼ, nächste Mariä Verkündung sind es gerade fünfzig Jahre, seit Du mit dem Franz-Xaver meinetwegen Händel gekriegt hast und er Dir einen Streich auf den Kopf gegeben hat, wovon Dir die Sinnen verwirrt worden sind. Ich bin Dir noch Jahre lang treu geblieben, aber weil es mit Dir nicht bessern wollte, so heiratete ich den Meinrad, der nun auch schon lange tot ist. Ach Sep-Anton, was habʼ ich um Dich gebriegget, aber jetzt istʼs zu spät und ich folge meinem Meinrad, willʼs Gott, bald nach. Mich friert, ich muß ins Bett. Gut Nacht, Sep-Anton.» – Und der Sep-Anton schluchzte leise: «Gutʼ Nacht, Gertrud, ich komme nicht mehr.» – Am Morgen erzählte Gertrud das seltsame Begebnis unter Vergießung vieler Tränen, und als sie noch im Erzählen begriffen war, kam die Nachricht, der verwirrte Sep-Anton im Steinhaus sei heute grad vor Tagesanbruch gestorben.
Peters Jakob besuchte in ganz Frühblumen einzig unser Haus. Mein Vater war der Pate seines jüngsten Kindes und es bestand im weitern eine gewisse sympathetische Wechselwirkung zwischen den beiden Freunden, daß sie ihre gegenseitige Nähe spürten, auch wenn sie sich weder sahen noch hörten. Die Grundstücke beider stießen an die Tosa und lagen sich gerade gegenüber und jeder unterhielt sein Wuhr so sorgfältig, daß es dicht wie eine grüne Mauer dastand und kaum eine Lücke blieb, durch welche man an oder durch das jenseitige Wuhr sehen konnte. Wenn nun der Vater und der Peters Jakob jeder hinter seinem mauerdichten Wuhr stand, so sträußten wohl beide die Ohren, schnüffelten, und dann rief der Vater etwa: «Guten Tag! Bist Du es, Jakob?» Und Peters Jakob erwiderte: «Je so, ist mir doch gewesen, Du seiest drüben; guten Tag, Heinrich!» Und dann keilte jeder sich durch sein Wuhr und gelangte ans Bett der Tosa. Jetzt versuchten sie allbereits ein ordentliches Gespräch zu beginnen, aber möglicherweise lärmte die Tosa zu sehr. Dann zogen sie die Schuhe aus, wickelten die Hosen erklecklich auf und so durchwatete jeder die Strömung die an seinem Wuhr vorbeifloß, und trafen sie in der Mitte des Flußbettes auf einer wasserleeren Stelle zusammen. Daselbst standen sie, je nach der Wichtigkeit ihrer Mitteilungen oder der Stärke ihres Konversationstriebes, oft sehr lange barfuß auf dem kugeligen Gestein, sachte von Weile zu Weile den einen oder andern Fuß lüpfend. Am Schluße einer solchen Konferenz war es denn einmal gewesen, als sie eben von einander gingen, daß Peters Jakob sich nochmals umwendete und dem Vater zurief: «Ja hörʼ Heinrich, ich hätte es schier vergessen, meine Frau hat mir eben gestern noch einmal so ein Kind geboren, wollst Du mir etwa am Sonntag dafür zu Gevatter stehen?» «Ei, freilich, warum das nicht?» antwortete der Vater, und jeder watete nun gleichmütig wieder zu seinen Schuhen zurück.
Wenn die Tosa hoch anschwoll, so floß sie schlammig, wie Lehm und das Anschwellen geschah oft urplötzlich. Wir Kinder erkoren das Tosabett, wenn es trocken war, gerne zu unserem Spielplatz, waren aber mehr als einmal in Gefahr zu ertrinken, wie Pharao samt seinen Scharen im Roten Meer. Solches war der Fall, wenn es im Frühling tief hinten im Gebirge, am Ursprung der Tosa, stark in den Schnee regnete, während weiter vornen im Tal heitere Witterung war. Dann brachte der Fluß Holzstücke von allen Größen und Formen, selbst ganze Bäume mit Wurzeln und Wipfeln und die Grundeigentümer standen dem Fluße entlang mit Stangen, an welchen eiserne Haken und Spieße befestigt waren, und suchten vermittelst derselben von dem Treibholz möglichst viel herauszufischen, wobei mein Vater und Peters Jakob nicht die untätigsten waren. Allein mein Vater war der Kräftigere und Geschicktere und fischte gerne gerade die Stücke heraus, welche Peters Jakob in übel angebrachtem Eifer bloß angestochen und dadurch auf die andere Seite getrieben hatte. Alsdann konnte letzterer wohl ein wenig mauserig werden und war im Stande, einen ganzen Abend darauf bei uns zu sitzen, ohne irgend etwas zu erzählen. Dagegen schlief er entweder oder reinigte, sönderte und büschelte Sauborsten, womit er einigen Handel trieb; der Vater aber drechselte Holzspindeln für Handspinner, oder schnitzte sonst etwas in Holz oder hantierte als Reparateur einer Schwarzwälderuhr. Geredet wurde aber der Mauserigkeit Peter Jakobs wegen kein Wort. Doch nächsten Tages schon witterten sie sich wieder hinter dem Wuhr und der Friede war hergestellt.
Eine andere Persönlichkeit, die zwar in Grünau vielleicht die verachtetste war, hatte für mich bei meiner Vorliebe für Außergewöhnliches eine beinahe so große Anziehungskraft, wie Peters Jakob. Dieselbe hieß Egli, wurde aber seiner kurzgebliebenen Statur wegen gewöhnlich Kleinegli genannt. Er war Baumwollweber und mochte damals gegen fünfzig Jahre zählen. Sein wirrer, unstäter Blick, ähnlich demjenigen eines stillen Wahnsinnigen, die in unordentlichen Locken ins Gesicht fallenden schwarzen Haare, der struppige Bart, den er monatlich einmal so gut beseitigte, als sichʼs mit einer Weberschere tun ließ, seine originelle an keine Nationalität erinnernde knapp anliegende Kleidung, meist aus schwarzem Baumwollsamt bestehend, die er sich selber verfertigte und mit den sonderbarsten Garnituren verschnörkelte, über dem Knöchel seines linken Fußes ein starker eiserner Ring befestigt, an demselben eine ebensolche Kette und an derselben ein mit Eisen beschlagener Holzblock von der Größe eines Mannskopfes, hatten zusammen etwas so Abschreckendes, daß es unbegreiflich scheinen mag, wie ich mich zu diesem Auswurf der menschlichen Gesellschaft hingezogen fühlen konnte. Auch sein Aufenthaltsort in dem düstern Webkeller eines auf Schußweite von unserem Hause entfernten einsamen Hofes, wo durch das in einer Grube angebrachte Fensterlein kein Zoll breit Himmel sichtbar war und wohin nie ein Sonnenstrahl dringen konnte, war einem Tierkäfig ähnlicher, als der Wohnstätte eines menschlichen Wesens. Und dennoch saß ich manche, manche Stunde in dieser mit Moos, Schwämmen und giftigen Kräutern bewachsenen Grube, da dann Kleinegli sein blindes Fensterlein öffnete, aus wirrem Blick ein blitzflüchtiges Lächeln entsendete, seinen Kopf in die Öffnung zwängte und mir wunderseltsame Märchen zu erzählen anfing, oder eine Mandoline hervorzog und rührende, selige Weisen spielte. Nun dürfte es schon begreiflicher sein, warum ich zu Kleinegli in die Grube hinunterstieg.
Kleinegli war, wie er mir nach und nach stückweise erzählte, armer Eltern Kind, aus dem Schulkreise Großmoos. In eine Schule war er nie gekommen, dagegen mit zwölf Jahren in eine Nagelschmiede, um das Handwerk zu erlernen. Es ging ihm aber für diesen Beruf nicht nur jede Neigung ab, sondern er war auch zu schwächlich und kriegte schon nach wenigen Monaten Blutspeien. Vergeblich beklagte er sich darüber, weder die Eltern noch der Meister kehrten sich in anderer Weise daran, als daß sie ihn entweder ausschalten oder durchprügelten. Da nahm er in der Verzweiflung Reißaus und strich weit fort über Berg und Tal, gelangte in eine deutsche Stadt und hoffte, irgendeinen seinen Kräften gemäßen Dienst zu finden. Aber der Unerfahrene täuschte sich sehr, er wurde, da er keine Ausweisschriften besaß, von der Polizei aufgegriffen und über die Grenze geführt. Er sollte in seine Heimatsgemeinde transportiert werden, wußte jedoch zu entwischen und floh in die Wildnis, wo er zu einer Bande Heimatloser stieß und sich derselben anschloß. Jahrelang trieb er sich dann an der deutschen und französischen Grenze herum, wobei er als Hausierer, Kesselflicker und vorzugsweise als Musikant ein jämmerliches Leben führte. Für die Musik meinte er mehr als gewöhnliche Anlagen zu besitzen, da er innert vierzehn Tagen das Fagott, mit gleicher Leichtigkeit später mehrere andere Instrumente «mordsgut» spielen gelernt und eine große Geschicklichkeit im Reparieren schadhafter Instrumente besaß. Doch alle Kunst und Geschicklichkeit schützte ihn nicht immer vor der bittern Notwendigkeit, sich zur Fristung seines Lebens langer Finger zu bedienen. Über solchem Tun wurde er ergriffen und für ein paar Jahre an den Schatten gesetzt. In diesem Gewahrsam erlernte er die Weberei. Freigelassen und jetzt wirklich nach Grünau transportiert, wurde er daselbst so hündisch behandelt – wie er zähneknirschend sich ausdrückte – daß er schon am nächsten Tage wieder das Weite suchte. Bald gelangte er an die tirolische Grenze und stieß daselbst nicht bloß zu Heimatlosen, sondern zu einer echten Zigeunerhorde. Diese nahm ihn aus Mitleid, aber mißtrauisch auf. Er aber leistete mehr als sein Äußeres versprach und gelangte bald zu einem gewissen Ansehen bei diesen Leuten.
Ein Mädchen, dessen Name Lotose mir der lieblichen Schilderung wegen, die Kleinegli von ihr machte, unvergeßlich geblieben, wurde seine Geliebte, sie lehrte ihn mehrere Saiteninstrumente, auch die Mandoline spielen und mit Lotose allein durchzog er manches Dorf, manche Stadt, auf Märkten, in Wirtschaften usw. spielend. Aber auch dieses herrliche Leben, dessen Schilderung ihn allemal in eine wehmütig entzückte Stimmung versetzte, endete schon nach drei Jahren und zwar mit der Trennung von Lotose und abermaligem Transport über die Grenze. Doch da er sich jetzt klüglich zu den Heimatlosen bekannte, so unterblieb der Schub nach Grünau noch für längere Zeit, bis eine Wiedererkennungsszene zwischen ihm und einem Landjäger stattfand. Da warʼs mit seiner Freiheit für immer vorbei und er wurde in die Heimat transportiert und daselbst durch den sogenannten «Schlegel», den er, wie oben erzählt, an dem linken Fuße trug, an fernern Ausflügen verhindert. Seine Mandoline hatte er in den sonntäglichen Mußestunden selber verfertigt und sie war sein Trost im Webkeller, wohin die Armenpflege ihn unter Aufsicht eines ehrenfesten Bauern versorgt hatte. Auf der Mandoline spielte er die Weisen, die ihn Lotose gelehrt, dazu zu singen aber war ihm nicht erlaubt, weil der Bauer es für unschicklich hielt, daß ein Almosengenössiger singe. Auch das Musizieren war ihm nur an den Sonntagen gestattet und tat er mirʼs an einem Werktag zu Gefallen, so war das ein Wagnis, das ihm sogar Prügel eintragen konnte. Weil ich aber das einzige Kind war, das sich nicht schämte oder scheute, an seinem Kellerfensterlein zu sitzen, so überwand er die Furcht und ließ mich nie unerhört von dannen gehen.
Weniger heimelig fühlte ich mich bei der Frau eines Barbierers, der jenseits des Hügels hinter unserem Hause nahe bei der Tosa wohnte. Diese Frau suchte uns Kinder oft mit Butterbrot, auch wohl bloß mit geräuchertem Speck zu sich in die Stube zu locken, nicht etwa um Böses mit uns zu treiben, sondern nur, um Jemand zu haben, der ihr ungeheuerliches Erzählungstalent oder ihren unvergleichlichen Gesang bewunderte. Sie befand sich fortwährend auf der Grenze zwischen gesundem Verstande und Verrücktheit und was sie tat und sagte, war auch größtenteils so beschaffen, daß man nicht wußte, ob Wahnwitz oder Schalkheit aus ihr spreche. Doch erzählte sie häufig so befremdliche Dinge, daß sogar wir Kinder ihr Überschnapptsein merkten. Indessen waren es glücklicherweise keine verderblichen Geschichten, sondern meistens solche, über die wir einfach staunten oder lachen konnten. Wenn sie aber mitten im Erzählen stockte, das Spulrad von sich stieß, die Hände unter beiden Knien zusammenknüpfte, uns stier anblickte und mit hohler Stimme sagte: «Jetzt hatʼs mich – jetzt – Kinder, beim teuren Eid, jetzt muß ich sterben!» dann begehrten wir nicht Zeugen ihres Todes zu sein und eilten Hals über Kopf zum Hause hinaus. Die Frau hieß Kathry.
Eines schönen Mondscheinabends trieben wir Kinder uns noch im Tosabett herum an einer Stelle, wo ein gegen vierhundert Fuß hoher Fels das linke Ufer bildet. Derselbe trägt mehrere sogenannte Nasen, klippenartige Vorsprünge, meist mit Gebüsch oder Waldholz bewachsen, dessen bemooste Wurzeln in schwindelnder Höhe und Unzugänglichkeit in die freien Lüfte hinausragen. Die grotesken Figuren, welche das Geschlinge derselben bildete, erregten manchen kindischen Wunsch, einzelne Gebilde herunterholen zu können, aber wir waren überzeugt, daß solches nicht menschenmöglich sei. Jetzt fiel das Mondlicht gerade darauf und das Geschlinge warf gar sonderbare Schatten auf den gelbweißen Fels. Nun kam etwas sich Bewegendes zum Vorschein, wir dachten, es sei ein Wild, die Höhe war zu fern, um etwas deutlich unterscheiden zu können. Langsam warʼs aus dem schmalen Gehölz hervorgekommen und bewegte sich, ein weißliches Gebild, im Zickzack über das Wurzelgeflecht herunter, wo es sich auf der äußersten Kante festsetzte. Nun erklang plötzlich in reinstem Wohllaut die Weise des Liedes: «Ach, es naht die bange Stunde …»
Staunen und Schrecken schoß uns gleichmäßig durch die Glieder – es war Kathrys Stimme, die in schwelgender Volltönigkeit der Klüfte Echo wachrief und dadurch das Geisterhafte der Erscheinung mächtig erhöhte. Wir hörten zu, bis sie einige Strophen gesungen, dann wurden wir einig, ihren Mann von der Begebenheit zu benachrichtigen. Derselbe war etwas dem Trunke ergeben und wir waren sicher, ihn in einer gewissen Schenke zu treffen. Richtig war er gerade noch so nüchtern, um für ein ordentliches Erschrecken disponiert zu sein. Rasch tat sich eine Zahl von Männern zusammen, an deren Spitze der Barbierer, mit Heuseilen wohl beladen, am Waldrande des Gubels hinaufkletterte. Kathry sang noch, ohne ihren Platz verändert zu haben. Der Barbierer gelangte hierauf vermittelst der Seile glücklich in ihre Nähe und brachte die teure Hälfte wohlbehalten auf sichern Boden. Dieser Einfall war ebensowohl abenteuerlicher als verrückter Natur, ja sie foppte uns nachher damit und höhnte uns, als die wir nicht den Mut hätten, es ihr gleichzutun.
Eines Tages, als Kathry uns eben eine schauerliche Geschichte von einem Geisterschloß erzählt hatte, verabredeten wir einen Besuch der «Susannenhöhle», welche in unferner Gebirgsschlucht von einem Felsgrat herabschaut. Der Bergvorsprung, welchem der Fels als Grundmauer dient, heißt Burgbühl und die Sage läßt ein schönes Burgfräulein darin gefangen sitzen, das durch Treubruch sich den ewigen Zorn des Burgherrn zugezogen. Da es unsern Vorfahren oft erschienen und namentlich mein Großvater als Knabe, beim Pflücken von Maiblümchen, so glücklich gewesen war, es zu sehen, so hegten wir den begreiflichen Wunsch, es möchte auch uns einmal erscheinen. Nun denke man sich unsern freudigen Schrecken, als wir diesmal wirklich nicht umsonst hinaufschauten, sondern das Fräulein droben stehen und uns einen Gruß zuwinken sahen. Wir standen steif wie eine Pfahlreihe im Bach, das Wasser strudelte an unsere nackten Beine und leichte Kiesel trieben, ein kitzliges Gefühl erregend, über die Füße, während die Nachmittagssonne durch einen Bergeinschnitt sengende Strahlen auf unsere unbedeckten Häupter abschoß. Das Fräulein trug ein dunkles Gewand, auch das Haupt war von oben bis auf die Augenbrauen mit einem schwarzen Zeuge bedeckt, das Gesicht schien blaß, was nicht befremden konnte an einem Wesen, das ganze Menschenalter hindurch in einer Höhle zubrachte. Wir mochten etwa fünf Minuten sprachlos dagestanden haben, als die Erscheinung in die Höhle verschwand, woher nun aber im gleichen Augenblicke eine so schmelzend wehmütige Weise ertönte, daß uns vor Wonne und Seligkeit fast der Atem verging. Die Weise verlor sich bald in einzelne leise nachtönende Klänge und wir zogen glücklicher als Könige nach Hause, das Geschehene und Gehörte zu berichten. Aber bald nachher verriet Kathry unter vergnügtem Lachen, dass sie es über sich genommen, unsere Sehnsucht nach der Erscheinung des Burgfräuleins zu befriedigen.