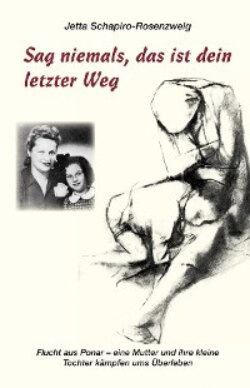Читать книгу Sag niemals, das ist dein letzter Weg - Jetta Schapiro-Rosenzweig - Страница 10
ОглавлениеIm Kloster ist kein Platz für Männer
Ich zog ein Kopftuch an und machte mich auf den Weg nach Wilna. Der Weg zog sich in die Länge. Ich hatte Angst vor jedem, der mir begegnete, Angst, dass man mich als Jüdin erkannte. Ich ging zur Wohnung der Tante und hatte wieder Angst, dass ich meiner Tochter begegnen würde und, dass wir uns bei der Begegnung nicht beherrschen könnten.
Zu meinem großen Glück kam die Tante gerade aus dem Haus. Sie erschrak, als sie mich sah, und bat mich, draußen zu warten. Sie ging ins Haus zurück und brachte zuerst meine Tochter zur Nachbarin, damit wir uns auf keinen Fall begegneten.
Im Haus erzählte ich Jannina zuerst, was wir alles durchgemacht hatten. Sie berichtete dagegen, dass sie meine Schwester Mizia und ihren Sohn Samek im Kloster untergebracht hatte. Sie hatte die beiden aus dem Ghetto in Wilna herausholen können. Auch mich wollte sie ins Kloster bringen; allerdings hatte sie für meinen Mann und Jonas, den Mann meiner Schwester, noch keine sichere Bleibe gefunden.
Zunächst bereitete Jannina mir eine warme Mahlzeit und half mir, mich etwas hinzulegen und zu entspannen. Aber das war mir unmöglich. Ich bedachte den Plan, den mein Mann sich ausgedacht hatte. Er wollte mich im Kloster in Sicherheit bringen – aber das bedeutete Trennung – und ich wollte lieber mit meinem Mann zugrunde gehen als ihn allein zu lassen. Ich lag da und weinte, und Jannina sprach mir gut zu. Sie wollte versuchen, die Klosterfrauen zu überreden, dass Jascha bei mir bleiben dürfe. Auch Mizias Ehemann hatte darum gebeten, mit ins Kloster kommen zu dürfen. Aber im Kloster gab es keinen Platz für Männer. Trotzdem hoffte Jannina, dass die gutherzigen Nonnen ihr helfen würden, für die Männer auch eine Bleibe zu schaffen. Am Abend mietete Jannina eine Kutsche und wir fuhren zum Kloster, das sich in der Wilnaer Straße befand. Wir betraten zuerst die Kirche. Meine Tante wies mich an, niederzuknien. Sie selbst verschwand in den dunklen Gängen. Ich blieb allein zurück. Schon schmerzten meine Knie vom langen knien, da berührte mich Jannina an der Schulter. Mühsam erhob ich mich und trat aus der Kirche in die Ignazgastraße. Vor einem schweren Eisentor läutete Jannina an einem Eisenkreuz, das neben dem Tor hing. Eine Glocke ertönte im Inneren, das Tor öffnete sich und eine Nonne stand uns gegenüber, ganz schwarz gekleidet, nur mit einem weißen Schal über dem Kopf. Sie nahm meine Hand und führte mich, während Jannina zurückblieb. Wir durchquerten viele Gänge: ein Gang, ein zweiter, dritter und vierter; Gänge ohne Ende, lang und dunkel. Mir kam es vor, als ob ich nie wieder aus diesem Labyrinth herausfinden würde. Dann standen wir vor einer Tür, sie öffnete sich und da stand Mizia vor mir. Wir umfassten uns und weinten zusammen; ich merkte nicht einmal, dass wir nicht allein bei-einander waren. Mizias Sohn schlief gerade. Das war im September 1941.
Meine Schwester erzählte mir, dass sie sich im Ghetto von unserer Mutter getrennt hatte. Sie hatte die Mutter gedrängt und angefleht, mit ihr zu kommen, aber die Mutter hatte geantwortet: »Ihr Kinder seid noch jung und müsst auch für eure Kinder sorgen und jeden Weg zur Rettung versuchen. Ich selbst will nicht weg, ich will mit eurem Vater zusammenbleiben.«
Nun verstand ich, was das bedeutete: unser guter, lieber Vater war nicht mehr am Leben. Nur wenige Zeit danach ist auch unsere Mutter gestorben.
Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, erhebt sich wieder vor mir die Gestalt meiner lieben, barmherzigen und klugen Mutter, deren Seele aus den Vernichtungswäldern Ponars zu der unseres Vaters aufstieg. So zu sterben hatte sie sich in den guten Jahren vorher nicht vorstellen können.
Wir weinten die ganze Nacht. Schließlich versiegten unsere Tränen. Am Morgen kamen zwei Nonnen zu uns herein. Die ältere war die Oberin oder Klostermutter, die andere ihre jüngere Schwester, sie war sehr hübsch. Ihr Name war Schwester Lisa. Sie brachten uns Frühstück und wollten von den Ereignissen in Ponar hören. Wie sie uns berichteten, wurden neuerdings auch viele christliche Geistliche nach Ponar zur Zwangsarbeit herangezogen. Sie wiesen uns an, dass wir uns, außer dem Gang zur Toilette, möglichst nur in unserem Versteck aufhalten und dass wir auch die Nähe der Fenster meiden sollten. Nur vier Schwestern wussten von unserer Existenz. Das waren die Oberin Matuschka, Schwester Lucia, Schwester Benedikta und Schwester Malvina, die vom Juden- zum Christentum übergetreten war und nun schon seit vierzig Jahren im Kloster lebte. Ich erzählte ihnen von meinem Mann, der sich immer noch in dem leeren Haus in Ponar inmitten von Mördern verstecken musste. Die Schwestern hörten mit Tränen in den Augen zu und verließen leise das Zimmer.
Mittag- und Abendessen brachte uns Schwester Benedikta. Am nächsten Morgen beim Frühstück sagte ich Schwester Benedikta, dass ich leider nicht bleiben könne. Ich bedankte mich für die herzliche Aufnahme im Kloster. Da mein Mann in so großer Gefahr sei, müsste ich zu ihm zurück. Ich hatte meine Schwester und ihren Sohn gesehen, vom Tode meines Vaters erfahren und jetzt müsste ich zurück. Ich konnte nicht dort schlafen und essen, während mein Mann Hunger litt und sich verstecken musste. Wenn wir sterben müssten, dann wollten wir zusammen sein.
In der Mittagszeit kamen Matuschka und Schwester Lucia und überbrachten eine frohe Nachricht. Es war beschlossen worden, dass unsere Männer auch ins Kloster gebracht werden sollten. Voller Freude küssten wir den Schwestern die Hände.
Nun war zu überlegen, wie das zu bewerkstelligen war. Da wusste meine Schwester Rat. Sie hatte einen Nachbarn, einen frommen Christen, der uns behilflich sein konnte. Er wollte mit Tante Jannina nach Ponar fahren. Sein Name war Wladek.
Jannina brachte ihn zu uns, und wir machten gemeinsam Pläne, wie man die Männer ins Kloster bringen könnte. Herr Wladek sollte am Abend mit dem Fahrrad nach Ponar fahren und bei Frau Kaschiozowa übernachten. Früh am Morgen sollten sie meinen Mann als Bahnarbeiter verkleiden und mit dem Fahrrad ins Kloster bringen. Nachts, während der Sperrstunde, durfte man nicht fahren.
Alles hatte sehr gut geklappt – am nächsten Morgen um 11 Uhr war mein Mann bei mir im Kloster. Unsere Begegnung war für alle so rührend, dass sogar die Schwestern weinten.
Die nächste, viel schwierigere Aufgabe war es, den Mann meiner Schwester herzubringen. Das war eine große Herausforderung. Er arbeitete in einem Werk unter Aufsicht der deutschen Polizei. Dort wurden Verbrennungsstoffe hergestellt.
Er bekam einen Brief von Wladek, darin stand, er solle sich nach der Arbeit im Feld verstecken und nachts versuchen, einen bestimmten Ort im Wald zu erreichen, wo Wladek auf ihn warten wollte. Am nächsten Morgen in der Frühe wollten sie gemeinsam versuchen, das Kloster zu erreichen. Das alles war ein sehr risikoreiches Unternehmen, aber zum Glück ging alles gut. Für einen Mann mit schwarzem Vollbart war es nicht einfach, ins Kloster zu gelangen. Die Stunden, die wir wartend verbrachten, zogen sich sehr schwer hin – jede Minute kam uns wie eine Ewigkeit vor. Damals dachten wir, dass es nicht schlimmer werden könnte, aber es kamen Tage über uns, wo wir an diese Klosterzeit wehmütig zurückdachten.
Wir wohnten zu fünf Personen in einem Zimmer mit zwei Fenstern, die mit Vorhängen verhüllt waren. Zwei eiserne Betten standen darin. Es war ein bisschen wie eine Kaserne, aber für uns war es ein Paradies des Friedens. In der Diele befand sich eine Toilette mit Duschgelegenheit, noch aus der Zeit der Benediktinerschule. Der Winter 1941/42 war sehr kalt, und die Toilette fror häufig zu. Ich hatte das Amt des Installateurs, kochte täglich Wasser auf und goss es in die Toilette, so dass man sie immer benutzen konnte. Überhaupt hatten wir alle unsere Beschäftigungen. Mein Mann und mein Schwager waren mit der Pflege der Bibliothek beschäftigt. Die Bibliothek des Klosters war sehr umfangreich, und viele Bücher waren beschädigt. Diese Arbeit leisteten sie gern, betrachteten sie als Unterhaltung und als Entgelt für den Aufenthalt im Kloster. Meine Schwester beschäftigte sich mit Nähen und flickte die ganze Unterwäsche der Schwestern. Ich strickte sämtliche Jacken und Pullover der Nonnen. Diese Arbeit war angenehm, und wir verbrachten täglich wohl zehn Stunden damit. An den einsamen Abenden saßen wir zusammen und erzählten uns aus unseren Erinnerungen.
Ich erinnere mich, wie mein Mann von der Zeit erzählte, die er allein in dem verlassenen Haus verbracht hatte. Gegen Abend ging er stets zu Frau Kaschiozowa. Sie gab ihm Essen und berichtete, was alles geschehen war. In unserer Zeit in Ponar hatten wir einen Hund gehabt. Beim Verlassen unseres Hauses hatten wir ihn weggegeben. Eines Tages sah mein Mann einen Hund, der ihm jaulend entgegenkam. Es war unser alter Hund. Im Finsteren saßen sie beide zusammen und beide weinten sie. Der Hund ging ihm nach bis zum Haus von Frau Kaschiozowa und wollte nicht von seiner Seite weichen. Die Frau erschrak und sagte, es sei zu gefährlich. Durch den Hund könnte die Gestapo auf seine Spur kommen und auch sie sei dann gefährdet. So musste sie den Hund an einen anderen Ort bringen.
Samek, mein Neffe, lebte in seiner eigenen Welt. Er malte und zeichnete. Die Nonnen waren begeistert, sie verschafften ihm Papier und Farben. Eines der Bilder ist mir in Erinnerung geblieben: es zeigt Jesus nicht als wehmütigen, sondern als zornigen Gott, voller Zorn wegen allem, was auf der Welt geschieht. Die Nonnen hängten dieses Bild im Kloster auf. Es wirkte nicht wie das Werk eines kleinen Jungen, sondern wie das eines fertigen Malers. Die Ruhe im Kloster und die Orgelmusik hatte eine eigenartige Atmosphäre um uns geschaffen, und das kam in seinen Bildern zum Ausdruck. Auch das, was sich draußen, hinter der Kulisse des Klosterfriedens ereignete, hinterließ tiefe Spuren in seinem Herzen.
So lebten wir ein halbes Jahr. Täglich kamen Horror-Nachrichten aus dem Ghetto. Am Jom Kippur ist, wie wir hörten, unsere Mutter und auch die Mutter von Janusch umgekommen. Wir waren ganz verzweifelt, aber wir wagten kein lautes Wort zu sagen.
Eines Tages kam die Oberin Matuschka zu uns und erzählte, dass sie noch vier junge Mädchen aufgenommen habe, die aus dem Ghetto entkommen konnten. Eine davon war Lolka Feldstein, die Tochter eines bekannten Zahnarztes. Die Oberin war sehr ängstlich, sie erzählte, dass die Deutschen neuerdings auch sämtliche Klöster durchsuchten. So kamen wir zu dem Entschluss, uns eine andere Bleibe zu suchen. Jonas und Jascha gingen mit der Oberin, etwas Geeignetes für uns zu finden. Außer den vier erwähnten Nonnen wusste niemand von unserem Verbleib. Was sie alles für uns geleistet haben, können wir nicht genug anerkennen. Sie setzten ihr Leben für uns aufs Spiel und wir konnten ihnen nichts dafür zurückgeben. Die Nahrung war knapp und sie musste für neun Personen reichen. Dreimal am Tag bekamen wir unser Essen, viermal in der Woche sogar mit Fleisch, sonst mit Milch. So waren wir alle satt, wir konnten uns sauber halten, waren warm und geschützt. Auch Aufmerksamkeit und Liebe wurde uns zuteil; jeden Abend kam die Oberin zu uns herein, und wir konnten ihr viel über unser Leben erzählen, von der Zeit vor dem Krieg, unseren Verwandten und allem anderen. An allem war sie sehr interessiert. Außer ihr kam auch manchmal Schwester Lucia. Sie war in ihren mittleren Jahren und sehr schön. Daher fragten wir sie, warum sie ins Kloster gegangen war, und sie erzählte uns, dass dies seit ihrer Kindheit ihr innigster Wunsch gewesen war. Ihre Familie war ganz dagegen und sie musste kämpfen, um ihr Ziel zu erreichen. Ihre ältere Schwester war bereits im Kloster, sie war ihrer Schwester und ihr selbst ein Vorbild. Es war nicht leicht, dieses Ziel zu erreichen, es gehörte eine gewisse Bildung dazu und vor allem eine große Liebe zu Jesus. Drei Jahre musste sie eine strenge Probezeit in einem fremden Kloster durchmachen. Aber sie bestand alle Prüfungen mit Bravour, und der glücklichste Tag in ihrem Leben war der, an dem sie zu ihrer Schwester ins Kloster gehen durfte. Jetzt waren es bereits zehn Jahre, dass sie in diesem Kloster lebte. Wir haben sie bewundert und geliebt, und jeder ihrer Besuche war für uns wie ein Feiertag.
Wir hatten wenig Kontakt nach außen. Außer Wladek sahen wir nur Lolka Feldstein, die jeden Abend zu uns kam. Sie hatte einen Bruder im Ghetto, aber sie durfte es nicht wagen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Durch sie waren wir von der äußeren Welt nicht ganz abgeschnitten und wussten, was um uns herum passierte. Am wichtigsten war uns natürlich die Lage im Ghetto.
In der Familie war Tante Jannina unser einziger Trost. Durch sie hörten wir alles über meine kleine Tamar, ihre Appetitlosigkeit, ihre Schlagfertigkeit und überhaupt über ihre Entwicklung. Außer für sie sorgte Tante Jannina noch für ein jüdisches Mädchen, dem sie arische Papiere besorgt hatte, und deren Schwester, die in einem Dorf lebte.
Diese beiden Mädchen waren eigentlich unsere Tanten. Das kam so: Unser Opa war sein ganzes Leben lang ein Bauer und führte ein arbeitsreiches, schweres Leben. Als seine Frau starb war er schon 74 Jahre alt. Seinen Weizen ließ er immer im Nachbarort mahlen, der Bauer dort war ein frommer Jude. Dieser hatte eine viel jüngere Frau. So jung und schön sie war, hatte sie doch einen schlechten Ruf und man sagte, ihre Kinder hätten viele Väter. Mein Opa mied sie und spuckte bei ihrem Anblick verächtlich auf den Boden. Als nun aber ihr Mann gestorben und sie eine Witwe war, fing mein Opa an, sie zu besuchen und er brachte Gemüse und Obst von ihr mit. Eines Tages erhielten wir von ihm durch Bauern aus dem Dorf eine Fuhre Kartoffeln für den ganzen Winter, Gemüse und Obst. Durch sie erfuhr mein Vater, dass der Opa in seinem Alter diese Frau geheiratet hatte. Das brachte meinen Vater in Rage und er wollte von Opa gar nichts mehr annehmen. Es stellte sich aber heraus, dass die Witwe all ihre Kinder gut untergebracht hatte. Mit 45 Jahren heiratete sie unseren Opa und bekam noch zwei Kinder mit ihm, zwei Mädchen. Das eine hieß Sara Guta, das andere Meitke Guta. Das Verhältnis zum Opa wurde wieder besser. Er bat auch meine Mutter, sich der Mädchen etwas anzunehmen, damit sie keine Gojim würden und damit sie etwas lernten. Zumindest Lesen und Schreiben sollte man ihnen beibringen. Er bat sie so lange, die Kinder zu sich zu nehmen, bis sie einwilligte. Meinem Vater war das gar nicht recht, da er immer noch über den Opa verärgert war. Aber eines Tages kam ein Bauer und brachte uns die beiden blonden Mädchen. Mutter sagte: »Kinder, seid doch nett zu ihnen, es sind doch eigentlich eure Tanten.«
Sie hatten sogar eine gewissen Ähnlichkeit mit uns. Doch sie standen in der Ecke und waren ziemlich verstört. Meine Schwester Mizia umarmte sie gleich und gab ihnen auch von unseren Spielsachen ab. Sie waren beide sehr schüchtern und sprachen nur untereinander. Vor uns hatten sie Angst und blieben am liebsten in der Küche. Dort unterhielten sie sich mit den Dienstboten. Mutter bestellte für sie Privatlehrer, um sie für die Schule vorzubereiten, aber sie wollten gar nichts lernen, wir fanden sie richtig »vernagelt«. Wir Kinder versuchten ihnen beizubringen, dass sie lernen sollten und wollten mit ihnen diskutieren. Doch es half alles nichts. Mutter gab sie dann zu einer kinderlosen Familie, die sie betreute – gegen Zahlung natürlich. Als sie 12 und 13 Jahre alt waren und immer noch nicht lernen wollten, beschloss meine Mutter, dass sie einen Beruf erlernen sollten. Wir Kinder sahen sie jetzt nur noch gelegentlich am Sonntag und hatten keinen vertraulichen Ton mehr mit ihnen, schließlich waren wir ja auch erwachsener geworden.
Als mein Opa 84 Jahre alt geworden war, erkrankte er – zum ersten Mal in seinem Leben. Der Arzt sagte, das Leben im Dorf sei zu schwer für ihn geworden. Also kam er zu uns. Vater hat ihm verziehen und er blieb bei uns wohnen. Zwischen ihm und dem Personal kam es wegen der jüdischen Speisegesetze öfter zu Unstimmigkeiten. Von meiner Mutter bekam er jede Woche Geld, aber das trug er immer sofort auf die Bank, als Aussteuer für seine Töchter. Sie besuchten ihn regelmäßig an jedem Schabbat3. Da sie ja Tante Janninas Stiefschwestern waren, besorgte diese ihnen arische Papiere. Eine von ihnen beschäftigte sie als Dienstmädchen bei sich, die andere wurde im Dorf auf ihre Kosten untergebracht.
Das Dienstmädchen hieß Helene (Halinka), sie war immer sehr gut zu unserer Tochter in der Zeit, als diese bei Tante Jannina untergebracht war. Sie hat den Krieg überlebt und lebt jetzt in Schaulen und wir sind noch immer mit ihr in brieflicher Verbindung. Die andere Schwester haben wir nach dem Krieg nicht mehr gesehen.
Unser Opa ist mit 90 Jahren gestorben. Bis zu seinem Tod brauchte er keine Brille und hat auch nie einen Stock benutzt. Bis zuletzt hatte er seine eigenen Zähne. Er trug allerdings eine Brille, jedoch ohne Gläser. Wenn man ihn fragte warum, so antwortete er: »Um meine Augen zu schützen.« Wenn die Leute herausbekämen, dass er noch sein gutes Sehvermögen habe, so dachte er, würden sie ihm Böses wünschen und das könnte schlecht für ihn ausgehen. Er vergötterte unsere Mutter und ist mit ihrem Namen auf den Lippen gestorben.
Nun wende ich mich wieder unserem Leben im Kloster zu. Jeden Tag erreichten uns neue schlechte Nachrichten. Es hieß, die Klöster würden durchsucht. Die Bauern wurden daran gehindert, ihre Lebensmittel ins Kloster zu bringen, sie wurden durchsucht und ihre Waren wurden ihnen abgenommen. Trotzdem mussten wir nicht Hunger leiden, denn die Schwestern teilten mit uns jeden Bissen. Schwester Lucia pflegte immer optimistisch zu sagen: »Kinder, nur die Hoffnung nicht verlieren, wir werden Hitler noch überleben!«