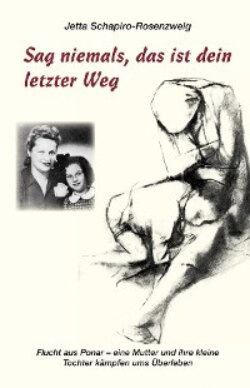Читать книгу Sag niemals, das ist dein letzter Weg - Jetta Schapiro-Rosenzweig - Страница 7
ОглавлениеDer Anfang: Von Wilna nach Ponar 1941
Meine Heimat war Wilna, eine polnische Stadt nahe der litauischen Grenze. Wilna ist auch bekannt unter dem Namen »Jerusalem Delita«. In unserem Wilna erhielten sich viele alltägliche jüdische Gebräuche und volkstümliche Werte. Nicht nur die Elite konnte sich mit ihrem Namen rühmen, auch der einfache Mensch konnte sich dort entfalten. Das besondere an Wilna spiegelte sich in den Gesprächen zwischen den Holzfällern auf dem Holzmarkt, auf dem Schulhof in der Judengasse, in einer der Synagogen, es war das saftige Wilnaer Jiddisch.
1941 war Litauen schon von der Sowjetunion eingenommen worden und Deutschland hatte Polen schon ganz erobert. In diesem Jahr brach der Krieg zwischen Deutschland und der Sowjetunion aus.
Jetzt, da ich den Versuch unternehme zu schildern, was wir erlebt haben, sowohl in Wilna, unserer Geburtsstadt, als auch in Ponar, während unserer Wanderungen in der Fremde, erscheint es sogar für mich, obwohl ich alles tatsächlich erlebt habe, schwer zu glauben, dass es in Wirklichkeit geschah.
Beim Erzählen wird sich hier und da ein Bild einschleichen von den guten Zeiten in der schönen Landschaft rund um Wilna, mit ihrem Hügeln ringsherum, dem Wilia-Fluss, den Brücken und Stränden. Nicht zu vergessen die Wangerskastraße neben dem Bäumemarkt (Holzmarkt). Dort habe ich eine glückliche Jugend in einem angesehenen jüdischen Haus verbracht.
Die Eigenart des Hauses bestimmten Vater und Mutter, jeder eine Persönlichkeit für sich. Besonders stark ist die Erinnerung an das Jahr 1940, an die Feste Purim und Pessach1. Sie verkörpern für uns eine Epoche, die leider zu Ende ging. Das Purimfest (ähnlich dem Karneval) war für uns etwas Besonderes. Die Geburtstage sowohl meiner Schwester Mizia als auch meines Bruders Jerachmiel, der damals schon in Palästina lebte, der Hochzeitstag der Eltern und der Geburtstag meiner Tochter fielen alle auf diesen Zeitpunkt. Der Ursprung des Festes – Hamans Niedergang und die Rettung Mordechais und des Jüdischen Volkes in Persien – dieses Wunder aus der Ester-Rolle konnte ein historisches Zeichen mit hoffnungsvoller Bedeutung für die Zukunft sein.
Dies alles geschah, als Wilna von den Sowjets an die Litauer übergeben wurde. Obwohl die Litauer den Juden nicht gut gesonnen waren, konnten wir eine kurze Zeit in Ruhe unser Leben weiterführen.
Das Purimfest war für uns das fröhlichste und interessanteste von allen Festen. Auch in diesem Jahr brachte es Aufregung und Freude in unsere Familie. Wir waren voller Zuversicht, dass alles sich zum Guten wenden würde. Viele Gäste versammelten sich bei uns. Ich kann mich an die Torte erinnern, die meine Schwiegermutter uns schickte. Wiera, die Mutter meines Mannes, deren Name noch öfter im Buch genannt werden wird, war eine Frau von Adel. Sie bestellte die Torte in einer der bekanntesten Konditoreien Wilnas. Ich kann mich erinnern, dass die Torte aus lauter Muscheln bestand und jede war gefüllt mit Eis. In der Mitte war eine besondere Konstruktion, die Licht verbreitete. Selbstverständlich haben auch Hamantaschen und Kreplach (dreieckiges Gebäck, mit Mohn gefüllt und eine Fleischbeilage in Teig) nicht gefehlt. Wiera stammte aus der Familie Riwkind, die in Wilna hoch angesehen war. Leiser Riwkind besaß die besondere Erlaubnis in den Narutz-Seen zu fischen. Ihr Bruder, Dr. Riwkind, war Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Etliche aus dieser Familie waren bei unserem Fest anwesend. So wie jedes Jahr, wurde das Fest mit vollen Obstkörben begangen, die ins Haus geliefert wurden. In Anbetracht dessen, dass die Hauptbeschäftigung unserer Mutter in der Führung eines Obst- und Gemüsegroßhandels bestand, durfte das Obst im Haus nicht fehlen.
Die ersten, die zum Fest kamen, waren Mizia, meine Schwester und ihr Mann Jonas. Sie reihten sich in die Festgesellschaft ein und standen wie üblich in ihrem Mittelpunkt. Trotz der guten finanziellen Lage unserer Familie hatte sich im Unterbewusstsein die Sorge verbreitet, die in einer Bemerkung meiner Mutter zum Ausdruck kam. Dies hatte sie in jiddisch gesagt: »Gott soll geben, meine Kinder, dass unsere Lage sich nicht verschlechtern soll, ›nicht schreib und nicht meck‹.«
Die Weine in unserem Haus brauchte man nicht anderweitig zu besorgen. Eines der Hobbys meines Vaters war die Weinherstellung. Hunderte von Weinen verschiedener Sorten befanden sich in unserem Keller. Jede Weinflasche war mit einem Etikett versehen auf dem das Herstellungsjahr und die Art der Zubereitung genau verzeichnet wurden. Im Obst- und Gemüsegroßhandel hatte meine Mutter die Oberhand. Sie leitete dieses Geschäft mit großem Elan und die Angestellten gehorchten ihr aufs Wort. Mein Vater war mit seinen Hobbys beschäftigt, denn außer dem Wein hatte er noch andere.
Die Gäste tranken »Lechaim« und die gute Laune stieg im Laufe des Abends. An diesem Tag war auch der Geburtstag meines Bruders Jerachmiel. Auf sein Wohl wurde ebenfalls so manches Glas gehoben.
Am Purimfest pflegte mein Vater Weinflaschen an seine engsten Freunde zu verteilen. Sie alle waren »koscher lepesach« (geeignet zum Verzehr am Pessachfest).
Beim Erwähnen des Wortes Pessach kommen mir Erinnerungen an die früheren Zeiten vor 1940, an die Pessachfeste bei uns im Hause. An Großvater mit seinem weißen Kittel. Er leitete den Sederabend genau nach den religiösen Vorgaben, angefangen bei der gründlichen Säuberung des Hauses bis hin zum Herrichten des Sederabends. Die Leckereien zu Pessach waren uns Kinder am liebsten. Sie wurden immer versteckt, doch wir hatten sie vorher im Geheimen ausgekundschaftet und genascht. Unsere Mutter hatte es ganz und gar nicht gut gefunden und war außer sich vor Wut. Ich erinnere mich an meines Vaters Worte: »Sich aufzuregen über solch’ Lappalie hat wenig Sinn. Bei ›Beszetnikes‹ (bei Kinderlosen) wäre es nicht passiert. Bei uns ist es eben passiert, also soll es ihnen wohl bekommen. Alles, was sie gegessen haben, soll aus der richtigen Stelle rauskommen und es soll, um Gottes willen, nicht drinnen bleiben.«
Es sind so viele Erinnerungen, die in meinen Kopf herumschwirren! Diese Volkstümlichkeit und Herzlichkeit, die in unserer Familie herrschte, ist mit Worten nicht auszudrücken. In unserer Familie gab es viele Persönlichkeiten, und jede verkörperte etwas besonderes. Eine davon war mein Opa, Vater meiner Mutter, der mit zwanzig Jahren erblindete. Er war ein Wissenschaftler im technologischen Bereich. Bei einem seiner Experimente verletzte er seine Augen. Trotz aller ärztlicher Bemühungen blieb er blind. Der »blinde Techniker« wurde er in Wilna genannt. Trotz des Unglücks wurde er durch verschiedene Erfindungen bekannt. Er wurde zu sämtlichen Wohltätigkeitsveranstaltungen eingeladen. Er konnte eine Maschine auseinandernehmen und wieder zusammenbauen vor dem staunenden Publikum. Er pflegte mit einer besonderen Maschine herrliche Blumenmuster zu gestalten und dies trotz seiner Erblindung. Sein Name war Arno Nadel.
Als die Russen Wilna besetzten, beschlagnahmten sie mein Nähmaschinen- und Fahrradgeschäft und auch den Gemüsegroßhandel meiner Mutter »Agrimkal – Import und Export Großhandel«. Meine Mutter glaubte damals, dass dies das größte Unglück sei, das uns zustoßen könnte. Zwei Wochen später bekamen wir die Anweisung vom Wohnungsamt, wonach wir innerhalb von achtundvierzig Stunden unsere Wohnung räumen sollten. Diese Wohnung, sechs Zimmer in der Kajaweskestraße Nr. 2a bewohnten unsere Eltern bereits seit einigen Jahren. Das waren mein Vater, Chanan Jochel, meine Mutter Schifra, mein Bruder Izchak und wir selbst mit unserer Tochter Tamar, die damals drei Jahre alt war. Meine Schwester Mizia, ihr Mann Jonas und ihr Sohn Samek wohnten in der Vilnastraße, gegenüber dem Benediktinerinnen-Kloster. Unser ältester Bruder Jerachmiel lebte damals wie erwähnt bereits in Palästina.
Mit der Forderung, die Wohnung zu räumen, brach unsere Welt zusammen. Wir versuchten alles, um für die Auflösung der Wohnung eine Woche Aufschub zu bekommen. Die Antwort war: »Nicht einmal eine Stunde!«
Wir hatten keine Wahl. Wir mussten eine neue Bleibe suchen. Meine Eltern zogen zu Jonas’ Eltern, dort bekamen sie ein Zimmer. Als wir eine Wohnung fanden, erklärte man uns im Wohnungsamt, dass sie bereits vergriffen sei. Die letzte Rettung waren zwei Zimmer in Ponar.
Ponar war eine Bahnstation mit ein paar Häusern und Gärten, von Wäldern umgeben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten keine Juden dort gewohnt. Mein Mann arbeitete in einer Ledergerberei als zweiter Ingenieur, ich selbst fand eine Stelle in einem Kooperativ-Laden für Nähmaschinen. Es ging uns nicht schlecht, wir hatten noch Lebensmittel aus der guten Zeit. Unser Kindermädchen Nani war mit uns nach Ponar gekommen und arbeitete für uns wie früher. Aus den Wäldern hörte man immer Geräusche. Die Nachbarn erzählten, dass die Russen dort Betonbehälter für Brennmaterial bauten.
Die Idylle dauerte bis zum 22. Juni 1941. Diesen Tag werde ich niemals vergessen. Ich hatte die gesamte Belegschaft der Gerberei zum Mittagessen eingeladen. Sie sollten um 13 Uhr mit dem Zug ankommen. In der Wohnung war Hektik, man kochte, briet und backte. Jascha, mein Mann, stellte Tische auf die Terrasse, nebenbei hörte er auch Radio, es war zehn Minuten vor Zwölf. Er kam zu mir und sagte, dass ich um Punkt 12 Uhr auf die Terrasse kommen solle, weil eine wichtige Meldung durchgegeben werde sollte. Dann war es zwölf Uhr. Wir standen alle auf der Terrasse und hörten die Meldung:
»Achtung, Achtung, hier spricht Molotow. Heute Vormittag haben die Deutschen uns angegriffen. Der Krieg zwischen der Sowjetunion und Deutschland ist ausgebrochen.«
Plötzlich hörten wir den ersten Aufprall einer Bombe, die in unserer Nähe explodierte. Die Fensterscheiben gingen zu Bruch. Dann wieder eine Explosion. Der Tunnel von Ponar wurde bombardiert. Wir waren wie versteinert. Dann liefen wir rasch in den Kartoffelkeller und versteckten uns dort. Nach einer Weile wurde es ruhiger und wir gingen hinaus auf die Straße. Dort begegneten wir Leuten, die offenbar die Meldung im Radio nicht gehört hatten. Sie hatten gedacht, es handele sich um Militärübungen. Doch schon am nächsten Morgen sahen wir auf der Straße hinter unserem Haus deutsche Soldaten auf Motorrädern, Militärfahrzeugen und auch Panzer.
Kurz vor dem Einmarsch der Deutschen hatten wir in Ponar einen Angestellten der NKWD kennengelernt. Der Abstammung nach war er Jude, aber er war mit einer Christin verheiratet. Er pflegte die jüdischen Familien zu besuchen und hatte uns dabei nicht ausgeschlossen. Die Wahrheit ist, dass wir davon nicht begeistert waren. Die ganze Zeit führten die Russen Kolonnen von Häftlingen durch Ponar nach Russland. Eine Kolonne hatte sich bei uns auf dem Bahnhof aufgehalten, und wir eilten dorthin, um den Gefangenen zu helfen. Sie baten um Wasser, und wir reichten es ihnen. Das hatte dem Angestellten der NKWD nicht gefallen. Er fand, wir sollten den »Kulaken« nicht helfen. Diese Leute wurden zur Zwangsarbeit nach Russland transportiert, und wir waren seit diesem Zwischenfall überzeugt, dass er auch bei uns nach »Kulaken« suchte, um sie zu verschleppen.
An dem Sonntag, als der Krieg anfing, kam er zu uns und bot uns an, mit ihm zu fliehen. Er sagte, dass ihm ein Auto zur Verfügung stünde, wir sollten keine Zeit verlieren, schnell unsere Sachen packen und mit ihm gehen. Wir bedankten uns bei ihm, doch auf seinen Vorschlag gingen wir nicht ein. Damals konnten wir uns nicht vorstellen, dass man alles zurücklassen kann, dass wir unsere Familie, die sich in Wilna befand, zurücklassen könnten, ohne uns von ihnen zu verabschieden. Mit diesem Gedanken konnten wir uns nicht abfinden.
In Ponar wohnten noch zwei andere jüdische Familien. Familie Mandelbaum – ein reicher Kaufmann aus Wilna mit Frau und Tochter – und ein zweites Ehepaar, etwa fünfzig Jahre alt, aus Litauen: Familie Panis. Sie zitterten vor Angst, denn sie wussten nicht, wo sie ihr Gold und ihren Schmuck verstecken sollten. Bald zog das Ehepaar Panis zu uns. Am dritten Tag des Krieges hörten wir vom Wald, der hinter unserem Haus lag, Maschinengewehrsalven. Doch wir wussten nicht, was es zu bedeuten hatte. Die Nachbarn erzählten uns, dass dort Juden hingerichtet würden. Aber das konnten wir nicht glauben, wir dachten, dass es antisemitische Äußerungen seien.
Das tägliche Leben hatte sich wieder etwas normalisiert; Brot konnte man schon wieder kaufen. Ich traute mich auf die Straße und reihte mich in die Warteschlange ein, um einen Laib Brot zu bekommen. Zu meinem Entsetzen sah ich ganze Kolonnen von Menschen, ein paar Hundert an der Zahl, die an uns vorbeigetrieben wurden. Vorne gingen die Jungen, die noch imstande waren zu gehen, hinter ihnen Alte, Behinderte und Kranke. Ich versuchte in den Menschenkolonnen Leute zu finden, die ich vielleicht kannte, doch meine Augen waren so blind von Tränen, dass ich niemand erkennen konnte. Jetzt wusste ich, dass meine Nachbarn die Wahrheit gesprochen hatten. Ich eilte nach Hause, zog die Rollläden herunter und schrie Joschka, meinem Mann, zu: »Verstecke dich, man schießt Juden nieder!«
Gegenüber unseres Hauses stand eine Villa, die von Deutschen besetzt war. Wir konnten sehen, wie man dort Menschen jüdischer Abstammung hineinführte. Jeder bekam eine Schaufel in die Hand, und zwei Polizisten trieben sie auf den Wald zu. Eine viertel Stunde später hörte man schon Schüsse. Die Kinder kletterten auf die Bäume, damit sie besser sehen konnten. Man erzählte uns, dass dort von etwa zwanzig Menschen Gräber geschaufelt würden. Sie schaufelten ihr eigenes Grab. Wir zählten die Schusssalven und waren schon bei der 15. Salve angekommen. Das bedeutete, dass bereits 300 Menschen dort niedergeschossen worden waren.
Vier Nächte waren wir mit dem Eingraben und Verstecken von wertvollen Sachen beschäftigt, als die Nachricht durchkam, dass wir Schmuck, Geld, Gold, Rundfunkgeräte, Fahrräder und Proviant bei der deutschen Kommandantur abgeben müssten.
Ganze Nächte haben wir gegraben, um unsere wertvollen Sachen zu verstecken, doch allmählich wurde uns bewusst, dass das überhaupt nicht so wichtig war. Nun kam es nur noch darauf an, überhaupt am Leben zu bleiben. Wir mussten erkennen, dass unschuldige Menschen ums Leben gebracht wurden, deren einziges Vergehen es war, Jude zu sein. Mit diesem Gedanken zu leben war sehr schwer. Wir trösteten uns damit, dass alles ein böser Traum sei, der bald zu Ende gehen würde.
Aber der Wahrheit mussten wir doch ins Auge sehen, und uns wurde klar, dass die Gräueltaten im Wald bekannt werden mussten, damit die Juden in Wilna erfuhren, dass sie nicht zur Arbeit geführt wurden, sondern in den Tod.
Uns war es zunächst wichtig, für die Männer, Jascha und Herrn Panis, ein Versteck zu schaffen. Wir stellten eine große Kiste in den Keller und deckten sie von allen Seiten mit Kartoffeln zu. Für die Atemluft gab es einen großen Behälter, von dem ein Schlauch an einer versteckten Stelle herausführte. So waren die beiden geschützt und konnten atmen.
Eine ganze Kompanie Litauer kam ins Dorf. Sie standen unter dem Befehl eines Mannes namens Kosiok. Schon seinem Gesicht sah man den Verbrecher an. Die Aufgabe der Litauer war es, die Gräber im Wald mit Sand zuzuschütten und die Kleidung der Toten zu sammeln und mitzunehmen. Abend für Abend luden sie Kleidungsstücke auf einen Wagen und fuhren diese an einen unbekannten Ort. Danach besoffen sie sich jede Nacht, man hörte ihre Stimmen überall im Dorf. Sogar die Gojim – die Nichtjuden – hatten Angst vor Kosiok und seinen Leuten. Jeden Tag kam Kosiok und fragte nach meinem Mann. Ich erzählte ihm, dass er in Wilna arbeitet. Er ging überall durchs Haus, schaute sich um und nahm sich, was ihm gefiel. Er erzählte mir, dass er vorhätte zu heiraten, und zwar das schönste Mädchen im Dorf. Er wünschte, dass ich das Brautkleid für sie herrichtete und auch Schuhe und Ohrringe herbeischaffte. Wenn das nicht geschehe, wollte er meinen Mann und Herrn Panis ausfindig machen und meinte, ich könnte mir dann denken, was mit ihnen passieren würde. Schlecht und bitter war mir zumute, mein Herz hämmerte – was konnte ich nur tun? Wo fand ich ein Kleid für die Braut? Mit Mühe und Not konnte ich ein Kleid auftreiben, allerdings nicht in Weiß, auch Schuhe und Ohrringe fanden sich.
Es war Schabbes; ich saß und wartete wie gelähmt. Dann trug ich den Männern das Essen in den Keller. Ich riet ihnen, sich ein anderes Versteck zu suchen, ich hatte das Gefühl, dass Kosiok über ihr Versteck Bescheid wusste. Ich wartete, und es gingen Stunden über Stunden vorrüber und Kosiok kam nicht. Auf einmal kam unsere Vermieterin gelaufen und schrie auf polnisch: »Kara Boska! (Gottes Strafe) Die schöne Braut ist heute nacht im Bach ertrunken! Sie ist mit ihren Freundinnen zum Ufer gegangen und da ist es passiert.«
Es schien fast wie ein Wunder, da der Bach gar nicht so tief war. Wir fanden, dass dies ein gutes Omen war, und hofften, dass Kosiok uns unter diesen Umständen ein paar Tage in Ruhe lassen würde. Wie eine Königin wurde die Braut bestattet.
Ich hatte mich inzwischen an das Unglaubliche unserer Lage gewöhnt und versuchte, mich in ihr zurechtzufinden. Ich beschloss, mich nach Wilna zu wagen und mich nach meiner Familie dort umzusehen. Am nächsten Morgen stand ich ganz früh auf. Um mich so unkenntlich wie möglich zu machen, band ich mein Haar mit einem Kopftuch zusammen und machte mich auf den Weg. Von Ponar nach Wilna sind es etwa zehn Kilometer. Die Straßen waren voller deutscher Soldaten. Ein deutscher Motorradfahrer fuhr so dicht an mir vorbei, dass er mich fast überfuhr. Ich bekam einen furchtbaren Schrecken und mir entfuhr eine Verwünschung: »Ein schneller Tod soll ihn ereilen!«
In diesem Augenblick stürzte der Motorradfahrer und war auf der Stelle tot. Ich ging schneller und schaute mich nicht um – ich hatte Angst, dass man mich einholen und beschuldigen würde, an seinem Unfall schuld zu sein.
Der Weg war lang und anstrengend. Als ich morgens in der Stadt ankam, ging ich sofort zur Wohnung meiner Eltern. Sie wohnten damals in der Ignatova-Straße. In der Wohnung fand ich nur meine Mutter und Frau Bak, die Mutter des Ehemannes meiner Schwester. Beide Frauen sahen um zwanzig Jahre gealtert aus. Meine erste Frage war: »Wo sind die Männer?« Sie antworteten, dass die Männer nicht weit von Ponar arbeiteten. Da konnte ich nicht mehr, ich fing an zu weinen. Und ich erzählte, was in Ponar vor sich ging. Wenn die Männer wirklich noch einmal von Ponar zurückkämen, so sollten sie sich schnell verstecken. Als sie das gehört hatten, fingen sie bitterlich an zu weinen. Damals wusste ich noch nicht, dass beide Männer zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben waren.
Meine Mutter umarmte mich und sagte: »Beruhige Dich, mein Kind, es wird alles gut!« Sie wollte nicht zulassen, dass ich zu meiner Schwester ging. Sie wies mich an, nach Hause zu gehen und mich um meinen Mann und mein Kind zu kümmern. Und so bin ich nach Ponar zurückgekehrt.
Täglich hörte man Schüsse auf den Straßen. Juden wurden erbarmungslos zusammengeschossen. Täglich ergingen neue Befehle, die Juden zu verfolgen. Ein deutscher Polizist kam in unsere Wohnung und sah zufällig unser Radiogerät auf dem Tisch stehen. Wütend schrie er uns an. Ich nahm sofort das Gerät und legte es in den Puppenwagen meiner Tochter. Ich sagte: »Das Ding ist schon lange kaputt, das Kind spielt nur damit.«
Jeder Tag, der vorbeiging, brachte uns Angst und Schrecken. Mein Rücken schmerzte vom täglichen Beugen über die Kartoffelkiste und beim Neuordnen der Kartoffeln darum herum.
Nani, unsere Kinderfrau, nahm aus unserem Proviant täglich mit, was ihr gefiel, als ob es schon ihr gehörte. Wie kann sich ein Mensch so ändern? Immer war sie die Liebe in Person gewesen – und jetzt? Eines Morgens sagte unsere Vermieterin, dass die Deutschen auch die Angestellten von Juden verfolgten, sie müsste sich auf das Schlimmste gefasst machen. Am gleichen Tag noch war Nani ohne Wiederkehr verschwunden.
Die Tage wurden immer schrecklicher. Man erzählte, dass alle Juden ins Ghetto getrieben werden sollten. Wir hofften, dass das Schießen nun einmal aufhören würde, aber es wurde mehr und mehr. Unsere Rollläden waren schon lange fest geschlossen, aber die Schreie von Frauen und Kindern wurden stärker und stärker, sie drangen uns durch Mark und Bein. Es kam uns vor, als ob es in Wilna gar keine Juden mehr geben könnte. Die Leute erzählten, dass man Jung und Alt zum Tode führte, dass die Kinder bei lebendigem Leibe mit den Alten begraben würden, dass auch Nichtjuden und sogar Geistliche brutal ermordet würden.
Es war bitter und finster in unseren Herzen. Unsere Tränen waren schon ausgetrocknet, wir schauten uns gegenseitig an und konnten es nicht fassen. Lebten wir denn in einem Schlachthaus? Und trotz allem, was uns Tag für Tag begegnete, verließ uns die Hoffnung nicht. Eines Tages – bald – würde das alles vorbei sein und wie ein böser Traum enden.