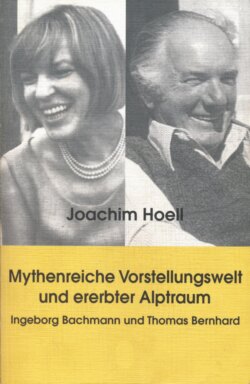Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Simultan und Bachmanns Comédie humaine
ОглавлениеDas Werk, das ich unternommen habe, wird so lang wie eine Weltgeschichte, und ich war seinen noch verborgenen Sinn, seine Prinzipien und seine Moral schuldig.126
Honoré de Balzac
Bachmann knüpft mit dem Projekt einer Comédie humaine nicht nur an Balzac, sondern auch an Roths Comédie humaine der Zwischenkriegszeit an; die literarische Erfassung Frankreichs zwischen Erster und Zweiter Republik überträgt Roth auf die Erste Republik Österreichs und Bachmann wiederum auf die österreichische Nachkriegszeit als ihre Gegenwart, die Zweite Republik Österreichs.
Ingeborg Bachmann gibt in einem Interview aus dem Jahre 1969 Auskunft über das geplante literarische Großprojekt. Honoré de Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie, der »ein großes Gemälde der Gegenwart« entwerfen möchte, das »dem innersten Wesen ihres Jahrhunderts abgelauscht«127 sei, klingt deutlich an: »[…] daß es ein Buch für mich geben wird, das man später natürlich einen Roman nennen wird. Für mich ist es kein Roman, es ist ein einziges langes Buch. Es wird mehrere Bände geben, und zuerst einmal zwei, die wahrscheinlich gleichzeitig erscheinen werden. Es heißt ›Todesarten‹ und ist für mich eine einzige große Studie aller möglichen Todesarten, ein Kompendium, ein Manuale, wie man hier sagen würde, und zugleich stelle ich mir vor, daß es das Bild der letzten zwanzig Jahre geben könnte, immer mit dem Schauplatz Wien und Österreich.« (Bachmann, GuI 65f.)
Ob jedoch die Simultan-Erzählungen in das Balzacsche Modell von Bachmanns »bürgerliche[m] Totentanz«128 hineingehören, ist bei Erscheinen der Todesarten kontrovers diskutiert wurden. Die Simultan-Erzählungen müßten »mit ihrem entschlossenen Leichtigkeits-Parlando ja eher ›Lebensarten‹, zur Not auch ›Überlebensarten‹ betitelt werden«129 und gehörten daher nicht zu den Todesarten, und es werden »der kaum übersehbare Wechsel der Tonart«130 gegenüber Malina und den Todesarten-Fragmenten betont oder die nicht abgegoltenen finanziellen Verpflichtungen Bachmanns gegenüber dem Piper-Verlag angeführt.131 Die Verflechtungen mit dem Gesamtprojekt sind jedoch zu deutlich, als daß Simultan herausgelöst betrachtet werden kann. Die Herausgeber des »Todesarten«-Projektes begründen die Aufnahme von Simultan folgendermaßen: »Die vermeintlichen ›Abfälle‹ der ›Todesarten‹ (Bachmann, TP 4, 17) stellen also sowohl durch die motivische Verflechtung mit den ›Todesarten‹-Romanen und die Einbindung der Figuren in deren Figurennetz als auch poetologisch einen Teil des übergreifenden ›Todesarten‹-Projekts dar, indem sie dessen Dimension einer kritischen Geschichtsschreibung des Alltags in den Mittelpunkt rücken.« (Bachmann, TP 4, 548f.)
In ihren poetologischen Entwürfen für den Simultan-Zyklus erklärt Bachmann, daß »auch in dieser Zeit wie in früheren Zeiten die Frauen dieser Zeit, oder was die Franzosen les moeurs nennen, beschrieben« (Bachmann, TP 4, 7f.) werde, um mehr zu »hinterlassen als Porträts von diesen Frauen, sondern eben die Sitten einer Zeit.« (Bachmann, TP 4, 11) Damit verweist sie deutlich auf Balzacs Begriff ›les moeurs‹, der »Geschichte der Sitten«132, die dieser in seiner Vorrede zum Programm seines Zyklus’ macht. Bachmann fordert in denselben Notizen zu Simultan, »die wahren Geschichten zu erkennen, die sich hinter den gespielten abspielen« (Bachmann, TP 4, 9), und verweist somit wiederum auf Balzacs Vorrede: »Wenn man den Sinn dieser Dichtung recht erfaßt, so wird man erkennen, daß ich den ständigen, täglichen, geheimen oder offen zutage liegenden Tatsachen, den Handlungen des individuellen Lebens, ihren Ursachen und ihren Prinzipien die gleiche Bedeutung beilege, die bisher die Historiker den Ereignissen des öffentlichen Lebens der Nationen beigetragen haben.«133 Bachmann führt ihren Erzählzyklus auf diese Weise theoretisch mit Balzacs Modell der Comédie humaine wie auch mit dem »Todesarten«-Projekt zusammen.134
Den Zusammenhang von Simultan mit den Todesarten auf der Figurenebene erläutert Bachmann ebenso. Die Erzählungen »hatten immer mit Personen zu tun, die am Rande von meinem Hauptbuch lebten, aber dort keinen Platz fanden, Wien aber mitbevölkerten in meinen Gedanken« (Bachmann, TP 4, 12). In Anlehnung an Schnitzler formuliert Bachmann in Malina den »Reigen« ihrer Figuren: »Aus dieser Seuche hervorgegangen muß man sich die Verhältnisse denken, die heute herrschen, warum Ödon Patacki etwa zuerst mit Franziska Ranner zu sehen war, dann Franziska Ranner aber mit Leo Jordan, warum Leo Jordan, der vorher mit Elvira verheiratet war, die dann dem jungen Marek geholfen hat, noch zweimal heiratete, warum der junge Marek dann Fanny Goldmann ruinierte, und sie wiederum vorher mit Harry sich zu gut vertrug und dann mit Milan wegging, aber der junge Marek dann mit dieser Karin Krause, der kleinen Deutschen, danach aber dieser Marek auch mit der Elisabeth Mihailovics, die dann an den Berthold Rapatz geraten ist, der wiederum ... Ich weiß das jetzt alles, auch warum Martin Ranner diese groteske Affäre mit der Elfi Nemec hatte, die später auch an den Leo Jordan geraten ist, und warum also jeder mit jedem zusammenhängt auf die absonderlichste Weise, wenn man es auch nur in den wenigstens Fällen weiß.« (Bachmann 3, 275) Andreas Hapkemeyer spricht im Kontext der Funktion der Personennamen von den späten Texten als dem »Todesarten-Simultan-Komplex […]. Der ›Reigen‹ läßt sich mit gewissen Einschränkungen als das Namensgerüst der späten Texte der Bachmann ansehen«135. In einem Interview konkretisiert die Autorin dieses Balzacsche Vorhaben: »Aber im ganzen wird es eine Geschichte der Gesellschaft sein vom Kärntner Bauern, von der Provinz bis zu den Intellektuellen. Die Bände werden nicht zusammenhängend sein, sondern jeder ganz und gar ein Buch für sich, das jeweils ein eigenes Thema hat. Die Milieus sind ganz verschieden, aber überschneiden sich, so daß die Personen einander doch alle berühren – jeder läuft dem anderen über den Weg.« (Bachmann, GuI 127)
Die Simultan-Erzählungen sind auf diese Weise miteinander wie auch mit den Todesarten verbunden. Wie in Roths Comédie humaine der Zwischenkriegszeit genügt die Nennung eines Namens, um die gesamte Geschichte der Figur hervorzurufen. Die Begegnung des Bezirkshauptmannes mit Mizzi Schinagel wird im Radetzkymarsch lediglich en passant erwähnt, in der Geschichte von der 1002. Nacht erfährt man das weitere Schicksal dieser Gestalt, deren sozialer Abstieg bis zur Prostitution führt.
Für Bachmanns Todesarten-Simultan-Komplex gibt es für dieses Verfahren – eine Person nur am Rande einer Geschichte agieren zu lassen, um sie dann in einem Text ins Zentrum zu rücken – viele Beispiele. Elisabeth Mihailovics wird in Probleme Probleme als »allwissende Cousine« (Bachmann, 2, 349) von Beatrix erwähnt, Elisabeth Matrei in Drei Wege zum See trifft diese andere Elisabeth in Klagenfurt (Bachmann 2, 423) und erfährt deren Ermordung anschließend aus der Zeitung (Bachmann 2, 468ff.); in Malina wird auf ihr Ende angespielt, »daß sie dann an den Berthold Rapatz geraten ist, der wiederum ...« (Bachmann 3, 275); erst in der letzten Endes nicht in den Simultan-Zyklus aufgenommenen Erzählung Gier wird das Schicksal dieser Gestalt ins Zentrum gerückt, indem ihre Todesart gezeigt wird (vgl. Bachmann, TP 4, 473ff.).
Die Jordans werden in der Titelerzählung erstmalig erwähnt (Bachmann 2, 285), in Probleme Probleme bezeichnet Beatrix Leo Jordan als den »großartigen Psychiater« (Bachmann 2, 334), in Das Gebell bleibt er als Sohn und Ehemann zwar unsichtbar und ist dennoch der Mittelpunkt in den Gesprächen der beiden Frauen, in Drei Wege zum See heißt es von Elisabeth Matrei, daß sie einstmals zwischen Leo Jordan und Harry Goldmann als Liebhaber schwankte (Bachmann 2, 414), und erst im Fall Franza wird anhand von Franziskas Todesart eine genauere Charakterisierung seiner Person gegeben.
Dieser Wechsel von Neben- zu Hauptfigur schafft eine andere Qualität, denn es »handelt sich bei ihnen nun nicht mehr um bloße Namen, sondern um Zeichen, die als Konnotation die Erinnerung an Mord und Tod mitführen«136. Aus den Namen sind Figuren, aus den Lebensarten sind Todesarten geworden.
Damit die Dimension dieses Namensnetzes und seiner motivischen, örtlichen und figürlichen Zitationen und Verweise vollständig erschlossen werden kann, muß das Bachmannsche Werk – sowie auch Joseph Roths Gesamtwerk – als einziger Text gelesen werden. Erst diese simultane Lektüre vermag über die Intentionen dieses Werkes Aufschluß zu geben, so daß Bachmanns Simultan-Komplex nicht als Seitenstück, sondern als notwendige Ergänzung zu den Todesarten verstanden werden muß.137 Die Notiz der Autorin, »das simultane Denken und Fühlen der Personen, die zusammenhängen, ist das Thema« (Bachmann, TP 4, 7), erweist sich in dieser Hinsicht als das geheime Programm nicht nur für Simultan, sondern für ihr gesamtes Spätwerk – den Todesarten-Simultan-Komplex. »Die Gleichzeitigkeit der miteinander vernetzten »Simultan«-Geschichten läßt sich verstehen als das »Todesarten«-Projekt in nuce«138. Die Besonderheit von Bachmanns Rezeption der Rothschen Romane beruht demnach nicht nur auf der direkten Fortschreibung der Kapuzinergruft und des Vorgängertextes Radetzkymarsch in Drei Wege zum See, sondern auf der Verbindung ihres eigenen Figurenkosmos’ aus dem Todesarten-Simultan-Komplex mit dem Rothschen Gesamtwerk. Daher »erhält ihr Erzählvorhaben neben der vertikalen Dimension – der Skizzierung eines Gesellschaftspanoramas der Nachkriegszeit in Österreich – eine weitere horizontale Dimension – die Einbettung dieses Panoramas in die Geschichte Österreichs«.139
Ingeborg Bachmanns Spätwerk ist nicht nur durch wiederkehrende Figuren verknüpft, sondern auch durch den geschlossenen zeitlichen wie topographischen Rahmen der letzten zwanzig Jahre mit dem Schauplatz Wien und Österreich. Daher werden im folgenden die zeitliche, topographische und personelle Dimension dieser Texte als Fortschreibung von Roths Erzählwerk untersucht.
Reinhard Baumgart hält zwar die Zugehörigkeit zu den Todesarten für strittig, fragt sich aber, ob sich nicht »der Beginn einer neuen, dritten Phase des Bachmannschen Erzählens erkennen läßt, herausführend aus dem Todesarten-Projekt, eine Heimkehr auch in die Tradition der doppelbödigen österreichischen ›Leichtigkeit‹, der Schnitzler, Roth und (ja auch) Musil?«140 In welcher Weise Ingeborg Bachmann an Roths Darstellung der Donaumonarchie anschließt und wie sie die der ›Trotta–Romane‹ in die Handlungszeit der Simultan-Erzählungen überträgt und die Habsburger Tradition kritisch weiterentwickelt, ist das Thema dieses Kapitels. Ob sie dabei eine neue, dritte Phase ihres Erzählens beschreitet, soll die Untersuchung des Verhältnisses ihres dafür wichtigsten Ahnen belegen: Joseph Roth.