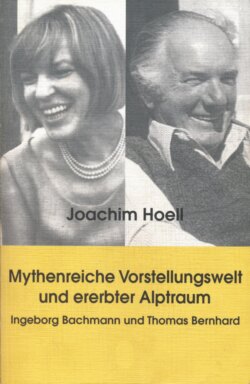Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom Linksradikalen zum Monarchisten
ОглавлениеIch kann wahrhaftig nicht mehr die Rücksichten auf ein bürgerliches Publikum teilen und dessen Sonntagsplauderer bleiben, weil ich nicht täglich meinen Sozialismus verleugnen will. (Roth, Br 40, 1922)
Ich will die Monarchie wieder haben und will es sagen. (Roth, Br 262, 1933)
Zwischen diesen beiden ›politischen‹ Selbsteinschätzungen Roths liegen nur elf Jahre. In seinen letzten Lebensmonaten – nach dem ›Anschluß‹ 1938 – wurde Roth geradezu ein fanatischer Monarchist. Je mehr sich der Nazismus ausbreitet, desto stärker tritt Roths sehnsuchtsvolle Rückwendung zur glücklichen habsburgischen Zeit hervor.162 Klaus Mann beschreibt in seinem Lebensbericht Der Wendepunkt, welche »bizarren politischen Theorien« Roth in seinem Pariser Exil »den Herren von der Presse« unterbreitete: »Die Rettung Europas – Joseph Roth zufolge – konnte nur vom Hause Habsburg kommen, eine andere Hoffnung gab es nicht. Säße erst wieder die gesalbte Majestät in der Wiener Hofburg, so würde alles noch gut: das Regiment des ›Antichrist‹ wäre vorüber.«163 Roth wurde Mitbegründer und Vizepräsident der ›Liga für das geistige Österreich‹164 und wurde nicht müde, Otto von Habsburg als neuen Kaiser zu proklamieren.165 Wie konnte es zu solchen bizarren Äußerungen des ehemals kritischen Feuilletonisten und Literaten Roth kommen?
Spätestens nach der ›Machtergreifung‹ durch die Nazis – Roth reiste am nächsten Tag aus Berlin ab und kehrte nie wieder nach Deutschland zurück – und der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 sah Roth seine Befürchtungen bezüglich der deutschen Verhältnisse bestätigt. Sein Romandebüt Das Spinnennetz (1923) war bereits eine scharfsichtige und prophetische Analyse der »hakenkreuzlerischen« Bewegung gewesen, die vor dem Hitler-Ludendorff-Putsch in München erschien. Der Mord an Walter Rathenau im Juni 1922 durch Rechtsradikale hatte Roth diese Bedrohung gezeigt und ihn im Gegensatz zu den meisten Zeitgenossen für die Gefahr von Rechts sensibilisiert.166 Roth hat als einer der bestbezahlten Feuilletonisten der Weimarer Republik eine Vielzahl an Artikeln verfaßt, die einen äußerst aufmerksamen Beobachter der Zeit zeigen. Nach seinem dreijährigen Aufenthalt in Berlin begann er seine Flucht ohne Ende. Er verbrachte einige Zeit in Rußland, um für verschiedene Zeitungen über die Erfolge der Oktoberrevolution zu berichten. Sein Rußlandbuch wie der Roman Der stumme Prophet (1927, 1966) vermitteln einen Eindruck von Roths Ernüchterung über die russische Revolution.167
In dem 1933 in Frankreich erschienenen Artikel Das Autodafé des Geistes blickt er im Zorn auf das Deutschland der brennenden Bücher zurück. In seiner Analyse der deutschen Zustände bemerkt er eine grundsätzlich geistfeindliche Atmosphäre seit Bismarcks Zeiten. »Die deutschen Literaten, jüdischer oder nichtjüdischer Herkunft, waren zu allen Zeiten nur Fremde in Deutschland, Emigranten auf heimatlichem Boden, verzehrt von Heimweh nach dem wahren Vaterland« (Roth 3, 495). Denn der ›Korporal‹ preußischer Prägung habe die Vorherrschaft der physischen, materialistischen und militärischen Kräfte über das geistige Leben angeordnet. Der immerhin zweifach gewählte Reichspräsident Hindenburg sei die Verkörperung dieses gottlosen, ungeistigen Typus’, der immer mehr das deutsche Leben dominiere. »Von individuellen Ausnahmen abgesehen, gab es keine einzige Schicht, die aktives Interesse an Kunst und Geist bekundet hätte« (Roth 3, 497). Roth setzt sein eigenes geistiges Erbe des Habsburgerreiches mit seiner barock-katholischen Tradition gegen die protestantisch-materialistische Modernität Preußens. »Dieses Dritte Reich ist der Beginn des Untergangs! Indem man die Juden vernichtet, verfolgt man Christus. Zum erstenmal werden die Juden nicht deshalb totgeschlagen, weil sie Jesus gekreuzigt haben, sondern weil sie ihn hervorgebracht haben. Wenn man die Bücher der jüdischen oder als solche verdächtigen Autoren verbrennt, legt man in Wirklichkeit Feuer an das Buch der Bücher: an die Bibel« (Roth 3, 500).168
Den Nationalsozialismus erklärte er für die logische Konsequenz aus dem »immanenten Haß des Deutschen gegen das Beharrende, Bleibende, gegen das Traditionelle. […] Traditionalität, Humanität und Universalität: dieser immer wieder postulierte Wertekomplex wird nach Roths Schema durch das Borussische negiert, durch das Österreichische aber positiv verkörpert. […] Das Habsburger Reich wurde zu einem mustergültigen politischen Modell erklärt, das in der Vergangenheit bereits verwirklicht worden sei und nun wieder aufgerichtet werden müsse, um der im Nationalsozialismus kulminierenden preußisch-protestantischen Dynamik Widerpart zu bieten.«169 Roth hat den Untergang des Habsburgerreiches und den aufkommenden Nationalsozialismus in ein treffendes Bild gebracht: »Man hat den Doppeladler verjagt: und die Aasgeier sind gekommen« (Roth 4, 971).
Die Verherrlichung der Donaumonarchie im Erzählwerk Roths ist jedoch gebrochen. Trotz der Vielzahl legitimistischer Artikel – insbesondere nach dem ›Anschluß‹ –, werden gerade in seinen zwei großen Österreich-Romanen Radetzkymarsch und Die Kapuzinergruft diese Tendenzen in Frage gestellt. Im folgenden Abschnitt zu Bachmanns Fortschreibung der ›Trotta-Romane‹ wird diese Aufhebung eindeutiger politischer Aussagen – eine vor allem durch die Technik ständiger Perspektivenwechsel erzielte Ambivalenz des Erzählers – deutlich werden.
In der Untersuchung zum Österreichbild Roths wird klar, daß der ihm unterstellte Wandel vom Sozialisten zum Monarchisten nicht treffend ist, denn, so Reiber, bereits »an den früheren journalistischen Arbeiten [lasse sich] erkennen, daß Roths Denken schon zu einer Zeit, da er mit dem Anspruch eines politisch engagierten, gegenwartsnahen Schriftstellers auftrat, Fluchtpunkte aufweist […] als Orte, zu denen aus der Gegenwart Zuflucht genommen werden kann«170. Hermann Kestens Roth-Urteil, ›Vom Linksradikalen zum Konservativen‹, erweise sich als fragwürdig171: »Solche Typisierungen verfälschen, weil sie Roth eine 180-Grad-Wendung unterstellen, die er so nicht vollzogen hat. […] Nicht eine radikale Wende, sondern ein über verschiedene Stufen fortschreitender Prozeß läßt Roth schließlich zum Propagandisten des habsburgischen Kaisertums werden. In ihm entfalten sich Gedanken und Vorstellungen, die in nuce bereits beim jungen Roth zu finden sind.«172 Magris bewertet beide Phasen Roths als stilisierte, persönliche Fluchten: »So ist sein anarchiefreundlicher Sozialismus nur der vorübergehende Ausdruck seines Pessimismus und des Mangels an Anhaltspunkten und sein Legitimismus die Folge einer lyrischen, phantastischen Rückkehr zur Vorkriegswelt«.173 Damit wird er Roths Durchdringung seiner Zeit jedoch nicht gerecht, da Roths ›Habsburgischer Mythos‹ keine unreflektierte Verherrlichung vergangener Zeiten, sondern einen differenzierten und analytischen Blick auf die geschichtlichen Gewordenheiten seiner Zeit bietet.