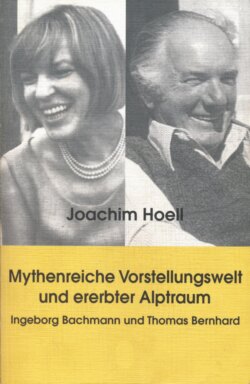Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Joseph Roths ›Habsburgischer Mythos‹
ОглавлениеWahrlich, existierte der österreichische Kaiserstaat nicht schon längst, man müßte im Interesse Europas, im Interesse der Humanität selbst sich beeilen, ihn zu schaffen.174
František Palacký, 1848
Claudio Magris beschreibt Roths habsburgischen Mythos als jüdisch-slawischen: »[…] nie aber hatte sich der habsburgische Austro-Slawismus so vollendet in Dichtung umgewandelt, wie in seinem Werk. Dieser scheint hier seinem politischen Begriffsinhalt nach auf – zähes Überleben der Feudalwelt mit ihren Werten der Würde und Treue, föderalistische Bestrebungen im Gegensatz zum Staatszentralismus, die der illusorischen (oder schlauen, je nachdem) Sorge um die Autonomie entsprechen; die Leibeigenschaft und das Problem der jüdischen Gemeinschaften –, vor allem aber in seinem fein schattierten Erscheinungsbild der Sitten und Gebräuche. […] Joseph Roths habsburgischer Mythos ist jüdisch-slawisch«.175 Daß dieser habsburgische Mythos dennoch kritisch ist, betont Magris: »So ist auch der Radetzkymarsch keine leere Verherrlichung einer verlorenen Zeit, mag er auch scheinbar einer heimwehkranken Zugehörigkeit zum habsburgischen System entspringen und mag der Dichter auch zur gleichen Zeit legitimistische Artikel schreiben, sondern ganz einfach ein Roman, der jene Welt begriffen hat.«176 Letztendlich seien Roths Romane »ein negativer, indirekter Weg, um des Dichters Bindung an die habsburgische Welt zu bezeugen.«177 Georg Lukács, gewiß kein Streiter für die Monarchie, hat in seiner Rezension des Radetzkymarsch darauf aufmerksam gemacht, daß die persönliche Anteilnahme Roths an dem Schicksal Österreich-Ungarns überhaupt erst dessen Durchdringung ermögliche. »Hätte Roth nicht seine Illusionen, so hätte es ihm kaum gelingen können, so tief in die Welt seiner Beamten und Offiziere hineinzublicken und so voll und ganz und wahrhaftig den Prozeß ihres sittlichen und sozialen Verfalls darzustellen.«178
In der 1928 erschienenen Skizze Seine k. und k. apostolische Majestät verleiht Roth seiner ambivalenten Haltung zum Kaiser – »das war Österreich-Ungarn« – Ausdruck: »[D]ie zwiespältige Trauer über den Untergang eines Vaterlandes, das selbst zur Opposition seine Söhne erzogen hatte. Und während ich es noch verurteilte, begann ich schon, es zu beklagen. […] Die Sinnlosigkeit seiner [des Kaisers, J.H.] letzten Jahre erkannte ich klar, aber nicht zu leugnen war, daß eben diese Sinnlosigkeit ein Stück meiner Kindheit bedeutete. Die kalte Sonne der Habsburger erlosch, aber es war eine Sonne gewesen« (Roth 2, 910).179
Roths wunschhaftes Streben einer Rekonstitution der Monarchie erhellt seine Ablehnung nationalistischer Abspaltungen, die nicht nur die Einheit des Habsburgerreiches zerstörten, sondern zu Scharmützeln zwischen den ehemals unter Franz Joseph vereinten Völkern führten. Roth verficht eine rückwärtsgerichtete Utopie, denn die Monarchie barg für ihn den Gedanken einer ›Heimat‹ für alle Völker. Der alte Herr von Maerker in dem ›Revolutionsernüchterungsroman‹ Der stumme Prophet formuliert diese universale, utopische Idee des untergegangenen Habsburgerreiches: »Glauben Sie mir, daß Witze allein genügen, einen alten Staat zugrunde zu richten. Alle Völker haben gespottet. Und doch war zu meinen Zeiten, als der Mensch noch wichtiger war als seine Nationalität, die Möglichkeit vorhanden, aus der Monarchie eine ›Heimat‹ zu machen. Sie hätte das kleinere Vorbild einer großen zukünftigen Welt sein können und zugleich die letzte Erinnerung an eine große Epoche Europas, in der Norden und Süden verbunden gewesen wären« (Roth 4, 922).
Aus Roths Wahrnehmung der 20er und 30er Jahre mit ihren nationalistischen Kämpfen, ihrer politischen Radikalisierung, ihren rassistischen Ausgrenzungen und den nationalsozialistischen Verbrechen erscheint seine Verherrlichung der Donaumonarchie verständlich. Kurt Schuschnigg, der ›Anschlußkanzler‹, hat im Rückblick dem Österreich vor 1918 reale Überlebenschancen zugesprochen: »Es ist nicht immer nachgehinkt, wie es die Legende will, sondern war in etlichem der Zeit voraus als ein echter Faktor regionaler Integration, der allem Auf und Ab zum Trotz bis 1918 funktionierte und dessen Existenz für die Mehrheit seiner Bewohner bis zur Niederlage im Krieg außer Frage stand.«180 Roths Biograph Helmuth Nürnberger weist auf dessen ideale Vorstellung hin: »Ihm ging es um Österreich als übernationale Idee. Sein Begriff des Staates schloß Grenzen eigentlich aus.«181
Die Wahrhaftigkeit dieser Argumentation hat die repressive Politik mittlerweile aufgelöster Staatsgebilde wie die der Sowjetunion und des ehemaligen Jugoslawiens gezeigt, die die künstlich zusammengehaltenen Völker als gescheiterte Nationalstaaten deutlich werden ließen. Dieser historische Auflösungsprozeß der 1980er und 1990er Jahre erinnert an den des bürgerlichen Europas nach dem Ersten Weltkrieg. Fortschrittliche Gegentendenzen in heutiger Zeit versuchen erstarrte Begriffe wie Nation, Volk und Rasse aufzubrechen, um größere, brückenschlagende Formeln des Zusammenlebens zu finden. »Gegen den Strich gelesen läßt sich die Monarchie auch als überaus aktuell verstehen, sozusagen als Metakritik der Moderne, als möglicher Ort von Vielfalt und Multinationalität, der friedliches Nebeneinander, regionale Verschiedenheit, Noblesse und Einsicht in große historische Zusammenhänge gestattet, als eine Gegenwelt zu Nationalismus und neusachlichem Funktionalismus […].«182 Wolfgang Müller-Funk bezeichnet Roths Universalismus in gewisser Weise als post-modern, »indem er die Ideologien der Moderne, voran den Nationalismus verwarf«183. Joseph Roth hat – läßt man die negativen Aspekte der konservativ-reaktionären, bürokratisierten und militarisierten Monarchie Franz Josephs außer Acht – für ein utopisches Modell plädiert, das heute noch seiner Umsetzung und Erfüllung harrt.