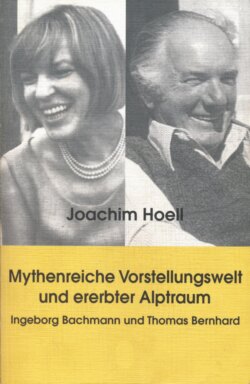Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Soziologische Sicht
ОглавлениеDie einzigen Menschen, auf die sich die Habsburger verlassen konnten, waren die Juden.184
Joseph Roth
Das Verständnis von Roths Gefühlskomplexen in bezug auf seine Vorstellung von Österreich zeigt eine soziologische Analyse, in der seine Hinwendung zu Ideologien wie Nationalismus und Habsburgischer Mythos verständlich werden; daß diese Bindung an die ›Heimat‹ in seinem erzählerischen Werk dennoch gebrochen ist, wird anhand der offenen Erzählperspektive deutlich.
Helmut Kuzmics zeigt, wie sich Reichspatriotismus, ›Habsburgischer Mythos‹ und Nationalismus in den Romanen von Joseph Roth soziologisch interpretieren lassen. Generell werden aus soziologischer Sicht Gefühlskomplexe in bezug auf die Phänomene Nationalismus und Nationalstaat kaum beachtet bzw. einseitig dargestellt: »Oft dominiert eine rationalistische Sichtweise, der zufolge Gefühle der nationalen Loyalität, der Bindung an einen Staat oder des Nationalstolzes als etwas Ungehöriges oder Regressives dargestellt werden. Noch ärger ist es den älteren Gefühlskomplexen ergangen, die aus der Bindung an die patriarchalische Ordnung einer Monarchie zu entstehen pflegten: Gerade von kritischen Sozialwissenschaftlern wurden sie als regressiver Autoritarismus gebrandmarkt und von der Warte demokratisch-republikanischer Ideale aus regelrecht verteufelt.«185 Norbert Elias habe in den Studien über die Deutschen186 gezeigt, »daß – im Falle Deutschlands in der Zeit der Weimarer Republik – die alten Gefühlsbindungen an Kaiser und patriarchalische Ordnung es schwer gemacht hätten, sich mit der neuartigen parlamentarischen Demokratie anzufreunden.«187 Das Bedürfnis nach einem ›Ersatzkaiser‹ sei somit aus der Gefühlsstruktur vieler Deutscher abzuleiten. In Österreich war das entstandene Vakuum an »Sicherheit, Orientierung, Stolz«188 nach dem Untergang der Monarchie eher noch größer, vor allem durch das sichtbare Zusammenschrumpfen einer Großmacht auf einen Kleinstaat. Roth lege in seiner Comedie humaine der Zwischenkriegszeit die Gefühlsstruktur verschiedenster sozialer Schichten offen, vor allem des Militärs und der Bürokratie. Kuzmics unterscheidet zwei Gefühlsebenen, die sich aus Roths Werk und Leben ablesen lassen: Die »Wir-Gefühle« und die »Gefühle der Trauer, Wehmut, Sehnsucht nach dem Verlorenen«189.
Die »Wir-Gefühle« bezeichnen die Loyalität zu kleineren menschlichen Gruppen und Einheiten und reichen bis zur Bezugsebene der staatlichen Gesellschaft. Elias geht davon aus, »daß diese zwiebelschalenförmig aufgebauten Wir-Gefühle sich mit fortschreitender gesellschaftlicher Entwicklung von Überlebenseinheiten wachsend an höhere Einheiten der politischen Organisation binden, wobei die emotionale Bindungsenergie von den entwicklungsgeschichtlich früheren Einheiten von Familie und Dorf teilweise abgezogen wird, aber nie gänzlich zu den späteren (›Staat‹, ›Nationalstaat‹) allein hinwandert.«190 Roths Wir-Gefühle erstrecken sich auf die Herkunftsstadt Brody, Galizien selbst, das Judentum, das Deutschtum, den Gesamtstaat und letztendlich auf die Bezugsebene der Menschheit. Dabei wird deutlich, daß sich konkurrierende Loyalitäten gegenüberstehen, die eine konflikthafte Balance bedeuten.
Die zweite Gefühlsebene betrifft den von Claudio Magris unter dem Begriff des ›Habsburgischen Mythos‹ dargestellten Verlust eines Lebensgefühls, das sich durch Sicherheit, Geborgenheit, gemütliche Ruhe, mäßige Sinnenfreude ausprägte und in dem die verschiedenen Völker in »habsburgischer Humanität«191 zusammenlebten. »In der Kapuzinergruft, die im verarmten, absurd verkleinerten Alpenösterreich zum Symbol des Untergangs alles Lebenswerten wird, zeichnet Roth die bedrückenden Folgen der Abkehr vom universalistischen, weiträumigen, vielfarbigen Österreich in der Beengtheit und Kleinkariertheit des ungewollten Staates.«192
Gerade wegen des in den 80er Jahren aufkommenden Antisemitismus sahen viele Juden in Franz Joseph ihren Schutzherrn193, in Galizien wurde diese Hinwendung zur Monarchie noch verstärkt durch die lebendige Erfahrung der antisemitischen Pogrome im benachbarten zaristischen Rußland. Stefan Zweig verweist in seiner Londoner Trauerrede für den Freund auf die »Ehrfurcht vor dem Kaiser und seiner Armee« als den Mythen von Roths Kindheit, die er aus seiner östlichen ›Heimat‹ nach Wien mitgenommen hatte: »Aber geheimnisvollerweise waren in unserem sonderbaren Österreich die eigentlichen Bekenner und Verteidiger Österreichs niemals in Wien zu finden, in der deutschsprechenden Hauptstadt, sondern immer nur an der äußeren Peripherie des Reiches, wo die Menschen die mild-nachlässige Herrschaft der Habsburger täglich vergleichen konnten mit der strafferen und minder humanen der Nachbarländer.«194 Roths Freund Soma Morgenstern beschreibt den Wandel des Kaiserbildes als Entwicklung von der Peripherie in das Zentrum: »Wir in Galizien, auch die Nichtmonarchisten, haben viel Verehrung für den Kaiser gehabt. Erst in Wien habe ich gelernt, ihn für einen freundlichen alten Depp zu halten!«195
Roths Patriotismus ist in dieser Hinsicht repräsentativ, denn das Wiener Judentum – ob assimilierte, verwestlichte oder ostgalizische Juden – identifizierte sich in besonderer Weise mit der Monarchie.196 Der anschwellende Nationalitätenstreit und der zunehmende Antisemitismus nach dem Krieg zeigten Roth den für ihn bedrohlichen Wandel der neuen Zeit. Die galizischen Juden waren akut bedroht, denn als eine Minorität waren sie größeren und stärkeren Volksgruppen in deren nationalem Hegemonialstreben unterlegen;197 Roths feindselige Haltung gegenüber nationalen Bewegungen mag sich vor allem daraus erklären. »Die Habsburger Monarchie und das Ostjudentum sind auch derselben Bedrohung ausgesetzt: der Bedrohung durch den Nationalismus, dessen partikularisierende Kraft schließlich beide Gebilde zerstört«198. Das Nationalitätenproblem wird wiederholt in Roths Werk thematisiert. Der Bezirkshauptmann in Radetzkymarsch formuliert den Argwohn gegenüber solchen Bestrebungen beispielhaft: »Es war dem Bezirkshauptmann, als bestünde plötzlich die ganze Welt aus Tschechen: einer Nation, die er für widerspenstig, hartköpfig und dumm hielt und überhaupt für die Erfinder des Begriffs: Nation. Es mochte viele Völker geben, aber keineswegs Nationen. […] ›nationale Minoritäten‹ waren für seine Begriffe nichts anderes als größere Gemeinschaften ›revolutionärer Individuen‹« (Roth 5, 356).
Roth spielt in seinem feuilletonistischen wie erzählerischen Werk wiederholt den österreichischen Reichspatriotismus gegen den aufkommenden Nationalismus aus. Er selbst hat sich früh für die deutsche Sprache und Kultur entschieden199, die in Galizien durch die polnische Präsenz verdrängt zu werden drohte. »In der Mehrzahl waren seine Gymnasialprofessoren kaisertreu, deutsch erzogen und darauf bedacht, eine monarchiefreundliche Stimmung auf ihre Schüler zu übertragen.«200 Die Aufnahme seines Studiums in Wien ist die Abkehr von seiner heimatlichen Umgebung, obwohl er auf diese ihn prägende Kindheit immer wieder zurückkommen sollte.201 Roth identifizierte sich mit der deutschsprachigen Majorität in Wien, die im wesentlichen das Beamtentum und das Militär bildete.202 Die zwei Staatsromane Radetzkymarsch und Kapuzinergruft spiegeln genau diese ›deutsche‹ Schicht wider, in der »Nationalgefühl gleichzusetzen [war] mit Verrat«203. Roths habsburgischer Mythos nährt sich aus dem von ihm gewählten Milieu einer Elite, die »in besonderer Weise staatsloyal und in patrimonialer Weise in diesen Staat eingebunden war«204. Für die Repräsentanz seiner Texte als Bild ihrer Zeit bedeutet dies – aus soziologischer Sicht –, »durch dieses Vergrößerungsglas ein Stückchen von jener psychischen Realität [zu erfahren], die auch weniger verletzte und wortmächtige Österreicher geprägt hat«.205
Gleichwohl hat Roth seine ostjüdische Herkunft nie verleugnet, die ihn klar vom etablierten jüdischen Bürgertum in Wien trennte. Im Gespräch mit seinem Freund Soma Morgenstern äußert er über Stefan Zweig: »Die reichen deutschen Juden haben am Anfang immer geglaubt, daß Hitler nur uns meint, uns Ostjuden«206. Hilde Spiel betont diese Rivalitäten zwischen assimilierten, wohlhabenden gegenüber zugewanderten, armen Juden zu Anfang dieses Jahrhunderts. Die liberalen Juden hatten, »erst durch Geschäftstüchtigkeit, dann durch intellektuelle und künstlerische Leistungen, den Respekt der Mitbürger gewonnen und sich im Lebensstil immer mehr an sie angepaßt; nun aber brachten diese Zugereisten eine fremde Lebensform und Überlieferung mit, wie sie Wiens alteingesessene und emanzipierte jüdische Familien längst aufgegeben hatten.«207 In seinen beiden Staatsromanen werden diese (ost-)jüdischen Gegenwelten durch die Vettern aus Galizien und Slowenien plastisch. In der Kapuzinergruft heißt es von den galizischen Juden, daß sie »stolze Menschen« seien: »Meine polnischen Juden allein berührt weder ein Schimpf noch eine Gunst. In ihrer Art sind sie Aristokraten. Denn das Kennzeichen des Aristokraten ist vor allem anderen der Gleichmut; und nirgends habe ich einen größeren Gleichmut gesehen, als bei meinen polnischen Juden« (Roth 6, 30).
In Bachmanns Fortschreibung der ›Trotta‹-Romane in Simultan bietet diese soziologische Interpretation den Hintergrund für die zu diskutierende Grenz-, National- und Sprachproblematik, die keine leere Verherrlichung vergangener Zeiten ist, sondern in den zwanziger und dreißiger Jahren, 1968, zur Zeit der Entstehung von Simultan wie auch heute eine adäquate Beschäftigung mit den historischen und aktuellen Problemen des ehemaligen Groß-Österreichs ist. »Im Grunde gibt es bis heute keine befriedigende Lösung der Wirrnis, die das Scheitern der Habsburgermonarchie in der Nationalitätenfrage mit sich gebracht hat.«208
Wie setzt sich Ingeborg Bachmann im Simultan-Zyklus mit der Habsburger Tradition auseinander und wie knüpft sie an Roths ›Trotta-Romane‹ an?