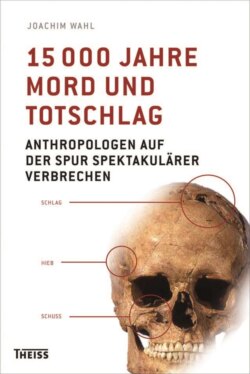Читать книгу 15000 Jahre Mord und Totschlag - Joachim Wahl - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Darf man menschliche Überreste ausstellen?
ОглавлениеDie Kombination altbewährter und moderner Untersuchungsmethoden erlaubt es den Anthropologen, detaillierte Lebensbilder zu entwerfen. Wie ein Totenkopf auf einer Piratenflagge oder einem Giftetikett fast augenblicklich ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich zieht, üben Menschenknochen als anatomische Präparate und solche aus längst vergangenen Epochen stets große Anziehungskraft aus. Mehr noch gilt das für Mumien, die dem lebendigen Zustand am nächsten kommen. So sind auch jene Vitrinen in Museen am dichtesten umlagert, in denen Gräber unserer Vorfahren mit Originalskeletten rekonstruiert wurden oder Einzelknochen mit besonderen Krankheitsbefunden und Fehlbildungen gezeigt werden.
Die Meinungen der Besucher sind jedoch ambivalent: Einige sind begeistert, andere abgeschreckt oder grundsätzlich dagegen, menschliche Überreste auszustellen, wieder andere kommen des Gruselfaktors wegen.
Man erinnere sich an die heftigen Diskussionen um Pietät und Profit, Interesse und Informationsbedürfnis, Ethik und Effekthascherei im Zusammenhang mit der Ausstellung „Körperwelten“ Gunther von Hagens. Es kamen Hunderttausende – zuletzt musste die Schau rund um die Uhr geöffnet bleiben, um die Besucherströme zu bewältigen. Als der Aktionskünstler Wolfgang Flatz im Juli 2001 in Berlin eine enthäutete Kuh aus einem Helikopter werfen wollte, kamen ähnliche Fragen auf. Empörte Tierschützer versuchten per einstweiliger Verfügung, juristisch dagegen vorzugehen. Das Urteil der Richter lautete, niemand sei gezwungen hinzugehen. Als die immerhin 2500 Jahre alten Skelettreste des Keltenfürsten von Hochdorf 1985 im Stuttgarter Kunstgebäude öffentlich präsentiert werden sollten, wurden selbst aus Museumskreisen Zweifel geäußert, ob man dies tun dürfe. Mit der Ausstellung seiner Grabbeigaben hatte man dagegen keine Probleme – ein Dilemma, denn ohne den Fürsten wären die Preziosen nicht in dieser Kombination entdeckt worden. Beides gehört also untrennbar zusammen, und in diesem Sinne ist denn auch in Stuttgart entschieden worden.
Wer religiöse oder moralische Bedenken in Bezug auf menschliche Knochen hegt, müsste auch den im Kontext angetroffenen Beifunden als Eigentum des Verstorbenen entsprechenden Respekt zollen. Bestimmte Glaubensvorstellungen erklären eine Grabstätte für auf ewige Zeiten unantastbar. Demnach müsste man, um die Totenruhe nicht zu stören, grundsätzlich jeden Eingriff in den Boden vermeiden, wenn dabei die Gefahr besteht, ein altes Grab zu zerstören. Wenn wir auf unsere modernen christlichen Friedhöfe schauen, ist die Ruhedauer der Verstorbenen in der Regel auf 15 Jahre beschränkt. Beim Anlegen einer neuen Bestattung werden die älteren Knochen meist verschämt beiseite geschoben. Ob das pietätvoller ist, sei dahingestellt. Doch Fragen der Ethik, die durch solche Funde aufgeworfen werden, sind viel zu komplex, als dass sie an dieser Stelle erschöpfend diskutiert werden könnten. Somit muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er alte Knochen anschauen möchte oder nicht – wer mehr über unsere Altvorderen erfahren will, wird sich jedoch dem enormen Aussagepotenzial dieser Fundgattung kaum entziehen können. Ein Teil der Faszination liegt darin, dass beim Betrachten stets der eigene Körper zum Vergleich präsent ist – und dass man insgeheim froh ist, nicht selbst betroffen zu sein.