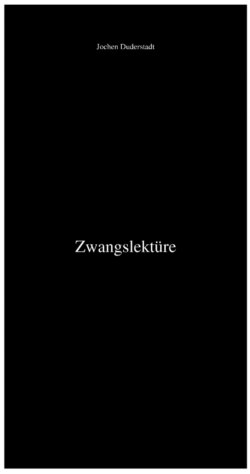Читать книгу Zwangslektüre - Jochen Duderstadt - Страница 10
ОглавлениеGotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise (1779/1783)
Handlung
Thema des Dramas sind Toleranz und aufgeklärter Humanismus als Ausweg aus dem Absolutheitsanspruch der drei Weltreligionen.
Folgerichtig spielt das Stück in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge. Judentum, Christentum und Islam prallen hier aufeinander.
Nathan, ein reicher jüdischer Kaufmann, dessen Frau und sieben Söhne einem christlichen Progrom zum Opfer gefallen sind, hat das Waisenkind Recha als Pflegetochter aufgenommen.
Eines Tages - Recha ist mittlerweile im heiratsfähigen Alter und Nathan gerade auf Geschäftsreise - fackelt jemand sein Haus ab. Recha wird von einem jungen Tempelherrn gerettet, der gerade aus der Gefangenschaft des Sultans Saladin entlassen worden ist. Der hatte ihn entgegen seiner Gewohnheit nicht hinrichten lassen, weil er Ähnlichkeit mit seinem toten Bruder hatte. Während es zwischen Recha und dem Tempelherrn zum ersten interreligiösen Flirt kommt, sucht Saladin das Gespräch mit Nathan. Nathan denkt, der Sultan wolle ihn anpumpen. Dabei geht es Saladin um Höheres, nämlich um die Frage, welche der drei Religionen "Die wahre" sei.
Nathan will nicht ins Fettnäpfchen treten und erzählt die berühmte Ringparabel:
In einer Dynastie wird ein Zauberring stets vom Vater auf den Lieblingssohn weitervererbt, um auf diese Weise schließlich bei einem König zu landen, dem alle drei Söhne gleich lieb sind. In seiner Not fertigt er zwei perfekte Duplikate. Die drei Söhne kriegen sich nach seinem Tode natürlich in die Wolle, weil jeder glaubt, er habe den echten Ring, dessen Zauberkraft darin besteht, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Der Richter verweigert die Entscheidung, gibt aber den Hinweis, dass jeder der drei Söhne Gelegenheit habe, die Echtheit seines Rings durch praktizierte Menschlichkeit zu erweisen.
Saladin begreift. Beide werden Freunde.
Mittlerweile will der Tempelherr die schöne Recha heiraten. Klappt aber nicht, denn nach einigem hin und her stellt sich heraus, dass beide Geschwister sind. Und damit nicht genug: Der Tempelherr ist auch noch der Neffe Saladins. Als einziger, der nicht der Krypto-Großfamilie angehört, wird Nathan sozusagen als Seelenverwandter in den Clan aufgenommen. Und alle umarmen sich unter Tränen der Rührung.
Deutung
Jeder, der nach der Schulzeit die Erinnerungsreste des Deutschunterrichts zusammenzukramen versucht, wird auf die Assoziationskette "Lessing – Ringparabel - Religiöse Toleranz -Aufklärung" stoßen. Manche werden sich auch noch des Umarmungsfestes am Ende des Dramas erinnern, mit dem auch dem Schüler bzw. Theaterbesucher aus der letzten Reihe so sinnfällig klargemacht wird, dass wir, egal woran wir glauben, "irgendwo eine große Familie" sind.
Dabei geraten nicht nur Al Hafi als Aussteiger und der Patriarch von Jerusalem als Fundamentalist in den Hintergrund, sondern auch alle religiösen und philosophischen Traditionen, die nicht für sich in Anspruch nehmen, an der Offenbarung eines einzigen Gottes teilzuhaben.
Hier zeigt sich Lessings verborgene Tragik:
Auf der einen Seite tritt er für eine vorurteilsfreie Menschlichkeit ein und wird durch seinen Königsgedanken, dass sich die Tauglichkeit einer Religion durch praktische Bewährung erweisen muss, zu einem der Vorläufer des Kritischen Rationalismus.
Auf der anderen Seite betreibt er aber eine bedenkliche Beschränkung der religiösen Toleranz insofern, als er sie den drei Wüstenreligionen Judentum, Christentum und Islam vorbehält, also den drei monotheistischen Offenbarungsreligionen. Für all diejenigen, die trotz einer gewissen religiösen "Musikalität" das Gefühl nicht loswerden, unter einem leeren Himmel zu leben, ist in Lessings Familie kein Platz.
Ist diese Kritik unhistorisch insofern, als sie den Bewusstseinsstand der Epoche ignoriert, in der Lessing wirkte? Wird Lessing mit dieser Kritik überfordert? Keineswegs. Es gab Vertreter der Aufklärung und auch Exponenten geistiger Überlieferungen, auf deren Schultern die Aufklärung steht, die einen umfassenderen Toleranzbegriff hatten. In Lessings exklusivem Club war dagegen nicht einmal für die sogenannten Deisten Platz, also die Angehörigen einer im 18. Jahrhundert einflussreichen Bewegung, die Gott nur als erste Ursache der Welt anerkennen wollte und meinte, dass auf der Welt nur die von Gott unbeeinflussten Kräfte der Natur walteten.
Ist die Kritik deshalb ungerecht, weil ein Historiendrama als Parabel vereinfachen muss? Gebot nicht sogar die Struktur des Stückes, die Ausweitung der religiösen Toleranz auf die drei Religionen zu beschränken, die zur Zeit der Kreuzzüge relevant waren? Letzteres schon, doch beide Fragen sind vordergründig, denn die Auswahl des Stoffs und des historischen Ambiente ist ja schon das Ergebnis eines arg geschrumpften Toleranzverständnisses. Sonst hätte es nahegelegen, sich durch ein zeitgenössisches Drama der prallen Vielfalt der Weltreligionen, ihrer Verästelungen und ihrer Kritiker zu stellen, wie sie zur Zeit Lessings bestand.
Gegen den Nathan lässt sich weiter einwenden, dass Lessing die Religionen eindimensional betrachtet. Er stellt allein auf die Sozialethik ab, also auf die Gabe des Rings, "vor Gott und Menschen angenehm zu machen".
Auch ist die Familienmetapher einigermaßen halbherzig: Zu einem Wettstreit der Weltreligionen sollte auch die Möglichkeit gehören, dass sie sich wechselseitig befruchten, also voneinander lernen. Aber Recha und der Tempelherr können nicht heiraten. Sie sind Geschwister, und interreligiöse Blutschande findet bei Lessing nicht statt.
Die Geschwisterschaft weist nur auf eine bereits vorhandene Bindung und Abstammung hin, und auch insofern ist das Bild schief, denn die Eltern von Recha (Judentum) und dem Tempelherrn (Christentum) sind der Mohammedaner Assam und seine ungenannt gebliebene Frau. Nimmt man das ernst, steht die Religionsgeschichte auf dem Kopf.
Bei aller Kritik sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Lessings Nathan ein kraftvolles Plädoyer für Toleranz darstellt, der praktischen Humanität den gebührenden Stellenwert gibt und nebenbei auch die verschüttete Tradition des Dialogs als Mittel der Wahrheitsfindung wiederbelebt.
Das ist schon eine ganze Menge und sicherlich genug, um Lessing gegen Angriffe wie diesen in Schutz zu nehmen:
Und Lessing mit seiner umständlichen Ringparabel im Nathan? Die Toleranz wird auf die Fälschung gegründet, kein Ring ist echt, keine Wahrheit wahr.
Diese Bemerkung stammt von dem konservativen Publizisten Johannes Gross. Schön knapp immerhin. Ein Literaturwissenschaftler hätte dafür mindestens 20 Seiten gebraucht. Aber die jeweilige Unsinnsmenge lässt sich durch Knappheit nicht verringern:
Die Parabel ist alles andere als umständlich. Die Toleranz ist nicht auf Fälschung gegründet, sondern entzündet sich zufällig an der Ungewissheit darüber, was echt und was imitiert ist. Und schließlich kommt es nicht auf die dogmatische Wahrheit an, sondern auf die Fähigkeit der Umsetzung der Offenbarung in praktische Menschlichkeit.
Über Lessing und seine Kritiker hinaus stellt sich hier die Frage, ob der Versuch der Verwirklichung der christlichen Offenbarung, etwa in der Form der Feindesliebe, nicht ein größeres Bemühen erfordert als der Versuch der Realisierung der anderen Offenbarungen im Diesseits. Ist die Ethik der Bergpredigt eine Überforderung des Menschen und hindert diese Überforderung die Bewährung der christlichen Moral?
Manche Dramen verdanken ihren Platz in der Weltliteratur nicht den Antworten, die sie geben, sondern den Fragen, die sich aus ihnen ergeben.
Nathan mit der Meise
Dritter Aufzug, siebenter Auftritt, Alternativentwurf
NATHAN. Der echte Ring, so fuhr der Richter fort,
Vermutlich ging verloren
Doch weiß ich' nicht
Und letztlich ist es gleich
Doch strebe von Euch jeder um die Wette ...
HOFNARR. (springt hinter einem Diwan hervor):
Ich bin des Märchenkönigs vierter Sohn
Und hätte auch gern einen Ring!
NATHAN. (erbleicht) So sagt mir, Sultan
Wer ist dieser Mensch?
SALADIN. Ein Hofnarr nur aus Griechenland
Er liebt es sehr, hereinzuplatzen
In philosophische Gespräche
Doch wenn er Euch zu sehr verdrießt
Kann ich ihn recht gern töten lassen.
NATHAN. Bewahre!
HOFNARR. Dank Euch, toleranter Jude
Doch sagt mir gradheraus, erlauchte Geister:
Wo bleibt das Ringlein für den Bastard?
SALADIN. (launig)
Für welche Religion steht denn der Hanswurst hier?
HOFNARR. Für keine! Heidentum und Atheismus!
Sollen denn drei Religionen nur
Ohn´ Konkurrenz sich die Medaillen teilen?
NATHAN. Mir schwant, der Narr hat nicht begriffen
Dass nur des einen Gottes Offenbarung
Die Menschlichkeit im Menschen stiften kann!
SALADIN. Ganz recht!
HOFNARR. So bleib ich denn ein schmutziger Barbar
Der außer Konkurrenz Euch Gläubige besiegt
Denn wenn nun der Verzicht, einander hinzuschlachten
Nur der Gefolgschaft dreier Religionen gilt
Seid Ihr vor Gott und Menschen nicht so angenehm
Wie Ihr vermeint ...
SALADIN. Es reicht, hast Du noch was
Zu sagen, eh' die Folterknechte kommen?
HOFNARR. Verzeiht, ich will auch wieder ulkig sein
Wie Ihr, mein Sultan, losgelöst von aller Religion
Mir gnädig seid, doch würd ich gern noch wissen
Wieso die Echtheit Eures Zauberringes
Sich zeigen soll im Drang, dem anderen gut zu sein,
Statt in der Fähigkeit, ans Jenseits fest zu glauben.
NATHAN. Er will den Keim der Zwietracht, Sultan, in uns säen!
SALADIN. So schweige, Krämer! Unser Paradies
Ist wahr - und um dort hinzukommen
Gilt es, die Christen auszurotten
Und auch die Juden ...
NATHAN. Genug jetzt Goj
Du wirst noch in der Hölle braten
Vereint mit jenem Tempelherrn, dem Ketzer!
HOFNARR. Hätt ich damit doch bloß nicht angefangen!