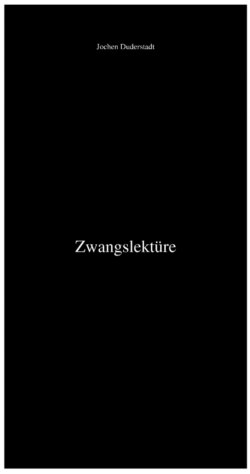Читать книгу Zwangslektüre - Jochen Duderstadt - Страница 6
ОглавлениеJohann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers (1774)
Handlung
"Werthers Leiden" sind die literarische Verarbeitung einer Frust-Episode, die Goethe als 23-jähriger Assessor am Reichskammergericht in Wetzlar erlebte. Ganze Schülergenerationen wären freilich froh gewesen, wenn es dem Dichter am Ende so ergangen wäre wie seinem Helden, denn dann wäre ihnen nicht nur der Gefühlsmatsch dieses Briefromans, sondern auch die titanische Langweilerei in Goethes späteren Werken erspart geblieben.
Der Held des Romans, nach außen hin ein aufstrebender junger Beamter, lebt in einem Zustand anhaltender Verzückung über Charlotte (Lotte), in die er sich hoffnungslos verliebt hat. Das bringt ihn in einen doppelten Konflikt mit der Welt:
Die kleinbürgerliche Enge der Provinzstadt und die antibürgerlichen Ressentiments seiner Vorgesetzten wecken bei ihm nur Ekel, nicht Standhaftigkeit. Er leidet, ohne sich zu wehren. Der Konflikt auf privater Ebene ist durch das Verlöbnis Lottes mit Albert bedingt, einem ehrlichen, aufrechten, praktisch veranlagten und natürlich langweiligen Beamten. Die beiden Männer sind zu verschieden, um miteinander auszukommen. Dass Werther fortfährt, trotz des bestehenden Verlöbnisses Lotte den Hof zu machen, trägt natürlich auch nicht zur Besserung des Verhältnisses bei.
Werthers ins Äußerste gesteigerte Empfindsamkeit, seine Neigung, sich ungehemmt und unbedingt seinen Gefühlen zu überlassen, treiben ihn in die Katastrophe.
Als er die Ausweglosigkeit seines Werbens um Lotte begreift, verlässt er die Stadt ohne Abschied, leidet aber in seiner neuen Umgebung schnell unter der Verarmung seines Gefühlslebens (Nicht eine selige, tränenreiche Stunde). Er gibt seine Stellung auf und gerät auf einigen Umwegen wieder in das Schwerefeld von Charlotte. Seine Rendezvous mit ihr bekommen einen immer masochistischeren Akzent - weiß er doch, dass Lotte sich längst mit sicherem Instinkt für den Lebenstüchtigeren entschieden hat.
Nach einer tränenreichen letzten Begegnung vollendet Werther seinen Abschiedsbrief an Lotte und jagt sich eine Kugel in den Kopf.
Deutung und Kritik
Aus dem Blickwinkel der Entstehungsgeschichte ist dieser Roman zunächst einmal der gelungene Versuch Goethes, sich von der Selbstmordgefährdung freizuschreiben, der sein Held schließlich erlag.
Es gibt drei verbürgte autobiographische Quellen für das Werk:
1. Als 22-jähriger juristischer Assessor war Goethe für einige Monate beim Reichskammergericht in Wetzlar. Bei einem Ball im nahen Volpertshausen lernte er die 19-jährige Lotte Buff kennen, die leider schon seit vier Jahren verlobt war und deshalb seinem leidenschaftlichen Werben widerstehen musste.
2. Auf demselben Ball war auch ein Studienkollege Goethes aus Leipzig, der Legationssekretär Jerusalem, der sich kurze Zeit später erschoss, weil er sich unsterblich in die Frau eines Anderen verliebt hatte.
3. Ein Jahr später (1773) war in Goethes Frankfurter Elternhaus eine Maximiliane Laroche zu Gast, und die erste Geschichte wiederholte sich. Das Mädchen ließ sich nicht auf den verliebten Goethe ein, sondern heiratete einen 20 Jahre älteren Kaufmann namens Brentano (literaturhistorisch gesehen sicherlich kein schlechter Griff, da aus dieser Ehe Bettina und Clemens Brentano hervorgingen, zwei wichtige Vertreter der Romantik).
Unter dem Eindruck dieser Ereignisse schrieb Goethe den Briefroman im Jahre 1774 in wenigen Wochen herunter.
Das Büchlein erfüllte nicht die Leseerwartungen der Kritiker. Es stellte in mehrfacher Hinsicht etwas völlig Neues dar.
Eines der wichtigsten Merkmale der Sturm- und Drang-Periode war die Befreiung des Gefühls aus seiner religiösen Gebundenheit, eine Entwicklung, die übrigens durch den Pietismus vorbereitet wurde, der die Vermittlung des Glaubens durch die Institutionen (Kirche) ablehnte und eine christliche Ethik predigte, die mit der Tugendhaftigkeit der Aufklärung viel gemein hat. Diese säkularisierte Inbrunst zeigte aber nun im Werther nicht die Stossrichtung, die man hätte erwarten können, nämlich die politische (siehe Götz von Berlichingen oder Kabale und Liebe), sondern eine rein private, und diese höchst private Gefühlsinnigkeit enthält in zahlreichen Bildern und Anspielungen religiöse Anklänge, die an die pietistische Tradition anknüpfen. So hat etwa der Held des Romans in seinen Briefen keine Scheu, seine Leiden mit der Passionsgeschichte Christi zu vergleichen.
Der entscheidende Bruch mit den Leseerwartungen des Publikums in indes anderer Art: Werther repräsentiert keine bürgerlichen Tugenden wie Tüchtigkeit, Beharrlichkeit, private Rechtschaffenheit und eine antihöfische Gesinnung. Seine Karriere ist ihm gleichgültig, und sein Tagesablauf entspricht eher dem eines Menschen, der im Wartezimmer sitzt.
Auch sein Widerpart Albert ist nicht der typische Bürgerliche der Aufklärung, sondern der Typ des tüchtigen, redlichen, unpolitischen und bei Hofe beliebten Beamten, der in jedem System seinen Mann stehen würde.
Führt nun die Enttäuschung der Leseerwartungen auch zur Enttäuschung über das Werk selbst?
Damals sicher nicht. Werther war etwas Neues, aber dieses Neue wurde mit Begeisterung aufgenommen. Neu war der absolute Vorrang der Innerlichkeit, also der privatistischen Gefühle. Werther´s "Herz" ist das einzige Thema des Romans.
Neu ist auch die völlige Unbedingtheit der Liebe Werthers, die kein Gesetz kennt und keine Regeln anerkennt. Werther kennt neben der Liebe zu Lotte keine auch nur annähernd gleichrangigen menschlichen Bindungen. Selbst sein Freund Wilhelm, an den er alle seine Briefe adressiert, und das Fräulein von B. sind neben seiner Herzdame nur Marionetten.
Auch die Natur, die vordergründig wie ein weiterer Gegenstand wertherscher Schwärmerei erscheint, wird - durch selektive Wahrnehmung - nur zum Spiegel des seelischen Erlebens. Folgerichtig müssen Naturerscheinungen als Metaphern herhalten: "Strom" und "Ausgießen" verweisen auf Werthers und Lottes nicht enden wollende Tränenströme und das "Untergehen" der Sonne kündigt seinen eigenen Untergang an.
Auch Werthers Lektüre ist der Spiegel seiner Empfindungen. Am Anfang bevorzugt er den heiteren Homer, während der Schluss des Romans durch die düsteren irischen Klagegesänge des Ossian beherrscht wird.
Der äußersten Ich-Bezogenheit des Helden entspricht auch die Darstellungsform: Hier berichtet kein um Objektivität bemühter Erzähler, sondern es ist der Held selbst, der, natürlich aus seiner höchst privaten Sicht, seine Gemütsbewegungen in Briefen an seinen Freund Wilhelm schildert, und diese Briefe haben oft so wenig Mitteilungswert in Bezug auf das Geschehen in der Außenwelt, dass sie eher Selbstgesprächen oder Tagebucheintragungen ähneln.
Der Roman zeitigte nach seinem Erscheinen Wirkungen, die heute nur noch in der Pop-Kultur denkbar wären. Eine Selbstmordwelle ging durchs Land, und parallel dazu wurde eine regelrechte Werther-Mode kreiert: Man parfümierte sich mit Eau de Werther, trug einen blauen Frack mit Messingknöpfen, dazu einen Filzhut. Darüber mag man heute lächeln, aber wer das tut, mag sich in Erinnerung rufen, was zum Beispiel nach dem Tod von James Dean, Jimi Hendrix oder Curt Cobain los war.
Die Leiden des jungen Warthers
Der dreihundertachtundfünfzigste Brief
Plemplenzdorf den 21. Julius 1988
Melanie,
es muss ein Ende nehmen, so oder so. Dich oder keine.
Auch Du muss Dich entscheiden: Unendliche Liebe oder die seichte Wollust Deines Verlobten.
Morgen Abend werde ich das Café aufsuchen, in dem Du nach Feierabend zu sitzen pflegst. Du erkennst mich an einer schwarzen Rose im Knopfloch. Ich komme, Dich zu holen, und wenn Du mich verschmähst, so lege ich noch in derselben Nacht Hand an mich.
Zu allem entschlossen
Dein Warther
Der Herausgeber an den Leser
Wetzlar, den 21. Februar 1990
Als Testamentsvollstrecker habe ich die ehrenvolle und zugleich schmerzvolle Aufgabe, Zeugnis abzulegen von den letzten Stunden des früh, zu früh verblichenen Erblassers Hermann Warther. Der Verstorbene hatte seinen Freund Heinrich testamentarisch zum Alleinerben eingesetzt, freilich mit der Auflage, die in Kopie vorhandenen Briefe an Melanie L. zu veröffentlichen und die Ereignisse nach Abfassung des letzten Schreibens zu dokumentieren. Da der Alleinerbe als Leiter der Sportredaktion einer großen Tageszeitung insbesondere dem zweiten Teil der testamentarischen Auflage nicht gewachsen zu sein vermeinte, hat er sie an mich delegiert, und zwar mit der ebenso einleuchtenden wie schmeichelhaften Begründung, ich sei als Notar weit besser geeignet, eine objektive und dennoch wohlwollende Darstellung der Ereignisse zu liefern.
Nach Einvernahme aller auffindbaren Augenzeugen steht folgender Sachverhalt fest:
Der Erblasser betrat zu dem von ihm angekündigten Zeitpunkt das Café "Herzblatt" in Plemplenzdorf, bemerkte Melanie L. und ihre neben ihr sitzende Freundin Nicole B., zuckte ersichtlich zusammen und ließ sich zögernd an einem in Hörweite entfernten Tisch nieder.
Melanie L. bemerkte ihn sogleich und flüsterte ihrer Freundin zu: "Da sitzt die Knalltüte." Diese warf einen Blick auf Warther und erwiderte in ungedämpfter Zimmerlautstärke: "Echt? Ich find´n süß. Überlass ne mir, ja? Den zieh ich mir heute Abend noch durch'n Schritt."
Warther wurde, nachdem er diese Einlassung gehört hatte, aschfahl, ballte die Fäuste und biss die Zähne in der Weise aufeinander, dass die Kaumuskulatur deutlich hervortrat. Alsdann sprang er auf, ging unverzüglich auf Melanie L. zu und presste hervor: "Mein Leben liegt in deiner Hand, Melanie. Wie hast du dich entschieden?"
Melanie L. blies ihm den soeben inhalierten Zigarettenqualm ins Gesicht und erwiderte: "Verpiss dich, Alter, du nervst mich ab."
Warther starrte sie entgeistert an, wandte sich abrupt ab und stürmte im Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit aus dem Lokal, wobei er einige Tische und einen Garderobenständer umriss.
Nur Sekunden später betrat der Verlobte von Melanie L., der Zeuge Maik K., das Café. Sie berichtete ihm kurz von dem Vorfall, worauf er eine drohende Haltung einnahm und nachhaltig mit den Augen rollte, obwohl man ihm ein ums andere Mal versicherte, dass der Verehrer seiner Verlobten längst entflohen war.
Warther verschied noch in derselben Nacht. Der letzte Zug nach Wetzlar trennte sein Haupt vom Rumpf. Der Verstorbene wurde in Plemplenzdorf beigesetzt. Der Erbe und ich, niemand sonst, begleiteten ihn zu seiner letzten Ruhestätte.