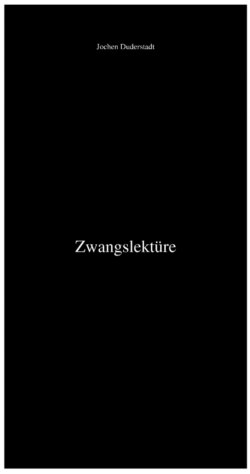Читать книгу Zwangslektüre - Jochen Duderstadt - Страница 8
Deutung und Kritik
ОглавлениеVon seiner Form und Struktur her genießt das Stück eine Ausnahmestellung.
Die Dialoge könnten einem altertümlichen Drehbuch entstammen. Sie enthalten weder Versmass noch Reime, und die Mehrzahl der auftretenden Personen spricht nicht die Hochsprache, sondern ein kräftiges, mundartlich gefärbtes Idiom, das an Martin Luther und Hans Sachs erinnert.
Vorbild für die Struktur des Stücks ist das Shakespearesche Drama und nicht etwa die französische Tragödie. Die schon von Lessing modifizierte Lehre von der Einheit des Orts, der Zeit und der Handlung wird vollends aufgegeben. Ein unübersichtliches Getümmel von Helden, Schurken und Statisten tummelt sich an unterschiedlichen Schauplätzen und bestimmt komplexe Handlungsabläufe in einem sich über Jahre erstreckenden Geschehen.
Goethe sah mehr als fünfzig Jahre später selbst ein, dass das Drama als Theaterstück nicht recht gehen konnte. Dazu fehlt dem Stück der tragische Konflikt.
Wie erklärt sich seine ungebrochene Popularität? An dem berühmten Götz-Zitat allein kann es nicht liegen (Vor Ihro Kaiserliche Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken.). Es ist sein ganzes Naturell, das ihm - unverdient, wir kommen noch drauf - zum Sympathieträger macht. Er redet wie er handelt, und umgekehrt: Kräftig, kernig, gradheraus, ohne Falsch, stur und ohne jeden Selbstzweifel. Er sprüht Zorn nach oben und strahlt zur Seite hin Harmonie aus. Tja, mit alldem kann man in Deutschland Identifikationsfigur werden.
Durch die Dramen des Sturm und Drang zieht sich wie ein roter Faden der Konflikt zwischen bürgerlicher Familie und höfischer Welt. Goethes entscheidender Fehler, der das Schauspiel für viele klar denkende Menschen ungenießbar macht, besteht nun darin, dass er gegen die Repräsentanten höfischer Niedertracht nicht einen bürgerlichen Helden beliebigen Geschlechts in den Ring schickt, sondern den Repräsentanten einer untergehenden Epoche, nämlich einen Ritter, genauer gesagt: einen Raubritter. Dass Götz ein Vertreter dieser für das ausgehende Mittelalter typischen Verbrechergruppe war, wird bei Goethe nicht einmal geleugnet. Es kommen nun bald Kaufleute von Bamberg und Nürnberg aus der Frankfurter Messe, sagt Götz, und: Wir werden einen guten Fang tun. Im nächsten Aufzug fleht eines der Opfer den Kaiser um Hilfe, um Beistand an und berichtet, er sei mit dreißig Leidensgenossen von Götz und seinem Komplizen Selbitz auf der Rückkehr von der Messe niedergeworfen und beraubt worden.
Man fragt sich, was staunenswerter ist: Die treuherzige Selbstverständlichkeit, mit der Götz hier - womöglich noch unter Berufung auf sein "gutes Recht" - den Festland-Piraten mimt, oder die hirnlose Zustimmung des heutigen Publikums, das diese Sorte von Kriminalität mit dem "Zeitgeist" rechtfertigt, bzw. des Sturm- und Drang-Publikums, dem man einen Raubritter als idealen Helden verkaufen konnte.
Der Schrei nach Freiheit hallt durch das gesamte Drama. Sehr schön. Wer möchte der Freiheitssehnsucht schon seine freudige Zustimmung versagen? Aber wessen Freiheit ist das, die hier heroisiert wird?
Gewiss war für den jungen Goethe der Absolutismus ein überholtes, ja schon anachronistisches Herrschaftssystem, sodass es auf den ersten Blick schlüssig erscheint, wenn er eine Figur zum Helden aufbaut, die sich dem (zu Beginn der Neuzeit erst aufblühenden) Absolutismus entgegenstemmt; er vertuscht damit aber zugleich, dass der von Götz vertretene "gemütliche" Feudalismus noch rückständiger und barbarischer ist.
Götz' primitives Naturrecht, wonach er nur Gott und dem Kaiser unterworfen ist, die ihm erfreulicherweise beide keine Vorschriften machen, wird romantisch verklärt; auf der anderen Seite muss natürlich das im Vordringen begriffene geschriebene Recht verteufelt werden, obwohl es einen unbestreitbaren Fortschritt in Form von Rechtssicherheit und Rechtseinheit geliefert hat.
Die Repräsentanten des Ritterstandes sind allesamt aufrecht, ehrlich, tatkräftig und gutherzig. Sogar ihre Beschränktheit wird noch zur Tugend. Dagegen Weislingen und die anderen Repräsentanten des fürstlich-klerikalen Macht: Verschlagen, intrigant, verräterisch und bestenfalls wankelmütig. Die Ritterchen leben im allerherzlichsten Einvernehmen mit ihren Untertanen, während Fürsten und Bischöfe das Volk knechten.
Welch ein Lore-Roman vom Feudalismus wird hier den Schülern zugemutet? Die Bereitschaft, sich an den zehn Geboten zu orientieren, war unter den Rittern eben so wenig vorhanden wie bei den Bischöfen, und aus der Fronbauernperspektive machte es wahrhaftig keinen Unterschied, ob man dem Ritter oder dem Fürsten diente. Fürsten und Bischöfe gewährleisteten aber eine effektive Zentralgewalt (wenn auch in Deutschland noch im Rahmen kleiner Territorien), die unbestreitbare ökonomische und kulturelle Fortschritte brachte.
Götz als Vertreter einer kleinen, aussterbenden Gruppe steht gerade deshalb, weil er sich gegen die geschichtliche Entwicklung stemmt, auf verlorenem Posten, aber sollen wir ihn deshalb, auch wenn wir alle Idealisierungsbemühungen Goethes nachvollziehen, bedauern?
Ist die Freiheit, für die Götz kämpft, die Freiheit, die wir meinen?