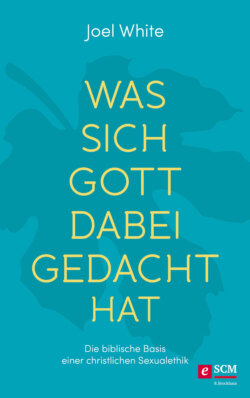Читать книгу Was sich Gott dabei gedacht hat - Joel White - Страница 11
2. Die Grundsätze einer christlichen Sexualethik
ОглавлениеWenn Christen also eine Sexualethik brauchen, wie gelingt es, diese anhand der Bibel herauszuarbeiten? Man kann nicht ohne Weiteres jeden einzelnen Bibeltext eins zu eins in die Gegenwart übertragen. Auch wenn dies der Karikatur bibeltreuer Gemeinden im Umgang mit der Bibel entspricht, sieht eine verantwortliche Hermeneutik, also eine »Lehre zur Auslegung von Texten« (vgl. Duden), anders aus. Denn erstens beschreibt die Bibel, insbesondere das Alte Testament, vieles, was sie nicht bejaht, beispielsweise die Polygamie. Diese Ehe mit mehreren Frauen gleichzeitig gab es häufig im alten Israel, und sie wurde im Gesetz nicht verboten, sondern bloß geregelt. Dennoch macht die Art und Weise, wie über polygame Beziehungen berichtet wird, klar: Sie waren immer mit negativen Konsequenzen für die Beteiligten verbunden.
Zweitens sind die kulturellen Gegebenheiten manchmal so anders, dass eine direkte Übertragung eines Bibeltextes in unsere Zeit nicht möglich ist. Es geht in diesen Fällen darum, dem Text die Prinzipien, die in der ursprünglichen Situation zur Anwendung kamen, zu entnehmen und diese in unserer Zeit geltend zu machen. Diese »Kontextualisierung« ist die unumgängliche Aufgabe eines jeden Auslegers, insofern er sich nicht nur mit historischen Fragen auseinandersetzen will.
All das erfordert ein Feingefühl im Umgang mit biblischen Texten, das erlernt werden will. Man muss sich fragen, nach welchen Prinzipien man bestimmte Aussagen zum Sexualverhalten in der Bibel für normativ erklärt und andere nicht, etwa weil sie kulturgebunden oder nur auf eine bestimmte Epoche im Heilsplan Gottes begrenzt sind. Im letzteren Fall gelten sie dann nur für Israel, aber nicht für die Kirche. Beispielsweise ist im mosaischen Gesetz der Geschlechtsverkehr einerseits mit einem gleichgeschlechtlichen Partner und andererseits mit einer menstruierenden Frau nachdrücklich untersagt. Sind das allgemeingültige Regeln oder kulturbedingte Aussagen, die in unserer Zeit revidiert werden dürfen oder sogar müssen? Wie begründen wir solche Entscheidungen?
Ethiker suchen nach Grundsätzen, die die einzelnen Verhaltensnormen untermauern. Man will ja nicht nur wissen, was die Bibel von uns verlangt, sondern auch warum. (Übrigens fördert die Bibel selbst diese Haltung – man beachte nur, wie sehr Paulus bemüht ist, seine Forderungen zu begründen, und wie oft er um Einsicht und Erkenntnis seitens seiner Leser betet.) Aus der Bibel lassen sich drei Grundsätze ableiten, mit denen man allgemeingültige Prinzipien in Bezug auf menschliches Sexualverhalten begründen kann: die Schöpfungsordnung, das Liebesgebot und die Ewigkeitsperspektive. Sie gleichen den drei Beinen eines Hockers, und wie bei einem Hocker sind alle drei gleichermaßen notwendig, um eine stabile Sitzfläche zu gewährleisten. Das sieht bildhaft so aus:
Abb. 1: Die drei Grundsätze der biblischen Sexualethik
Unter Schöpfungsordnung versteht man die ethischen Vorgaben, die von Gott in der Schöpfung angelegt sind. Das heißt, sie gelten für alle Menschen zu allen Zeiten, weil sie dem Grundmuster für das menschliche Miteinander entsprechen, wie Gott es am Anfang verordnet hat. Für Jesus war dies ein wichtiges Kriterium bei der Frage, welche sexualethischen Verhaltensnormen gelten sollen. Das geht aus seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern in der Frage nach Scheidung und Wiederheirat hervor. Dort legt er den Maßstab »Wie es am Anfang war« an, den er der Schöpfungsgeschichte entnahm (Mt 19,8). Davon leitet er Normen ab, die das Verhalten der Juden im 1. Jahrhundert regeln sollten, auch wenn diese mit Aussagen im mosaischen Gesetz in Konflikt geraten.
Mit dem Liebesgebot ist das mehrfach im Neuen Testament zitierte Gebot aus 3Mo 19,18 – »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« – gemeint. Sowohl Jesus (Mt 22,39 par) als auch Paulus (Röm 13,9; Gal 5,14) und Jakobus (Jak 2,8) betrachten dieses Gebot als Inbegriff dessen, worauf das moralische Gesetz zielt, und halten es für die wichtigste Norm im menschlichen Miteinander. Alle ethischen Forderungen müssen sich daran messen, wenn sie in vollem Umfang als christlich gelten sollen.
Schließlich muss man die Ewigkeitsperspektive der Schrift in sexualethischen Überlegungen miteinbeziehen. Gemeint ist die Ausrichtung der Bibel auf eine Zukunft in der Ewigkeit mit Gott, die bedingt, wie man im Jetzt lebt. In der Ewigkeit bleibt nicht alles, wie es bisher war. Jesus macht z.B. deutlich, dass es dann keine Ehe mehr geben wird (Mt 22,30; siehe dazu Abschnitt VI.1). Das heißt, auch wenn davon auszugehen ist, dass die sexuelle Unterscheidung zwischen Mann und Frau erhalten bleibt (weil sie für die Erschaffung des Menschen nach dem Ebenbild Gottes grundlegend ist; siehe dazu Abschnitt II.1), verändert sich das Sexualverhalten völlig. Diese Perspektive soll laut dem Apostel Paulus unsere Einstellung dazu im jetzigen Zeitalter beeinflussen (vgl. 1Kor 7,29-31).
Wichtig ist, dass man alle drei Grundsätze – um im Bild zu bleiben, alle drei Beine des Hockers – beachten muss. Vernachlässigt man einen davon, kommt es zu Verwirrungen im Denken und im Verhalten. Sehen wir uns das genauer an:
Abb. 2: Die Bedeutung der Schöpfungsordnung
Wenn die Schöpfungsordnung nicht oder zu wenig berücksichtigt wird, wird Sex bedeutungslos. Das »wozu« fehlt, denn die Schöpfungsgeschichte will uns, wie wir im Folgenden sehen werden, darin unterweisen, was Gott sich bei der Erschaffung der menschlichen Sexualität gedacht hat und welchem Zweck sie dient. Fragt man in christlichen Gemeinden danach, stellt man fest, wie selten die Frage nach der Bedeutung der menschlichen Sexualität gestellt wird. Ganz gleich, ob die Leiter oder die Mitglieder einer Gemeinde gefragt werden: Die meisten haben niemals darüber nachgedacht und wüssten auch nicht, wie sie es angehen sollten, die Frage zu beantworten. Dabei ist es aus biblischer Perspektive klar: Man konsultiert die Schöpfungsgeschichte bzw. spätere Stellungnahmen dazu in der Heiligen Schrift.
Das heißt nicht, dass die Schöpfungsordnung für sich allein stehen darf. Ihre einseitige Betonung führt – gerade unter Christen, die sich an biblischen Maßstäben orientieren – manchmal zu seltsamen Auswüchsen. Die Gefahr liegt darin, dass man sich allzu leicht mit suboptimalen Beziehungen zufriedengibt, solange die korrekte Form bewahrt wird. Stellen wir uns Jens und Claudia vor. Sie sind in derselben Gemeinde aufgewachsen und seit 10 Jahren miteinander verheiratet. Von Anfang an haben sie die sexualethischen Vorstellungen der Gemeinde erfüllt. Bei ihnen scheint auch alles in Ordnung zu sein, aber wie es in ihrer Beziehung aussieht, ob sie von Liebe und – wenigstens gelegentlich – von Leidenschaft geprägt ist, weiß keiner. Nach außen gut, alles gut, scheint die Devise zu sein.
Abb. 3: Die Bedeutung des Liebesgebots
Die Bewahrung einer äußeren Form ist jedoch aus einer christlichen sexualethischen Sicht zu wenig. Die sexuelle Beziehung muss von Liebe geprägt sein. Denn ohne Liebe kann Sex zu einem Albtraum werden. Wenn die Partner egoistisch handeln und lediglich auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse schauen, wird Sex zum Machtinstrument. Bei Männern dient er bald zur Unterdrückung der Frau, wie dies nach dem Sündenfall angekündigt wurde und seither überall auf der Welt geschieht: »Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen« (1Mo 3,16 ELB). Gemeint ist hier nicht das biblische Prinzip, dass der Mann in der Ehe eine Leitungsrolle übernehmen soll, sondern hier geht es um Machtausübung, sogar um physische und psychische Gewaltanwendung. Auch das kommt in christlichen Ehen vor: grobe Handlungen, die der Frau wehtun; Druck, bestimmte Handlungen durchzuführen, die der Mann in einem Porno gesehen hat; demütigende Vergleiche mit anderen Frauen.
Aber auch Frauen setzen Sex als Machtinstrument ein, wenn auch meistens auf subtilere Art und Weise. Frauen wissen instinktiv, dass es Männern in der Regel existenziell wichtiger ist, dass die sexuelle Beziehung rundläuft. Tendenziell hängt das Selbstbewusstsein des Mannes stärker von der momentanen Einschätzung der Qualität der sexuellen Beziehung ab als bei der Frau, und manche Frauen nützen diese Tatsache zu ihrem Vorteil. Sex wird als Belohnung für Verhalten, das ihren Wünschen entspricht, in Aussicht gestellt. Wenn der Mann brav ist, bekommt er Sex; wenn nicht, dann eben nicht.
Solche Verhaltensmuster sind auf Dauer Sexkiller. In vielen Ehen, von denen man meint, dass alles in Ordnung sei, läuft nichts. Die sexuelle Beziehung wird über weite Strecken vernachlässigt bzw. überhaupt nicht weitergeführt. Nun hat sexuelle Dysfunktion verschiedene Ursachen, aber nur in seltenen Fällen sind diese rein physischer Natur. Oft ist sie bedingt durch die Lebensphase, in der man sich gerade befindet (Kleinkinder zu Hause, beruflicher Stress, Einsetzung der Menopause). Aber in vielen Fällen stecken Verletzungen dahinter, die sich über Jahre hinweg durch liebloses Sexualverhalten angestaut haben. Das Liebesgebot lässt nicht zu, dass dieser Zustand einfach geduldet wird.
Es ist auch wichtig einzusehen, dass Gott selbst das Liebesgebot einhält. Wenn er Richtlinien für unser Sexualverhalten aufstellt, dann nicht, um uns einzuhämmern, dass er das Sagen hat und wir gefälligst zu gehorchen haben, sondern gerade weil er uns liebt. Er hat uns geschaffen und weiß daher, was für uns gut ist und was uns schadet. Er will nur das Beste für uns. Seine Prinzipien und seine Gebote, gerade in sexualethischer Hinsicht, spiegeln genau sein Bestreben danach wider. Das wird hoffentlich im Laufe des Buches klar.
Doch auch das Liebesgebot kann allein keine biblische Sexualethik ausreichend begründen, auch wenn viele genau das behaupten, unter anderen die Evangelische Kirche in Deutschland. In ihrem 2013 veröffentlichten »Familienpaper« leugnet sie das Konzept einer Schöpfungsordnung und erhöht die Liebe zu einem hinreichenden Kriterium, mit dem sich alle möglichen sexuellen Beziehungen rechtfertigen lassen.3 Es klingt zwar schön, wenn die Beatles singen: »All you need is love«, aber die Opfer dieser Devise wissen, dass jeder Betrug, jede Scheidung, jeder Partnerwechsel mit der Liebe – oder dem Mangel an Liebe – gerechtfertigt wird.
Abb. 4: Die Bedeutung der Ewigkeitsperspektive
Auch die Ewigkeitsperspektive darf nicht ausgeblendet werden. Geschieht dies, kommt es allzu leicht zu einer Überbewertung von Sex. Man erkennt dies in unserer Kultur: An die Ewigkeit denken die Menschen selten, an Sex dauernd. Guter Sex wird für den Schlüssel zum Glück schlechthin gehalten, und wenn die sexuelle Beziehung nicht klappt (oder man, Gott behüte, gar ohne sie leben sollte!), dann scheint für viele das Leben dahin zu sein. Ungeduld mit dem Partner ist vorprogrammiert, wenn Sex diese überbetonte Rolle einnimmt. Viele Beziehungen brechen unter dieser Last zusammen. Die Ewigkeitsperspektive relativiert den Wert des Sex in gesundem Maß. Sie erinnert uns daran, dass Sex keine notwendige Voraussetzung für ein erfülltes Leben ist; in der Ewigkeit kommt man ohne ihn bestens aus! Und selbst im Hier und Jetzt kann man auch ohne Sex gut und glücklich leben.
Die Ewigkeitsperspektive kann jedoch genauso wenig wie die anderen Grundsätze für sich alleine stehen. Wenn nur sie angewandt wird, verliert man leicht aus den Augen, dass der Schöpfer die geschlechtliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau gutheißt. In früheren Epochen der Kirchengeschichte führte diese einseitige Ausrichtung auf die Ewigkeit, wie wir gleich sehen werden, zu einer körperfeindlichen Haltung und einer Überbewertung des Zölibats als heiligerem Lebensentwurf.
Also müssen alle drei Grundsätze – die Schöpfungsordnung, das Liebesgebot und die Ewigkeitsperspektive – herangezogen werden, um den Umriss einer biblisch basierten christlichen Sexualethik zu erstellen. Dieser Aufgabe widmen wir uns im Folgenden. Aber zuerst müssen wir uns kurz darüber Gedanken machen, wie man biblische Texte auslegt. Erfolgt das nach eigenem Ermessen oder gibt es Prinzipien, die beachtet werden müssen, wenn wir Bibelstellen – in unserem Fall diejenigen, die normative Aussagen über Sexualität machen – auslegen?