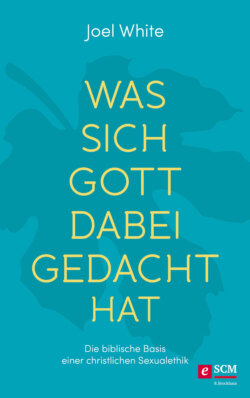Читать книгу Was sich Gott dabei gedacht hat - Joel White - Страница 13
4. Sexualität und das Vermächtnis der christlichen Kirche
ОглавлениеGott findet Sex gut. Diese Behauptung, die dieses Buch geltend zu machen versucht, mag für viele, die ihre sexualethische Prägung dem traditionellen Christentum verdanken, eine Überraschung sein. Denn die Kirche hatte – man kann es schwer leugnen – über Jahrhunderte hinweg ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität. Daran ist aber nicht die Bibel schuld, wie wir im Folgenden sehen werden, sondern die Entwicklung der Kirche in der Spätantike und im Mittelalter, die Spuren bis in unsere Zeit hinterlässt.
Die Kirchenväter, die im nachapostolischen Zeitalter in der weiteren Entwicklung der Morallehre der Kirche den Ton angaben, waren im Gegensatz zu den Aposteln, welche allesamt Juden waren, stark von der griechischen Philosophie und ihrer dualistischen Aufteilung der Welt in Materie und Geist geprägt. Demzufolge sei es die Aufgabe des tugendhaften Menschen, sich dem materiellen Leben so gut wie möglich zu entziehen, um sich dem Geistlichen zuzuwenden. Diese Haltung saugten die Kirchenväter mit der Muttermilch auf und führten sie unreflektiert fort, obwohl sie gerade nicht der biblischen Haltung entspricht. Sie neigten dazu, alles, was mit dem Körper zu tun hat – Nahrungszufuhr, Schlaf, Sex –, als ein notwendiges Übel zu betrachten, das vom wirklich Wichtigen, der Geistesebene, ablenkt.
Insbesondere war der sexuelle Trieb für sie schlecht und musste verdrängt werden. In der Ostkirche war z.B. Origenes (ca. 185–253) dermaßen von seiner eigenen sexuellen Begierde entsetzt, dass er sich kastrieren ließ. In der Westkirche entwickelte Augustinus (354–430) eine ausgeprägte Abneigung gegen Sex als Folge seines Bedauerns über das zügellose Leben, das er vor seiner Bekehrung geführt hatte. So war er der Meinung, dass Gott Adam und Eva im Garten in einem präpubertären Zustand erhielt. Das Erwachen des Sexualtriebs ging für ihn Hand in Hand mit dem Sündenfall. Die Vorstellung, dass Sex vor dem Sündenfall zum Leben im Paradies dazugehörte, war für ihn unerträglich.
Diese Haltung der Kirchenväter gehört zum Erbe der mittelalterlichen Kirche. Ihre Reaktion darauf war die starke Betonung des Zölibats. Der Klerus sah selbstverständlich ein, dass Sex zum Zweck der Fortpflanzung der Menschheit notwendig und somit nicht aus der Welt zu schaffen war. Der wirklich geistliche Mensch sollte jedoch auf Sex verzichten. Wer es nicht vermochte, keusch zu leben, sollte es möglichst innerhalb der Ehe treiben. (So genau hat man das im Mittelalter, zumindest bei Männern, nicht genommen.) Aber dabei sollte man an seine Pflicht denken, Kinder in die Welt zu setzen, und jeglichen mit dem Geschlechtsverkehr verbundenen und kaum zu leugnenden Genuss möglichst ausblenden!
Die Reformation läutete zu einem gewissen Grad eine Kurskorrektur ein. Luther betonte einerseits, dass alle Gläubigen Priester Gottes sind. Das implizierte natürlich unter anderem, dass nicht alle Priester ein zölibatäres Leben führen sollten. Die Ehe wurde zu einem gleichwertigen Stand neben dem Zölibat erhoben, und Letzteres war für den Klerus nicht mehr zwingend erforderlich, sollte sogar die Ausnahme sein.5 Luther ermutigte die Mönche und Nonnen, die sich seiner Bewegung anschlossen, zu heiraten und nahm selbst eine ehemalige Nonne, Katharina von Bora, zur Ehefrau. Sie scheint für ihn ein Glücksgriff gewesen zu sein.
Andererseits konnte die Reformation die körperfeindliche Morallehre der Kirche von allein nicht überwinden. In der Konsolidierungsphase der lutherischen Orthodoxie (etwa vom Tod Luthers bis zum Ende des 17. Jahrhunderts) verlor die positive Auffassung zur Sexualität, die Luther betonte, an Bedeutung, und vermeintlich geistlichere Aspekte des Ehelebens rückten in den Vordergrund.6 Bei den Pietisten, die 1690–1740 ihre Blütezeit genossen, laufen sowohl sexualitätsbejahende als auch körperfeindliche Stränge nebeneinanderher. Von alledem ließ sich die bürgerliche Mitte der Gesellschaft wohl weniger beeindrucken. Der Moralkodex der Kirche verlieh ihrem Leben seine Konturen; noch fiel es kaum jemandem ein, dass es dazu eine Alternative geben könnte. Sex war jedenfalls weiterhin etwas leicht Anrüchiges, für viele ein notwendiges Übel. Anständige Christen redeten nicht offen darüber.
Während der Zeit der Aufklärung blieb gerade die Morallehre der Kirche einschließlich ihrer bürgerlichen Sexualethik zunächst unangefochten. So mancher Denker in dieser Zeit (insbesondere ab 1740) pries sie als den Inbegriff göttlicher Vernunft. Liberale Theologen in Deutschland hielten sie für das wirklich Wertvolle am Erbe des Christentums, während sie das Fundament, auf dem sie stand, durch ihr schonungsloses Infragestellen des Wahrheitsgehaltes der Bibel schon abzutragen begonnen hatten. Sie wollten die Form bewahren, weil diese die bürgerliche Gesellschaft – für sie eine durch und durch positive Errungenschaft – untermauerte, und sich gleichzeitig von der Bibel, die sie nicht mehr für vertrauenswürdig erachteten, distanzieren.
Das konnte nicht auf Dauer gut gehen, und spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann der gesellschaftliche Konsens hinsichtlich der Richtigkeit der sexualethischen Lehre der Kirche abzubröckeln. Es hat natürlich immer solche gegeben, die sie ablehnten, und viele, die ihre Standards nicht einhielten, aber erst mit der Sexuellen Revolution lehnte sich eine breit aufgestellte Bevölkerungsschicht der westlichen Gesellschaft gegen sie auf. Diese begann, beflügelt durch Wohlstand und technologische Innovationen wie zuverlässige Geburtenregelung, freizügigere sexualethische Werte zu vertreten und offen danach zu leben.
So stehen am Anfang des 21. Jahrhunderts zwei konkurrierende sexualethische Wertesysteme nebeneinander, die auf zwei unterschiedlichen Weltanschauungen basieren. Inzwischen scheint vielen Menschen das neuere Wertesystem mit seiner Betonung von Freiheit und Entkrampfung die bessere Variante zu sein. Das Vermächtnis der Kirche ist zwar nicht nur negativ: Augustinus hat z.B. hervorragende theologische Reflexion über die Bedeutung der Ehe geleistet, und Luther hat bekanntlich den »weltlichen« Charakter der Ehe positiv herausgearbeitet. Ihr direkter und indirekter Einfluss auf die sexualethische Konzeption, die ich im Folgenden entwerfe, wird Fachkundigen erkennbar sein.
Dennoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kirche insgesamt ein verzerrtes Bild von menschlicher Sexualität vermittelt hat: Sie sei etwas, dessen man sich schämen muss, und nicht ein Teil der guten Schöpfung Gottes, die gefeiert werden soll. Die leibfeindliche Haltung der Kirchenväter – das Erbe der platonischen Philosophie, die ihr Weltbild stark prägte – führte in der Geschichte der Kirche immer wieder dazu, dass Christen den Sexualtrieb für grundsätzlich negativ hielten. Somit wurde unterschwellig verneint, dass der Mensch ein geschlechtliches Wesen ist, und impliziert, dass sexuelles Verlangen durch unheimliche Anstrengungen, die nur von wirklich geistlichen Menschen erbracht werden können, überwunden werden muss. Dieser Impuls ist bis heute in der Kirche nicht ganz überwunden worden und wird von vielen christlichen Gruppierungen zumindest unbewusst weiterhin gefördert.
Nach diesem kurzen Abriss über die geschichtliche Entwicklung der sexualethischen Lehre der Kirche in Europa drängen sich zwei Fragen auf:
1. Entspricht die biblische Lehre über die menschliche Sexualität dem deprimierenden Bild, das die Kirche im Laufe ihrer Geschichte oft vermittelte? Darauf gehen wir insbesondere im zweiten Kapitel ein. Wir werden sehen, dass die Bibel ein durchwegs positives und lebensbejahendes Bild der sexuellen Beziehung malt. Dies ruht auf der alttestamentlichen Überzeugung, dass Gott die materielle Welt samt ihren Abläufen geschaffen hat und sie deswegen gut ist, wirklich gut (vgl. 1Mo 1,31; Psalm 24,1-2; 1Kor 10,26)! Die griechisch-philosophische Trennung zwischen Materie und Geist ist ihr völlig fremd. Sie bejaht insbesondere die geschlechtliche Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe uneingeschränkt.
2. Bietet das neue sexualethische Wertesystem, das seit der Sexuellen Revolution in der westlichen Gesellschaft propagiert wird, eine gute Alternative zur biblischen Lehre? Hält es, mit anderen Worten, was es verspricht: mehr Freiheit, einen entspannten Umgang mit Sexualität? Führt es dazu, dass Menschen gedeihen, sich entfalten und schließlich bessere Menschen sind? Das behandeln wir schwerpunktmäßig im dritten Kapitel. Wir werden sehen, dass die Folgen der Sexuellen Revolution keineswegs dem entsprechen, was sie sich vorgestellt hat, und dass nicht ihr Wertesystem, sondern das der Bibel die Freiheit bietet, wonach sich die Menschen immer gesehnt haben.